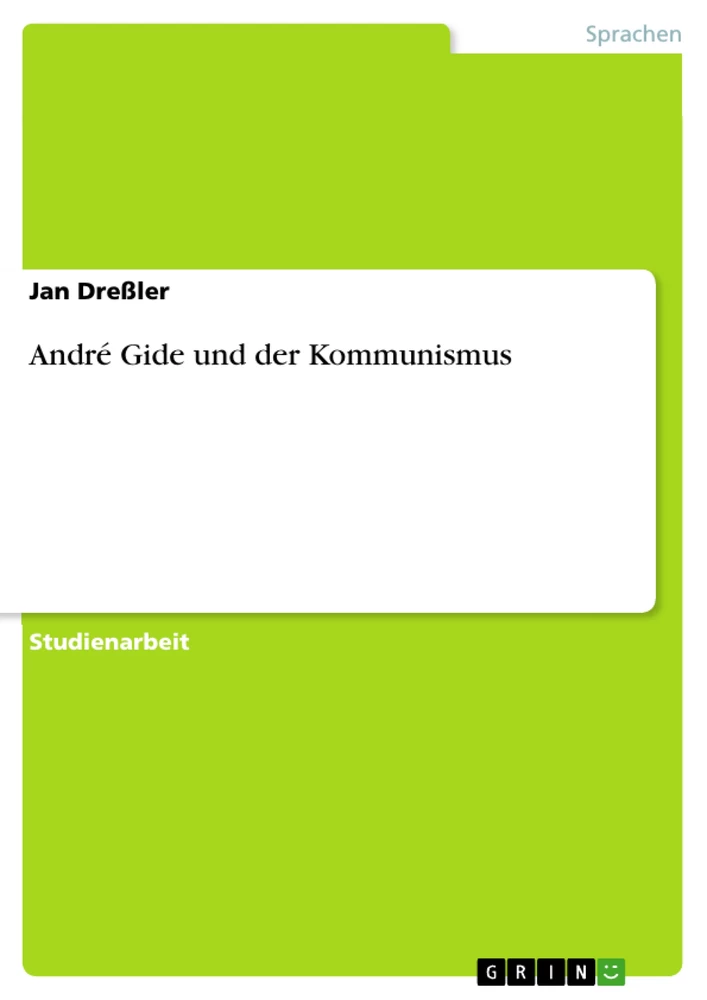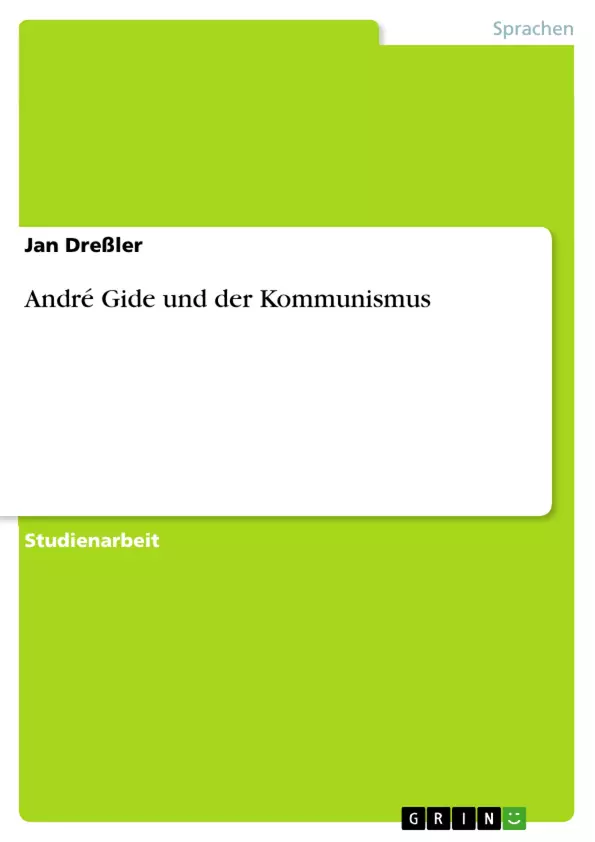Das Verhältnis von Freiheit und Individuum ist eines der zentralen Motive in Gides Werk. Der Einzelne, der sich von gesellschaftlichen Konventionen und ihm auferlegter Moral löst und sich auf seinen eigenen Geist, seine innere Weisheit besinnt – das ist André Gides Ideal des freien Menschen. Die politische die wirtschaftliche Organisation der Gesellschaft ist für ihn dabei nur von sekundärem Interesse, d.h. nur insofern sie auf das Individuum wirkt. Und doch schließt er sich der kommunistischen Bewegung an, die sich zwar die Freiheit als Endziel auf ihre Fahnen geschrieben hat, aber dort, wo sie die Staatsmacht innehat, den Grad der Unfreiheit des Einzelnen noch erhöht und wie jede organisierte Bewegung den Einzelnen der „Sache“, d.h. einem Ziel oder einem Zweck unterordnet. Dabei ergeben sich für Gide zwei Grundprobleme, die schließlich auch zu seinem Bruch mit dem organisierten Kommunismus führen: Erstens, der Gegensatz zwischen individueller Freiheit und der Unterordnung unter einen Zweck und eine (wenn auch neue) Moral, und zweitens, der Gegensatz zwischen den Idealen einer Utopie (der Vorstellung einer idealen Gesellschaft) und der Realität.
Inhalt
Einleitung
Historischer und biographischer Hintergrund
Gides Weg zum Kommunismus
Gides Kommunismus
Die Reise in die Sowjetunion
Die Rückkehr aus der Sowjetunion
Fazit
Literatur
Einleitung
Das Verhältnis von Freiheit und Individuum ist eines der zentralen Motive in Gides Werk. Der Einzelne, der sich von gesellschaftlichen Konventionen und ihm auferlegter Moral löst und sich auf seinen eigenen Geist, seine innere Weisheit besinnt – das ist André Gides Ideal des freien Menschen. Die politische die wirtschaftliche Organisation der Gesellschaft ist für ihn dabei nur von sekundärem Interesse, d.h. nur insofern sie auf das Individuum wirkt. Und doch schließt er sich der kommunistischen Bewegung an, die sich zwar die Freiheit als Endziel auf ihre Fahnen geschrieben hat, aber dort, wo sie die Staatsmacht innehat, den Grad der Unfreiheit des Einzelnen noch erhöht und wie jede organisierte Bewegung den Einzelnen der „Sache“, d.h. einem Ziel oder einem Zweck unterordnet. Dabei ergeben sich für Gide zwei Grundprobleme, die schließlich auch zu seinem Bruch mit dem organisierten Kommunismus führen: Erstens, der Gegensatz zwischen individueller Freiheit und der Unterordnung unter einen Zweck und eine (wenn auch neue) Moral, und zweitens, der Gegensatz zwischen den Idealen einer Utopie (der Vorstellung einer idealen Gesellschaft) und der Realität.
Historischer und biographischer Hintergrund
Als sich Gide 1932 im Alter von 62 Jahren als Anhänger des Kommunismus erklärt, hat die Sowjetunion, das Land in dem der Kommunismus auf dem Wege der Verwirklichung sein soll, schon einen langen Weg hinter sich. Ging der Kommunismus bis in die 20er-Jahre des 20. Jahrhunderts noch als Gespenst in Europa um, so wurde er in den 30er-Jahren salonfähig. Ziel ist nicht mehr die Ausweitung der Revolution, sondern die außenpolitische Sicherung der UdSSR durch engere Beziehungen mit den westlichen Staaten. So tritt die Sowjetunion 1934 dem Völkerbund (dem Vorläufer der Vereinten Nationen, den Lenin noch als „imperialistische Räuberhöhle“ bezeichnet hatte) bei. In gleichem Maße sucht die sowjetische Führung nach Unterstützung bei den westlichen Intellektuellen, und da der Kommunismus kein „Bürgerschreck“ mehr war, findet sie diese auch in hohem Maße. Viele Schriftsteller und Künstler erklären öffentlich ihre Unterstützung für die Sowjetunion. Zu den „Freunden der Sowjetunion“ gehören der Brite George Bernard Shaw, Leon Feuchtwanger und Heinrich Mann aus Deutschland und aus Frankreich Romain Rolland, Henri Barbusse und schließlich auch André Gide. Viele davon reisten auch wie Gide in die Sowjetunion. In anderen Teilen der Bevölkerung hat der Kommunismus ebenfalls viele Anhänger.
Auch die Krise der bürgerlichen Demokratien und des Kapitalismus seit dem Ersten Weltkrieg treiben dem Kommunismus viele Anhänger zu. Die bürgerliche Demokratie hat den gesellschaftlichen Auflösungserscheinungen, die der Weltkrieg mit sich gebracht hat, wenig entgegenzusetzen und die weltweite Wirtschaftskrise trägt seit dem Ende der 20er-Jahre ebenso zur ideologischen Schwächung des Systems bei. So ist Gide 1936 der Überzeugung, dass die nationalistischen und faschistischen Kräfte, die zu der Zeit in den westlichen Ländern immer weiter um sich greifen, die Kultur gefährden und dass das „sort de la culture est lié dans nos esprits au destin même de l’U.R.S.S.“[1], und er erwartet von der Sowjetunion „un immense progrès“[2], den der Kapitalismus nicht mehr zu bieten scheint. Für Gide ist die Sowjetunion wie für viele andere ein Leuchtfeuer einer neuen, besseren und freien Gesellschaft.
In der UdSSR selbst ist Stalin spätestens seit Anfang der 30er-Jahre unumschränkter Alleinherrscher. Die wechselnden politischen Bündnisse, die er in den 20er Jahren zur Absicherung seiner Position mit verschiedenen ranghohen Bolschewiki (z.B. Sinowjew und Kamenjew) eingegangen war, hat er nicht mehr nötig. Nun geht er daran, jede Opposition, jeden der auch nur im Verdacht steht, seine Herrschaft in Frage zu stellen, zu unterdrücken. Die Moskauer Schauprozesse 1936-38 gegen die alten Kader der Kommunistischen Partei stellen nur einen traurigen Höhepunkt dar. Die Säuberungen sind permanent und allumfassend.
Diese politische und gesellschaftliche Situation allein kann jedoch Gides Engagement nicht erklären. Die Ereignisse der Oktoberrevolution haben in seinem Tagebuch, dem Spiegel seiner Seele, kaum eine Rolle gespielt und wenn, dann keine positive. Gide war niemals ein politischer Mensch gewesen. Sein Interesse galt der menschlichen Psyche, ihrer Einengung durch gesellschaftliche Konventionen und der Emanzipation von diesen Konventionen, die für ihn individuelle Freiheit ausmachte.
[...]
[1] André Gide: Souvenirs et Voyages. Éditions Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade): Paris, 2001, 788.
[2] Ebenda, 749.
Häufig gestellte Fragen
Warum schloss sich André Gide dem Kommunismus an?
Gide suchte in der Sowjetunion ein Ideal der Freiheit und einen Gegenentwurf zum kriselnden Kapitalismus und dem aufkommenden Faschismus in Europa.
Was war der Grund für Gides Bruch mit der Sowjetunion?
Nach seiner Reise in die UdSSR 1936 erkannte er den Gegensatz zwischen seiner utopischen Vorstellung von Freiheit und der repressiven Realität unter Stalin.
Welche Rolle spielt das Individuum in Gides Werk?
Das Ideal des freien Menschen, der sich von gesellschaftlichen Konventionen löst, ist Gides zentrales Motiv, was im Widerspruch zur kollektiven Unterordnung im Kommunismus stand.
Wie reagierten andere Intellektuelle seiner Zeit?
Viele namhafte Schriftsteller wie Heinrich Mann oder Romain Rolland galten ebenfalls als „Freunde der Sowjetunion“, doch Gide war einer der ersten, der öffentliche Kritik übte.
War Gide ein politischer Mensch?
Ursprünglich nicht; sein Interesse galt primär der menschlichen Psyche. Erst die Weltkrise der 1930er Jahre trieb ihn zu seinem politischen Engagement.
- Citar trabajo
- Jan Dreßler (Autor), 2004, André Gide und der Kommunismus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58185