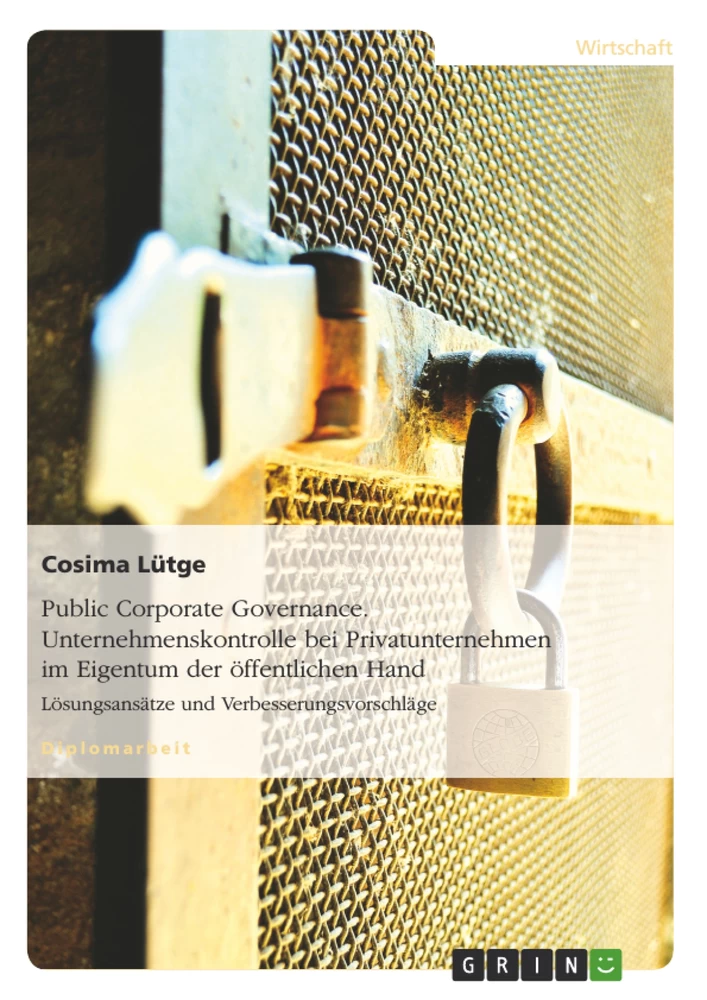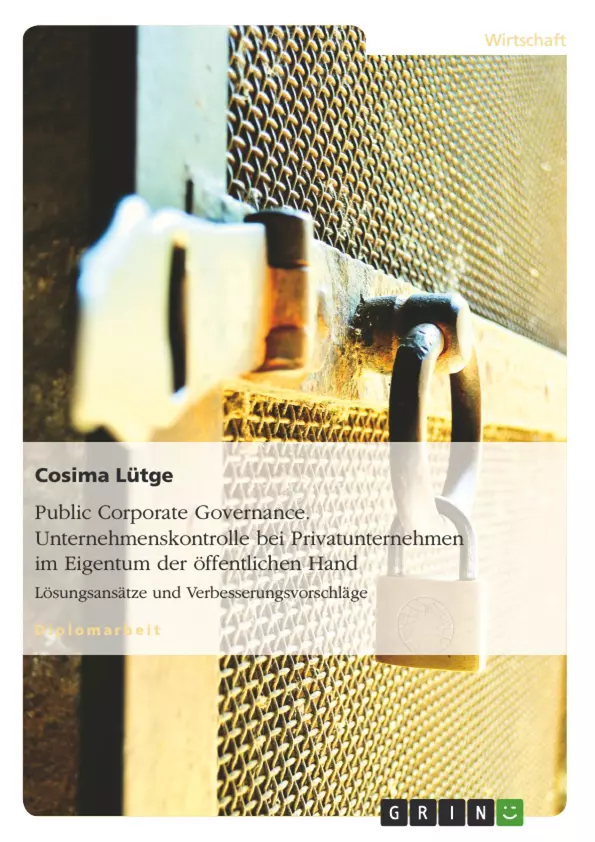In den vergangenen Jahren wurden in zunehmendem Umfang mittels Formprivatisierungen die traditionellen, öffentlich-rechtlich organisierten öffentlichen Unternehmen (wie z.B. Sondervermögen, Eigenbetriebe) durch privatrechtlich organisierte Unternehmen ersetzt, und auch im Verwaltungsbereich der Kommunen wurden immer mehr öffentliche in privatrechtliche Organisationsformen umgewandelt.1 Daraus sind sowohl Privatrechtsunternehmen im alleinigen Besitz der öffentlichen Hand entstanden, als auch Mischformen – so genannte Public Private Partnerships – bei denen zu dem öffentlichen Eigner auch private Anteilseigner hinzukommen.2 Als Begründung für diese Vorgehensweise ist häufig das Argument des Effizienzvorteils zu finden.3 Der privatrechtliche Unternehmensbereich des Staates, der überwiegend kommunale Aufgaben erfüllt, unterliegt aber kaum einer parlamentarischen Steuerung und Kontrolle.4 Wenn der Staat in öffentlich-rechtlichen Organisationsformen handelt, gibt es Regel- und Kontrollmechanismen, die ausschließlich auf den Eigner öffentliche Hand ausgerichtet sind. Diese gelten aber nicht, wenn er in Privatrechtsform tätig ist. Außerdem kommt bei einer privaten Kapitalbeteiligung der immanente Konflikt zwischen der Erfüllung der öffentlichen Aufgabe einerseits und dem Gewinninteresse der privaten Eigner andererseits hinzu.5 Somit ist der Unternehmenskontrolle bei Privatunternehmen im Eigentum der öffentlichen Hand gesteigerte Aufmerksamkeit zu widmen. Es besteht die Gefahr, dass zum Teil bewusst Einbußen bei den Kontrollrechten hingenommen werden, da die Formprivatisierungen und die Beteiligung von Privaten durch den finanziellen Handlungsdruck der Politiker bestimmt werden.6 Die beteiligten Akteure können zu ihren eigenen Gunsten und auf Kosten der übrigen Bevölkerung handeln, wenn keine verantwortungsvolle Kontrolle stattfindet,7 obwohl der Staat für das ihm von den Bürgern überlassene Staatsvermögen nur eine treuhänderische Funktion besitzt.8 In dieser Arbeit soll nun betrachtet werden, welche Probleme und Defizite hinsichtlich der Unternehmenskontrolle bei Privatunternehmen im alleinigen und teilweisen Eigentum der öffentlichen Hand bestehen, welche Lösungsansätze diskutiert werden und welche Verbesserungen sinnvoll erscheinen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Überblick über privatrechtliche Unternehmen der öffentlichen Hand und Begriffsabgrenzung
- 2.2 Grundsätzliche rechtliche Regelungen
- 3 Unternehmensinterne Kontrollmöglichkeiten
- 3.1 Weisungsmöglichkeiten
- 3.1.1 Weisungen gegenüber den Vertretern der öffentlichen Hand im Aufsichtsrat einer AG
- 3.1.2 Weisungen gegenüber den Vertretern der öffentlichen Hand im Aufsichtsrat einer GmbH
- 3.1.3 Weisungen gegenüber dem Vorstand einer AG
- 3.1.4 Weisungen gegenüber dem Geschäftsführer einer GmbH
- 3.2 Informationsmöglichkeiten
- 3.2.1 Informationsweitergabe der Vertreter der öffentlichen Hand im Aufsichtsrat und des Vorstandes einer AG
- 3.2.2 Informationsweitergabe der Vertreter der öffentlichen Hand im Aufsichtsrat einer GmbH
- 3.3 Die Kontrolle durch den Aufsichtsrat
- 3.3.1 Ausweitung der Mitbestimmung
- 3.3.2 Anforderungen an die Aufsichtsratsmitglieder
- 3.3.3 Vielschichtiges Principal-Agent-Problem
- 3.4 Ergebnis der unternehmensinternen Kontrolle
- 3.1 Weisungsmöglichkeiten
- 4 Unternehmensexterne Finanzkontrollmöglichkeiten
- 4.1 Externe Wirtschaftsprüfung
- 4.2 Erweiterte Prüfung und Berichterstattung
- 4.3 Die Prüfung durch die Rechnungshöfe
- 4.3.1 Die Flucht aus dem Budget
- 4.3.2 Die Betätigungsprüfung
- 4.3.2.1 Prüfungsgegenstand und -beauftragung
- 4.3.2.2 Übersendung von Unterlagen
- 4.3.2.3 Unmittelbares Unterrichtungsrecht
- 4.3.3 Direkte Prüfungsmöglichkeit
- 4.3.4 Kontrollprobleme durch die Rechnungshöfe selbst
- 4.4 Kommunales Rechnungswesen als Informationsgrundlage für den Gesamtüberblick
- 4.5 Ergebnis der externen Finanzkontrollen
- 5 Weitere externe Kontrollmöglichkeiten
- 5.1 Der Beteiligungsbericht als Kontrollinstrument für Parlament und Öffentlichkeit
- 5.2 Sanktionsmechanismen des Marktes
- 5.3 Ergebnis der weiteren Kontrollen
- 6 Die Diskussion über mögliche Lösungen und eigene Verbesserungsvorschläge
- 6.1 Anwendung des Deutschen Corporate Governance Kodex
- 6.2 Anwendung eines Public Corporate Governance Kodex
- 6.2.1 Erläuterung
- 6.2.2 Praktische Relevanz
- 6.3 Anreize für die Einhaltung von Kodex-Vorschriften
- 6.4 Eigene Verbesserungsvorschläge
- 6.4.1 Externe Überwachung jeder einzelnen Rechtsformentscheidung
- 6.4.2 Gesetzliche Vorgaben bei bestehenden Beteiligungen
- 6.4.2.1 Beachtung des DCGK als Mindeststandard und operationale Festlegung der öffentlichen Aufgabe in der Satzung
- 6.4.2.2 Persönliche Haftung der einzelnen Beteiligten und Vermeidung von Interessenkonflikten des Managements
- 6.4.2.3 Pflicht zur Bildung eines Aufsichtsrates, keine Ausweitung der Mitgliederzahl, keine Verschwiegenheitspflicht bei Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen sowie Vermeidung von Interessenkonflikten und unzureichender Qualifikation
- 6.4.2.4 Keine gleichzeitige Vertretung in Aufsichtsrat und Hauptversammlung, Pflicht zur Erörterung der Tagesordnungspunkte
- 6.4.2.5 Pflicht zur Durchführung der Betätigungsprüfung durch die Rechnungsprüfungsbehörden und Einräumung eines direkten Prüfungsrechtes
- 6.4.2.6 Veröffentlichungspflicht der Prüfungsergebnisse, Volksentscheidung über Vorschläge der Rechnungsprüfungsbehörden und demokratische Legitimation der Mitglieder
- 6.4.2.7 Stärkung der Kontrollfunktion der Beteiligungsverwaltung
- 7 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert die Kontrollmöglichkeiten bei Privatunternehmen im Eigentum der öffentlichen Hand, auch bekannt als Public Corporate Governance.
- Die Arbeit untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen und die verschiedenen Kontrollmechanismen, sowohl intern als auch extern, die für die Steuerung dieser Unternehmen relevant sind.
- Sie beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus dem Principal-Agent-Problem ergeben, und untersucht die Rolle von Aufsichtsräten und Rechnungshöfen bei der Kontrolle dieser Unternehmen.
- Darüber hinaus analysiert die Arbeit die Anwendung des Deutschen Corporate Governance Kodex und diskutiert die Entwicklung eines spezifischen Public Corporate Governance Kodex.
- Sie stellt eigene Verbesserungsvorschläge zur Stärkung der Kontrollmechanismen und zur Förderung einer transparenten und verantwortungsvollen Unternehmensführung im öffentlichen Sektor vor.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Problemstellung ein und beschreibt den Gang der Untersuchung. Kapitel 2 legt die Grundlagen für die Analyse, indem es den Begriff der privatrechtlichen Unternehmen der öffentlichen Hand definiert und die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen beleuchtet. Kapitel 3 behandelt die unternehmensinternen Kontrollmöglichkeiten, wobei die Schwerpunkte auf Weisungsmöglichkeiten, Informationsmöglichkeiten und der Kontrolle durch den Aufsichtsrat liegen. Kapitel 4 analysiert die externen Finanzkontrollmöglichkeiten, insbesondere die Rolle der externen Wirtschaftsprüfung, der erweiterten Prüfung und Berichterstattung sowie der Prüfung durch die Rechnungshöfe.
Kapitel 5 befasst sich mit weiteren externen Kontrollmöglichkeiten wie dem Beteiligungsbericht und den Sanktionsmechanismen des Marktes. Kapitel 6 diskutiert mögliche Lösungen und eigene Verbesserungsvorschläge, insbesondere die Anwendung des Deutschen Corporate Governance Kodex und die Entwicklung eines Public Corporate Governance Kodex. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet eine Schlussbetrachtung.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Public Corporate Governance, Unternehmenskontrolle, öffentliches Eigentum, Aufsichtsrat, Rechnungshöfe, Betätigungsprüfung, Beteiligungsbericht, Deutscher Corporate Governance Kodex, Public Corporate Governance Kodex, Principal-Agent-Problem, Rechtsformen, Transparenz, Verantwortungsvolle Unternehmensführung, Kontrolle, Weisungsmöglichkeiten, Informationsmöglichkeiten, Sanktionsmechanismen, Rechtliche Rahmenbedingungen, Finanzkontrolle, externe Wirtschaftsprüfung, erweiterte Prüfung und Berichterstattung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Public Corporate Governance?
Es bezeichnet die Grundsätze einer guten und verantwortungsvollen Führung und Kontrolle von Unternehmen, die sich im Eigentum der öffentlichen Hand befinden.
Welche Probleme entstehen bei der Privatisierung öffentlicher Aufgaben?
Häufig schwindet die parlamentarische Kontrolle, und es entsteht ein Konflikt zwischen dem öffentlichen Auftrag und dem Gewinninteresse privater Anteilseigner.
Was ist das Principal-Agent-Problem in diesem Kontext?
Es beschreibt das Informationsgefälle und die unterschiedlichen Interessen zwischen dem Eigner (Staat/Bürger) und dem Management des Unternehmens.
Wie kontrollieren Rechnungshöfe privatrechtlich organisierte Staatsunternehmen?
Rechnungshöfe führen Betätigungsprüfungen durch, stoßen jedoch oft auf rechtliche Grenzen bei der Einsicht in Geschäftsgeheimnisse oder bei direkten Prüfungsrechten.
Was ist der Public Corporate Governance Kodex?
Ein Regelwerk, das speziell auf die Anforderungen öffentlicher Unternehmen zugeschnitten ist, um Transparenz und Rechenschaftspflicht zu erhöhen.
Welche Verbesserungsvorschläge macht die Arbeit für die Unternehmenskontrolle?
Vorgeschlagen werden unter anderem die Pflicht zur Bildung eines Aufsichtsrates, die Aufhebung der Verschwiegenheitspflicht gegenüber Kontrollorganen und die Veröffentlichung von Prüfungsergebnissen.
- Quote paper
- Cosima Lütge (Author), 2006, Public Corporate Governance. Unternehmenskontrolle bei Privatunternehmen im Eigentum der öffentlichen Hand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58205