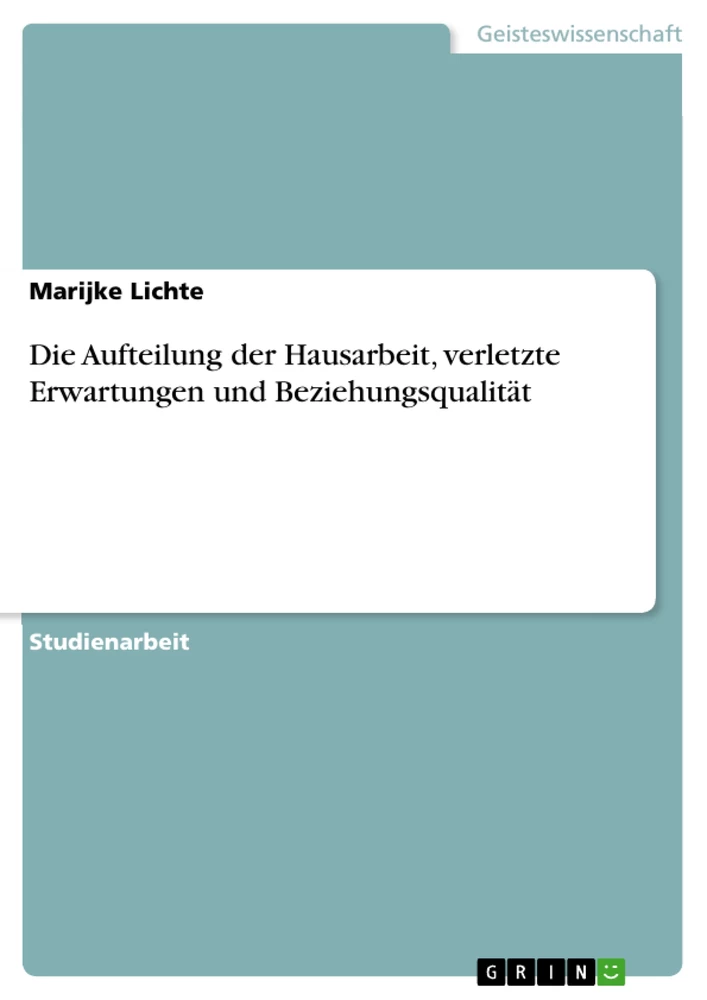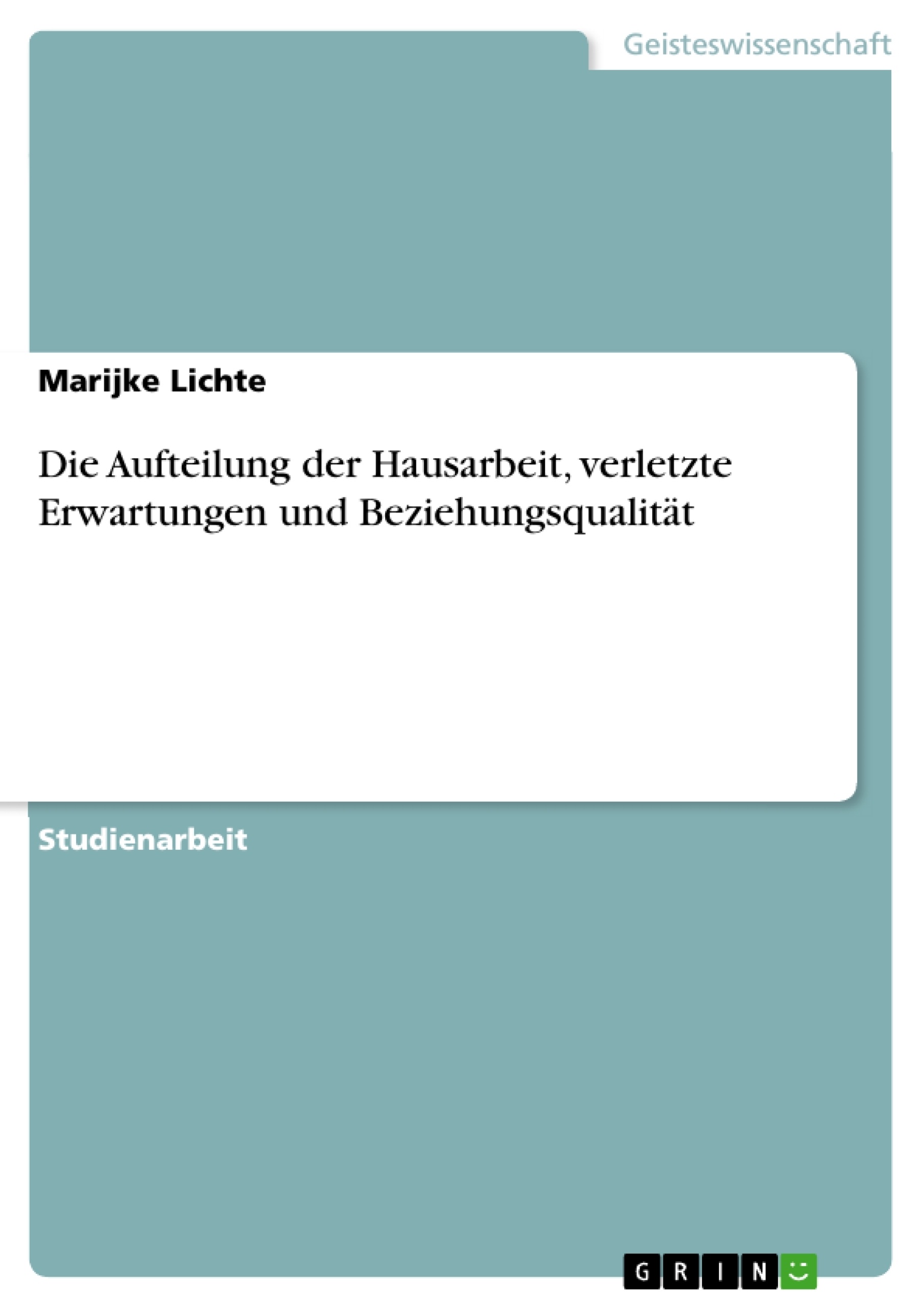In der schriftlichen Ausarbeitung des Referates vom 09.07.03 zur Verteilung der Hausarbeit in Paarbeziehungen sollen zunächst einmal die vier hierfür verwendeten Analysen vorgestellt werden. Untersuchungsgegenstand bei Rohmann, Schmohr, Bierhoff1 ist es, zu prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen Hausarbeitsverteilung, Erwartungen und Beziehungsqualität besteht. Als Grundlage dient ihnen eine 2002 erschienene Stichprobe, bei der 92 Personen, die in heterosexuellen Gemeinschaften paarweise zusammenlebten, Auskunft gaben. Künzler2 hingegen untersucht den für Hausarbeit eingesetzten Zeitaufwand als Belastungsmaßstab in Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften. Als Datenbasis verwendet er dazu eine Stichprobe der 12. Welle des sozio-ökonomischen Panels, zu dem 1995 ursprünglich 13.768 Personen befragt wurden.
Anhand einer 2002 erschienenen Stichprobe der Schweizer Familienstudie aus ursprünglich 1.534 Paaren, suchen Levy und Ernst3 nach Bestimmungsgründen für die Ungleichheit in der Hausarbeitsverteilung und fragen danach, ob Normen egalitärer seien als die Praxis. Schließlich zeigen Klaus und Steinbach4 auf der Grundlage einer multinominalen Regressionsanalyse aus den Erhebungswellen 1988 und 1994 Determinanten der innerfamilialen Arbeitsteilung in Partnerschaftsverläufen auf. Die Autoren beziehen sich im wesentlichen auf die theoretischen Ansätze der Equity-Theorie, des Time-Availability-Modells, der Doing-Gender-Theorie und schließlich der Ressourcentheorie, welche bei Klaus und Steinbach noch um die Austausch- und ökonomische Haushaltstheorie erweitert wird. Im folgenden sollen die Untersuchungsergebnisse auf Bestätigung oder Unbrauchbarkeit der einzelnen Hypothesen und hinsichtlich der unterschiedlichen Fragestellungen geprüft, und ein abschließendes Fazit daraus gezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Equity-Theorie
- 2. Die Doing-Gender-Theorie
- 3. Ressourcen-Theorie
- 3.1. Bildung
- 3.2. Einkommen
- 4. Austauschtheorie
- 5. Ökonomische Haushaltstheorie
- 6. Die Time-Availability-Theorie
- 6.1. Kinder
- 6.2. Einkommen
- 6.3. Gesundheit
- 6.4. Wohneigentum
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die schriftliche Ausarbeitung des Referates analysiert die Verteilung der Hausarbeit in Paarbeziehungen unter Einbezug verschiedener theoretischer Ansätze und untersucht den Zusammenhang zwischen Hausarbeitsverteilung, Erwartungen und Beziehungsqualität.
- Die Bedeutung verschiedener Theorien zur Erklärung der Hausarbeitsverteilung
- Die Rolle von Geschlecht, Bildung und Einkommen in der Hausarbeitsverteilung
- Der Einfluss von gesellschaftlichen Normen und Erwartungen auf die Hausarbeitsverteilung
- Die Auswirkungen der Hausarbeitsverteilung auf die Beziehungsqualität
- Der Vergleich verschiedener Studien und deren Ergebnisse zur Hausarbeitsverteilung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand und die verwendeten Studien vor, die sich auf die Verteilung der Hausarbeit in Paarbeziehungen konzentrieren. Anschließend werden die wichtigsten theoretischen Ansätze zur Erklärung der Hausarbeitsverteilung vorgestellt, darunter die Equity-Theorie, die Doing-Gender-Theorie, die Ressourcen-Theorie, die Austauschtheorie, die ökonomische Haushaltstheorie und die Time-Availability-Theorie. Die einzelnen Kapitel analysieren die Untersuchungsergebnisse der jeweiligen Studien und prüfen, ob diese die einzelnen Hypothesen bestätigen oder widerlegen. Dabei wird jeweils auf die unterschiedlichen Fragestellungen der Studien eingegangen.
Das Kapitel „Die Equity-Theorie“ befasst sich mit dem Beitragsprinzip der Fairness und untersucht, wie sich die Wahrnehmung von Fairness auf die Hausarbeitsverteilung auswirkt. Der Abschnitt „Die Doing-Gender-Theorie“ analysiert den Einfluss von Geschlecht und sozialen Normen auf die Arbeitsteilung in Paarbeziehungen. Die Ressourcen-Theorie wird im Kapitel „Ressourcen-Theorie“ erläutert, wobei die Rolle von Bildung und Einkommen für die Hausarbeitsverteilung beleuchtet wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Hausarbeitsverteilung, Beziehungsqualität, Equity-Theorie, Doing-Gender-Theorie, Ressourcen-Theorie, Time-Availability-Theorie, Geschlecht, Normen, Erwartungen, Bildung, Einkommen, Partnerschaftsverläufe, Familienorientierung und Arbeitsteilung.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Equity-Theorie zur Hausarbeit?
Sie besagt, dass Partner dann zufrieden sind, wenn sie die Verteilung der Hausarbeit als fair und ausgeglichen im Verhältnis zu ihren Beiträgen empfinden.
Was ist das „Doing-Gender“-Modell?
Dieses Modell erklärt die Arbeitsteilung dadurch, dass Paare durch die Übernahme geschlechtstypischer Aufgaben ihre Identität als Mann oder Frau bestätigen.
Wie beeinflussen Ressourcen wie Einkommen die Hausarbeit?
Nach der Ressourcen-Theorie muss derjenige Partner weniger im Haushalt tun, der über mehr externe Ressourcen (wie höheres Einkommen oder Bildung) verfügt.
Was bedeutet „Time-Availability“?
Diese Theorie geht davon aus, dass die Verteilung der Hausarbeit schlicht davon abhängt, welcher Partner mehr zeitliche Freiräume außerhalb der Erwerbsarbeit hat.
Hat die Hausarbeitsverteilung Einfluss auf die Beziehungsqualität?
Ja, verletzte Erwartungen bei der Verteilung der Hausarbeit können zu Unzufriedenheit und einer sinkenden Beziehungsqualität führen.
- Quote paper
- Marijke Lichte (Author), 2003, Die Aufteilung der Hausarbeit, verletzte Erwartungen und Beziehungsqualität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58207