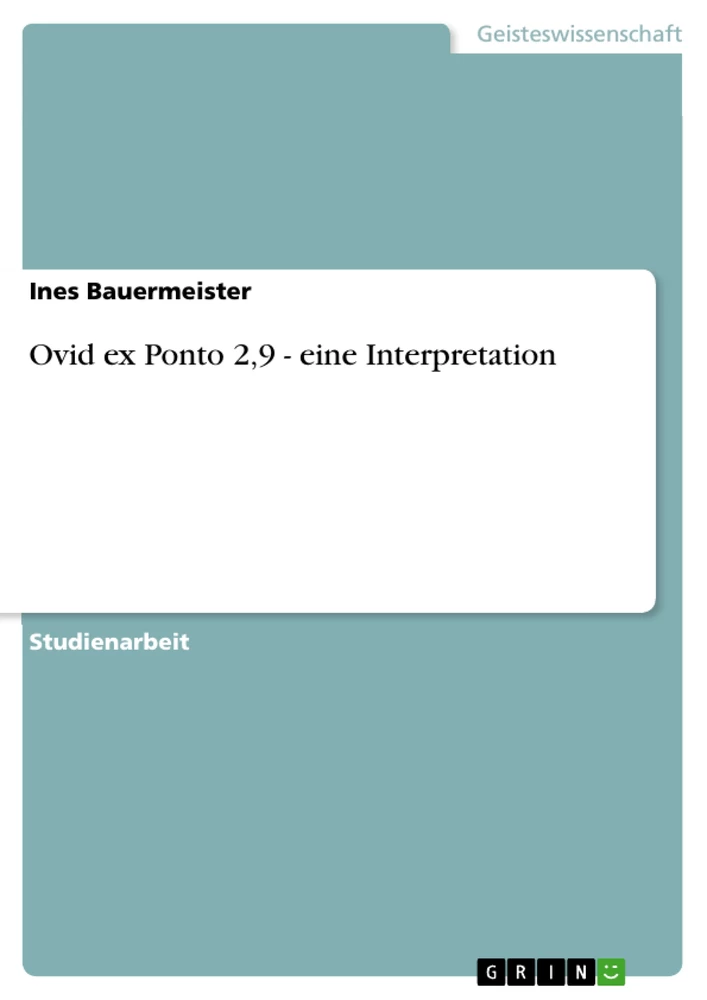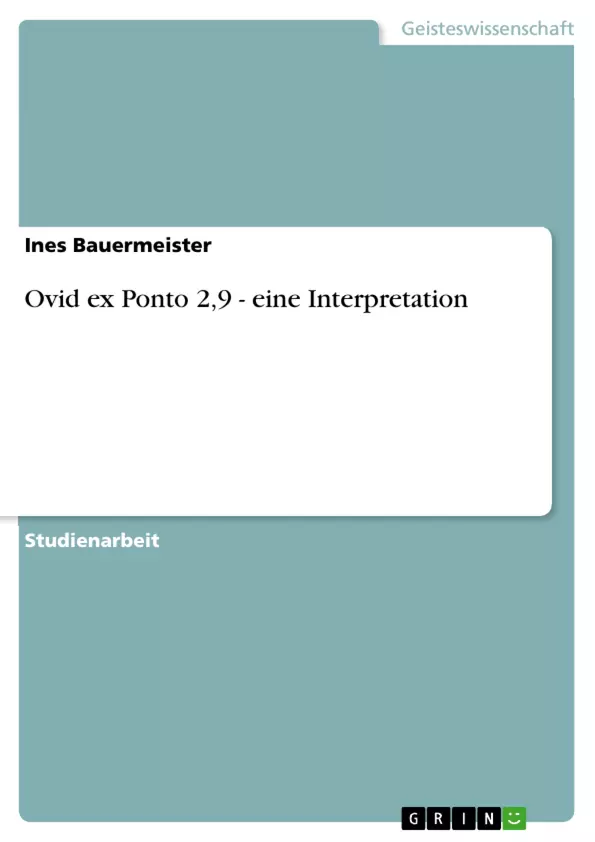Ovid wurde 8 n.Chr. von Kaiser Augustus durch ein kaiserliches Edikt nach Tomis am Schwarzen Meer verbannt. Während seines neunjährigen Exils veröffentlichte er neun Bücher mit knapp 100 Elegien, darunter die Epistulae ex Ponto in vier Büchern. Thema der Epistulae ex Ponto sind die schlechten Lebensverhältnisse in Tomis, die Schilderung der durch das Exil bedingten physischen und psychischen Leiden, der Appell an die Solidarität Verwandter und Freunde in Rom und schließlich Bitten an Augustus um eine Rückkehr beziehungsweise Milderung der Strafe durch die Erlaubnis zu einem Wechsel des Verbannungsortes.
Die Arbeit umfasst einen Überblick über die Forschung zu Ovids Verbannungsgedichten, eine Charakterisierung der Epistulae ex Ponto, eine Analyse der Gesamtstruktur des Gedichts sowie eine solche der Tropen, des Versbaus, der mythologischen Exempla und Kataloge sowie schließlich der Einstellung Ovids zum Verbannungsurteil und zu Augustus selbst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Exilliteratur Ovids
- Die Forschung zu den Verbannungsgedichten Ovids
- Die Epistulae ex Ponto
- Der Adressat des Briefes
- Inhalt und Gliederung
- Allgemeine Verpflichtungen von Königen gegenüber Bittstellern
- Die Einleitung
- Bitte um Asyl
- Hilfeleistung als königliche Pflicht
- Katalog I: Gottentsprossene Helfer
- Katalog II: Gnädige Götter
- Persönlicher Appell an Cotys
- Katalog III: Grausame Tyrannen
- Lobpreis auf die Dichtkunst des Cotys
- Ovids Rechtfertigung
- Der Schluss
- Stil und Gattung
- Der Versbau
- Die Verwendung der Mythologie
- Mythologischer Stoff in Ovids Exilpoesie
- Die Rolle der Mythologie im Brief an Cotys
- Der Einsatz von Katalogen
- Kataloge in den Tristien und Epistulae ex Ponto
- Die Kataloge in Brief 2,9
- Ovids Einstellung zum Verbannungsurteil und sein Verhältnis zu Augustus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Interpretation des Briefes Ovids „Ex Ponto 2,9“ zielt darauf ab, ein planvolles Vorgehen des Dichters bei der Komposition der Elegie aufzuzeigen und ein über die Ausübung von Dichtkunst hinausgehendes Motiv für ihre Abfassung zu finden.
- Die Analyse der Exilliteratur Ovids und die Rolle der Epistulae ex Ponto
- Die Interpretation des Inhalts und der Gliederung des Briefes an Cotys
- Die Untersuchung von Stil, Gattung und Versbau
- Die Bedeutung der Mythologie und der Einsatz von Katalogen in Ovids Exilpoesie
- Ovids Einstellung zum Verbannungsurteil und sein Verhältnis zu Augustus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung behandelt die Exilliteratur Ovids im Kontext der „Tristien“ und „Epistulae ex Ponto“ und beleuchtet die Forschungsgeschichte zu Ovids Verbannungsgedichten. Anschließend wird die Bedeutung der „Epistulae ex Ponto“ im Vergleich zu den „Tristien“ sowie die Rolle des Adressaten des Briefes, König Cotys, genauer betrachtet.
Das Kapitel „Inhalt und Gliederung“ analysiert die Struktur des Briefes und behandelt die darin enthaltenen Argumente und Appelle an Cotys.
In den folgenden Kapiteln werden Stil und Gattung, der Versbau, die Verwendung der Mythologie und der Einsatz von Katalogen in Ovids Exilpoesie im Allgemeinen sowie im Brief an Cotys im Speziellen betrachtet.
Das Kapitel „Ovids Einstellung zum Verbannungsurteil und sein Verhältnis zu Augustus“ untersucht die ambivalenten Gefühle des Dichters gegenüber dem Exil und seinem Verhältnis zu Augustus.
Schlüsselwörter
Exilliteratur, Ovid, Epistulae ex Ponto, Cotys, Elegie, Mythologie, Kataloge, Verbannung, Augustus, Dichtkunst, Interpretation, Forschungsgeschichte.
- Arbeit zitieren
- Ines Bauermeister (Autor:in), 2000, Ovid ex Ponto 2,9 - eine Interpretation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58217