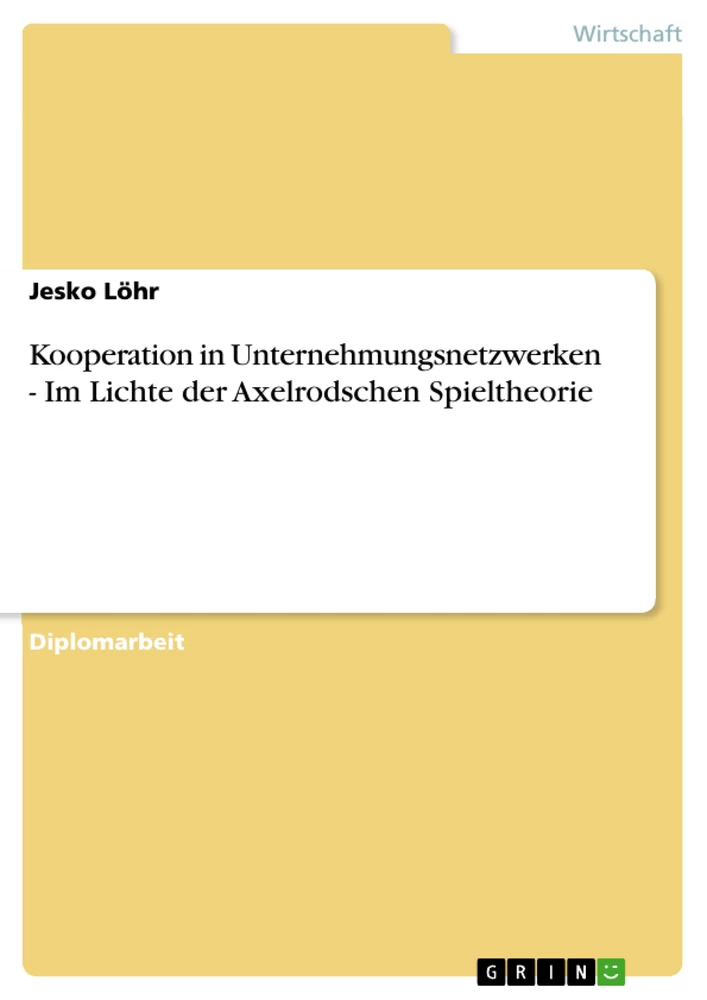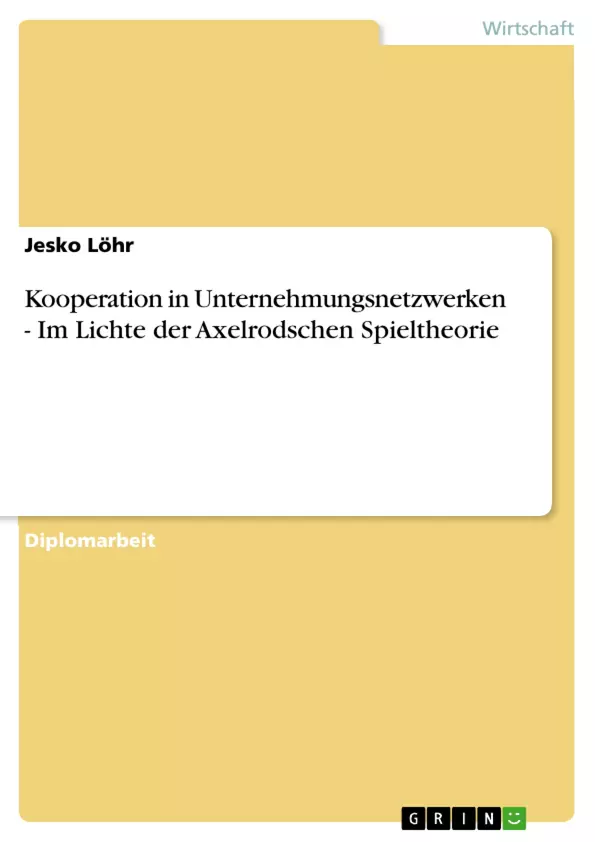1 Einleitung
Der Zusammenschluss von Unternehmen zu einem Unternehmensnetzwerk ist in der heutigen Zeit vielfach beobachtbar. Ein Grund für diese Entwicklung ist der durch die Globalisierung der Geschäftswelt entstehende Druck auf Unternehmen. Immer häufiger steht ein einzelnes Unternehmen vor dem Problem, dass es die vom Markt geforderte Leistung allein nicht erbringen kann. Eine Kooperation in Form eines Unternehmensnetzwerkes stellt eine Lösung dieses Problems dar. Die beteiligten Unternehmen ergänzen einander und profitieren von dieser Zusammenarbeit. Allerdings müssen sie Einblicke in bislang ausschließlich interne Bereiche gewähren und bereit sein, Abhängigkeiten einzugehen. Diese Risiken begleiten ein Unternehmensnetzwerk zwangsläufig. Die Spieltheorie bietet die Möglichkeit, solch eine Situation des gemeinsamen Handelns einschließlich der dadurch entstehenden Chancen und Risiken näher zu beleuchten. Die Betrachtung von Akteuren in interdependenten Entscheidungssituationen vermag zu erklären, wie und warum sich einzelne Unternehmen zu einem Unternehmensnetzwerk zusammenschließen.
{...}
In dieser Arbeit soll die Kooperationsform Unternehmensnetzwerk untersucht werden. Insbesondere wird der Frage nachgegangen, ob Axelrods Erkenntnisse aus der Spieltheorie sich übertragen lassen. Stehen auch Unternehmen wie Spieler im Gefangenendilemma vor der Wahl, zu kooperieren oder zu defektieren, und warum entscheiden sie sich in der Regel für die gegenseitige Kooperation?
Um den Realitätsbezug zu erhöhen, wird unter anderem die für Unternehmensnetzwerke typische Situation von n Spielern (n >2) betrachtet.
Zunächst wird der Begriff „Kooperation“ näher betrachtet (Kapitel 2), aufbauend darauf wird der Begriff „Unternehmensnetzwerk“ erläutert (Kapitel 3). Im vierten Kapitel wird die Argumentation Axelrods dargestellt, anschließend (Kapitel 5) wird die Anwendbarkeit seiner Empfehlungen auf Unternehmensnetzwerke überprüft. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit den Bereichen einer Kooperation, die nicht durch Axelrod erfasst werden (Macht, Kommunikation).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kooperation
- Begriffsbestimmung „Kooperation“
- Gründe für eine Kooperation
- Kooperation in der Praxis
- Risiken der Kooperation
- Allgemein
- Die fundamentale Transformation
- Die Hold-up Problematik
- Das Trittbrettfahrerproblem erster und zweiter Ordnung
- Unternehmensnetzwerke
- Begriffsbestimmung
- Klassifizierung von Unternehmensnetzwerken
- Zusammenhang zwischen Unternehmensnetzwerken und Kooperation
- Spieltheorie
- Allgemein
- Die Evolution der Kooperation
- Das Gefangenendilemma
- TIT FOR TAT
- Erweiterungen des Gefangenendilemmas
- Veränderung des Verhaltens
- Noise
- Das n-Personen-Gefangenendilemma
- Veränderung der Rahmenbedingungen
- Die Aussagen Axelrods bezogen auf Unternehmensnetzwerke
- Übertragbarkeit des Gefangenendilemmas auf Unternehmensnetzwerke
- Empfehlungen Axelrods
- Veränderung des Verhaltens
- Macht/Herrschaftsstrukturen
- Kommunikation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Kooperationsform des Unternehmensnetzwerks. Dabei wird untersucht, ob die Erkenntnisse des Spieltheoretikers Robert Axelrod aus dem Gefangenendilemma auf Unternehmensnetzwerke übertragbar sind. Insbesondere wird die Frage behandelt, ob Unternehmen wie Spieler im Gefangenendilemma vor der Wahl stehen, zu kooperieren oder zu defektieren, und warum sie sich in der Regel für die gegenseitige Kooperation entscheiden.
- Kooperation als strategisches Instrument im Kontext von Unternehmensnetzwerken
- Anwendung der Axelrodschen Spieltheorie auf Unternehmenskooperationen
- Analyse des Gefangenendilemmas und dessen Relevanz für Unternehmensnetzwerke
- Übertragung der Empfehlungen Axelrods auf die Praxis von Unternehmensnetzwerken
- Bewertung der Chancen und Risiken von Kooperation in Unternehmensnetzwerken
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs „Kooperation“ und analysiert die Gründe für die Entstehung von Kooperationen. Die Kapitel drei beleuchtet den Begriff „Unternehmensnetzwerk“ und klassifiziert verschiedene Arten von Netzwerken. Kapitel vier stellt die Argumentation von Axelrod dar, die sich auf die Evolution der Kooperation im Gefangenendilemma konzentriert. In Kapitel fünf werden die Empfehlungen Axelrods auf Unternehmensnetzwerke übertragen und deren Anwendbarkeit geprüft. Schließlich wird in Kapitel sechs die Bedeutung von Macht- und Herrschaftsstrukturen sowie Kommunikation für die erfolgreiche Zusammenarbeit in Netzwerken diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Kooperation, Unternehmensnetzwerke, Spieltheorie, Gefangenendilemma, TIT FOR TAT, Machtstrukturen, Kommunikation und die Übertragbarkeit von Spieltheoretischen Erkenntnissen auf die Praxis. Die Analyse konzentriert sich auf die Herausforderungen und Chancen der Zusammenarbeit in Unternehmensnetzwerken im Lichte der Axelrodschen Spieltheorie.
Häufig gestellte Fragen
Wie erklärt die Spieltheorie Unternehmenskooperationen?
Sie analysiert Entscheidungssituationen, in denen der Erfolg eines Unternehmens vom Verhalten der Partner abhängt (Interdependenz).
Was ist das Gefangenendilemma?
Ein Modell, das zeigt, warum zwei rationale Akteure nicht kooperieren, obwohl es in ihrem gemeinsamen Interesse läge.
Was bedeutet die Strategie „TIT FOR TAT“?
Eine Strategie von Robert Axelrod: Kooperiere im ersten Schritt und kopiere danach immer den vorherigen Zug des Partners.
Was ist das Trittbrettfahrerproblem?
Das Risiko, dass ein Partner von den Leistungen des Netzwerks profitiert, ohne selbst einen angemessenen Beitrag zu leisten.
Warum kooperieren Unternehmen trotz Risiken?
Weil durch Globalisierung und Technologiewandel einzelne Unternehmen oft nicht mehr allein die geforderte Leistung erbringen können.
- Quote paper
- Jesko Löhr (Author), 2005, Kooperation in Unternehmungsnetzwerken - Im Lichte der Axelrodschen Spieltheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58238