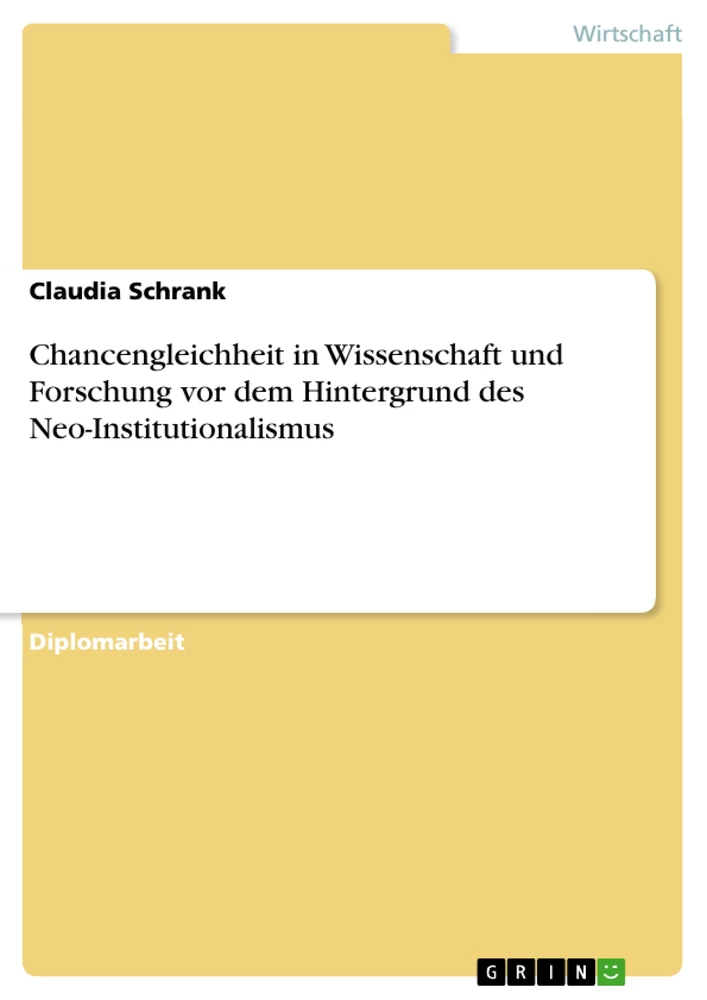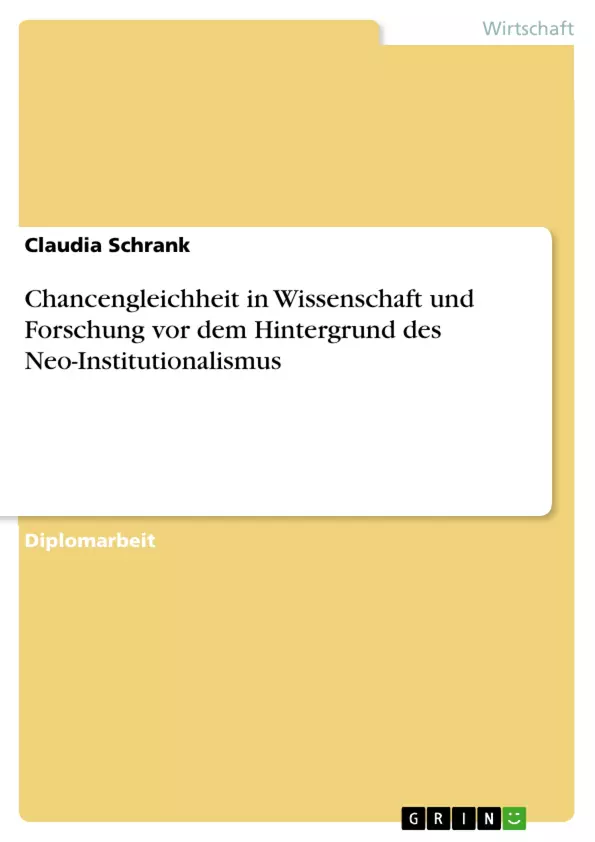Ziel dieser Arbeit ist es, mögliche Ursachen für die geringe Verbreitung von Frauen in den Leitungsebenen der Wissenschaft und Forschung zunächst allgemein und dann in Bezug auf das Forschungszentrum Karlsruhe darzustellen und zu diskutieren. Mit Hilfe des Neo-Institutionalismus soll dieses Problem zudem aus organisationstheoretischer Sicht durchleuchtet werden. Zunächst wird die theoretische Basis dieser Arbeit - der Neo-Institutionalismus - dargelegt, wobei hier der Schwerpunkt auf die grundlegenden Ansätze von Meyer, Rowan und DiMaggio, Powell gelegt wird. Diese makro-institutionalistischen Ansätze eigenen sich besonders für die Untersuchung der Chancengleichheit am Forschungszentrum Karlsruhe, weil sie den Einfluss gesellschaftlicher Erwartungen auf die Gestaltung von Organisationen analysieren. Im darauf folgenden Abschnitt wird der geschichtliche Hintergrund sowie das daraus resultierende Rollenverständnis und Frauenbild unserer Zeit vorgestellt. Dessen Darstellung ist wichtig, um zum Teil immer noch bestehende Rollenzuweisungen zu den Geschlechtern und die daraus resultierende Chancenungleichheit besser verstehen zu können. Auch das Verständnis und die Beurteilung des Status quo der Frauen in Wissenschaft und Forschung und die sich daraus ergebenden Spannungsfelder werden dadurch erleichtert. Ein weiterer großer Einflussfaktor auf das Thema Chancengleichheit sind die gesetzlichen Regelungen, deren Ziel die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen ist. Die wichtigsten internationalen und nationalen Regelungen werden im Abschnitt 4.1 dargelegt. Das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern wird vor allem seit der Implementierung des Konzepts des Gender Mainstreaming in alle Politikbereiche verstärkt vorangetrieben. Deshalb wir es auch in dieser Arbeit näher betrachtet. Zur Umsetzung dieses Konzepts dienen u. a. auch das Total-E-Quality-Prädikat sowie die Förderung familienfreundlicher Maßnahmen. Als Abschluss für die organisationsübergreifenden Maßnahmen wird der Sinn und Zweck von Frauennetzwerken dargestellt. Auf der Ebene einzelner Organisationen werden mögliche Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit beschrieben. Hierbei wird im Detail auf das Konzept des Mentoring, auf Programme zur speziellen Förderung weiblicher Mitarbeiter und Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf eingegangen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Das Phänomen Chancengleichheit
- Warum eine Untersuchung zu diesem Thema?
- Ziel der Untersuchung
- Aufbau der Diplomarbeit
- Der Neo-Institutionalismus
- Überblick
- Der Ansatz von John W. Meyer und Brian Rowan
- Der Ansatz von Paul J. DiMaggio und Walter W. Powell
- Kritische Würdigung
- Die Situation der Frau im 21. Jahrhundert
- Das Frauenbild im 21. Jahrhundert und dessen historische Entwicklung
- Frauen in Wissenschaft und Forschung
- Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit
- Rechtliche Aspekte
- Organisationsübergreifende Maßnahmen
- Gender Mainstreaming
- Das TOTAL E-QUALITY-Prädikat
- Förderung familienfreundlicher Maßnahmen
- Frauennetzwerke
- Maßnahmen von Organisationen
- Mentoring
- Gezielte Förderung weiblicher Mitarbeiter
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Chancengleichheit beim Forschungszentrum Karlsruhe GmbH
- Das Forschungszentrum Karlsruhe als Mitglieder der Helmholtz-Gemeinschaft
- Personalstruktur nach Geschlecht und hierarchischer Stellung
- Einbettung der Chancengleichheit in das Leitbild des Instituts
- Maßnahmen zur Förderung von Chancengleichheit beim FZK
- Gleichstellungsbeauftragte
- Betriebsvereinbarungen
- Das TOTAL E-QUALITY-Prädikat
- Förderprogramme für weiblichen Führungsnachwuchs
- Maßnahmen zur Vereinbarkeit Beruf und Familie
- Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils der Studentinnen in Studiengängen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind
- Frauennetzwerke
- Vorgehen bei der empirischen Untersuchung
- Fragestellung und Zielsetzung
- Methodik der Vorgehensweise
- Ablauf der Interviews
- Auswertung der Interviews
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht das Phänomen der Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung. Ziel ist es, die Situation der Frau im 21. Jahrhundert im Kontext der akademischen Laufbahn zu analysieren und Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit im Kontext des Neo-Institutionalismus zu erörtern.
- Die Bedeutung des Neo-Institutionalismus für die Analyse von Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung
- Die historische Entwicklung des Frauenbildes im 21. Jahrhundert und seine Auswirkungen auf die akademische Laufbahn
- Die Situation der Frauen in Wissenschaft und Forschung und die Herausforderungen, die sie bewältigen müssen
- Die Analyse von Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit auf verschiedenen Ebenen
- Die Untersuchung der Chancengleichheitspolitik am Forschungszentrum Karlsruhe als Beispiel
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt das Phänomen der Chancengleichheit und erläutert die Relevanz des Themas. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Neo-Institutionalismus und seinen verschiedenen Ansätzen. Kapitel drei beleuchtet die Situation der Frau im 21. Jahrhundert und analysiert das Frauenbild und die Herausforderungen, die Frauen in Wissenschaft und Forschung bewältigen müssen. Kapitel vier gibt einen Überblick über verschiedene Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit auf nationaler und organisationaler Ebene. Kapitel fünf untersucht die Chancengleichheitspolitik am Forschungszentrum Karlsruhe.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Chancengleichheit, Neo-Institutionalismus, Frauen in Wissenschaft und Forschung, Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit, Gender Mainstreaming, TOTAL E-QUALITY-Prädikat, Frauennetzwerke und dem Forschungszentrum Karlsruhe. Darüber hinaus werden Themen wie die historische Entwicklung des Frauenbildes, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Relevanz von Mentoring-Programmen behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Frauen in Führungspositionen der Wissenschaft unterrepräsentiert?
Die Arbeit untersucht Ursachen wie veraltete Rollenbilder, strukturelle Barrieren und den Einfluss gesellschaftlicher Erwartungen auf Organisationen.
Was erklärt der Neo-Institutionalismus im Kontext der Chancengleichheit?
Er analysiert, wie Organisationen gesellschaftliche Erwartungen an Gleichstellung übernehmen, um Legitimität zu erlangen, auch wenn die praktische Umsetzung intern variieren kann.
Was ist Gender Mainstreaming?
Gender Mainstreaming ist ein Konzept, bei dem die Auswirkungen jeder geplanten Maßnahme auf Frauen und Männer in allen Politik- und Organisationsbereichen berücksichtigt werden.
Welche Maßnahmen fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
Dazu gehören flexible Arbeitszeitmodelle, Mentoring-Programme für Frauen und die Zertifizierung durch das TOTAL E-QUALITY-Prädikat.
Wie setzt das Forschungszentrum Karlsruhe Chancengleichheit um?
Durch Gleichstellungsbeauftragte, spezielle Förderprogramme für weiblichen Führungsnachwuchs und gezielte Maßnahmen zur Erhöhung des Studentinnenanteils in MINT-Fächern.
- Arbeit zitieren
- Diplom-Kauffrau Claudia Schrank (Autor:in), 2005, Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung vor dem Hintergrund des Neo-Institutionalismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58255