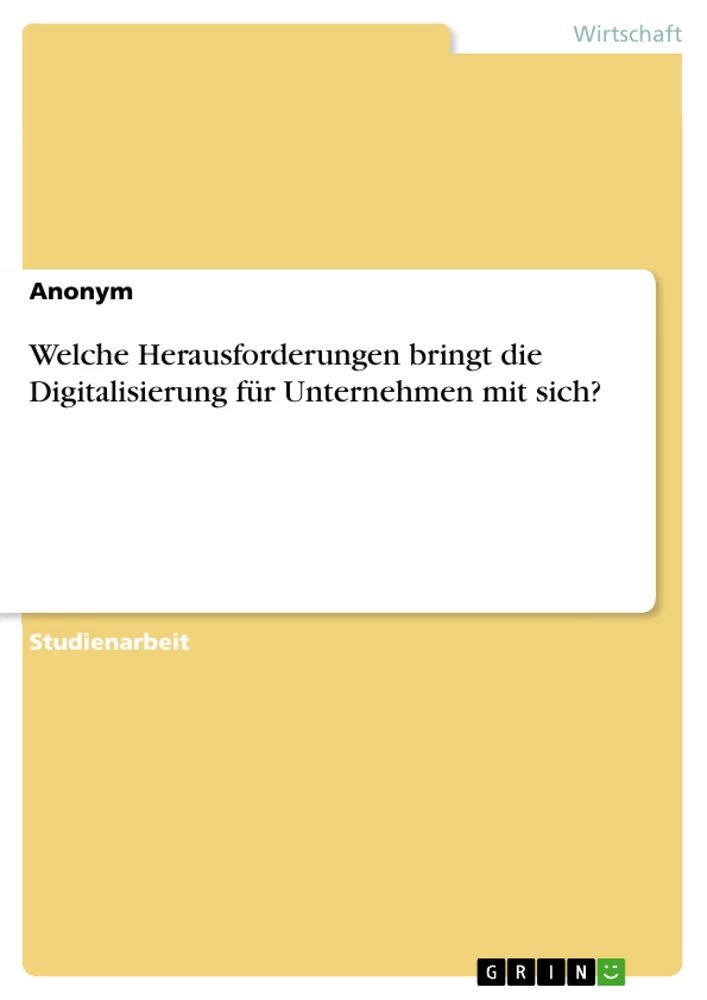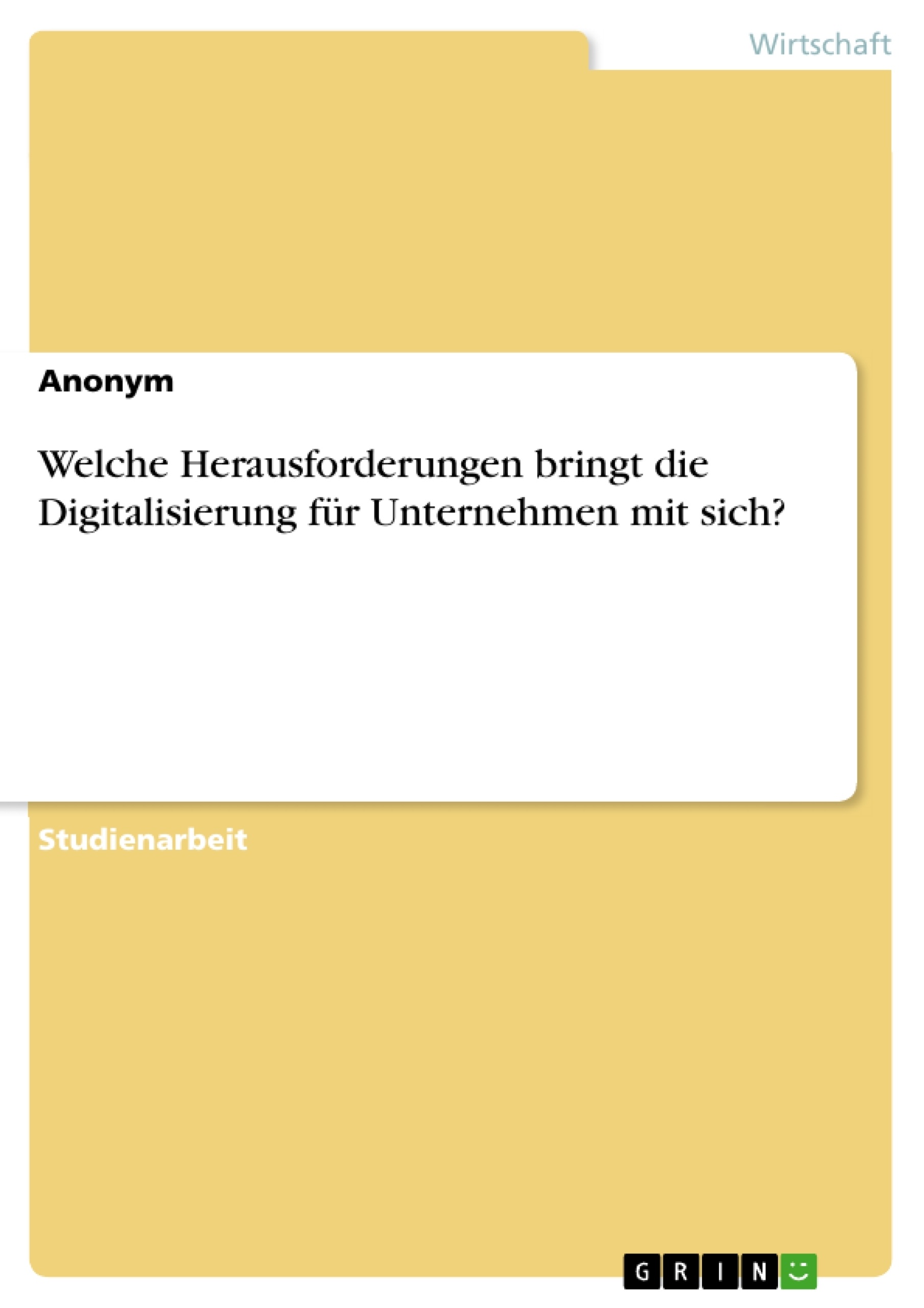Ziel der vorliegenden Seminararbeit ist es, die Bedeutung der Digitalisierung darzulegen und anhand eines Experteninterviews zu verdeutlichen, welche Herausforderungen diese für Unternehmen mit sich bringt. Hierbei werden zunächst die Begriffe des Unternehmens und der Digitalisierung definiert und auf den aktuellen Forschungsstand eingegangen. Im Anschluss hieran wird die vorliegende angewandte Methode vorgestellt und dabei insbesondere die Wahl der Erhebungstechnik und des Interviewpartners begründet. Mit Hilfe des zuvor erstellten Leitfadens wurde sodann das Interview durchgeführt und 9 Kategorien hieraus definiert. Anschließend erfolgt eine Auswertung des Interviews und die Formulierung von Hypothesen aus den gewonnenen Erkenntnissen. Letztendlich werden anhand eines Fazits die Herausforderungen der Digitalisierung für Unternehmen abschließend bewertet.
Mit der Digitalisierung gehen Veränderungen in der Gesellschaft, Wirtschaft sowie Politik einher. Die Digitalisierung betrifft demnach uns alle. Sie spiegelt sich insbesondere in der Verbreitung von Smartphones und Tablets wider und verändert nicht nur das Kommunikationsverhalten, sondern auch das Konsumverhalten der Menschen. Mobile Geräte werden längst nicht mehr zur reinen Informationsbeschaffung genutzt, sondern dienen zum Einkauf und Vergleich sämtlicher Güter und Dienstleistungen. Für Unternehmen zeigen sich daher vor allem Herausforderungen in den Bereichen Informations-, Kommunikations- und Transaktionsprozesse. Durch die Digitalisierung entsteht darüber hinaus die Notwendigkeit für Unternehmen, immer schneller auf Veränderungen zu reagieren, was gerade für traditionelle Unternehmen ein Problem darstellt, die langwierige Prozesse in der Entwicklung und Anpassung von Produkten und Dienstleistungen aufweisen. Dennoch ergibt sich bei der Umsetzung der Digitalisierung aber auch die Chance, individuell auf Kundenwünsche einzugehen und somit einen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Wichtig wird es demnach in Zukunft sein, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten und nicht nur von ihm mitgerissen zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Definitionen
- 2.1 Unternehmen
- 2.2 Digitalisierung
- 3. Aktueller Forschungsstand
- 4. Methode
- 4.1 Wahl der Erhebungstechnik
- 4.2 Auswahl des Interviewpartners
- 4.3 Leitfadenerstellung und Interviewdurchführung
- 4.4 Vorgehensweise bei der Auswertung der Messergebnisse
- 4.5 Feldzugang und Reflexion der Erhebungsmethode
- 5. Auswertung
- 5.1 Vorstellung des Unternehmens
- 5.2 Kategorie Mitarbeiteranzahl
- 5.3 Kategorie Abläufe
- 5.4 Kategorie Ziele
- 5.5 Kategorie Digitalisierungsmaßnahmen
- 5.6 Kategorie Anforderungen
- 5.7 Kategorie Marktentwicklung
- 5.8 Kategorie Auswirkungen
- 5.9 Kategorie Zufriedenheit
- 5.10 Kategorie Zukunft
- 5.11 Zwischenfazit
- 6. Diskussion der Ergebnisse
- 6.1 Grenzen und Unschärfen der eigenen Forschungsarbeit
- 6.2 Ableitung quantifizierbarer Hypothesen
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Seminararbeit ist die Darstellung der Bedeutung der Digitalisierung und die Erläuterung der damit verbundenen Herausforderungen für Unternehmen anhand eines Experteninterviews. Die Arbeit definiert die Begriffe „Unternehmen“ und „Digitalisierung“, beleuchtet den aktuellen Forschungsstand und beschreibt die angewandte Methode, inklusive der Auswahl der Erhebungstechnik und des Interviewpartners. Die Auswertung des Interviews führt zur Definition von Kategorien und zur Formulierung von Hypothesen. Abschließend werden die Herausforderungen der Digitalisierung für Unternehmen bewertet.
- Definition und Bedeutung von Digitalisierung für Unternehmen
- Herausforderungen der Digitalisierung für Unternehmensprozesse
- Analyse der Auswirkungen der Digitalisierung auf Unternehmensziele
- Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit im Kontext der Digitalisierung
- Formulierung von Hypothesen basierend auf den Interviewergebnissen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einführung stellt die Relevanz der Digitalisierung für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik heraus und betont ihren Einfluss auf Kommunikations- und Konsumverhalten. Sie hebt die Herausforderungen für Unternehmen im Bereich der Informations-, Kommunikations- und Transaktionsprozesse hervor und benennt die Notwendigkeit schneller Reaktionen auf Veränderungen. Das Hauptziel der Arbeit wird definiert: die Bedeutung der Digitalisierung und die damit verbundenen Herausforderungen für Unternehmen zu untersuchen, basierend auf einem Experteninterview. Die Methodik der Arbeit wird kurz skizziert.
2. Definitionen: Dieses Kapitel klärt die Begriffe „Unternehmen“ und „Digitalisierung“. „Unternehmen“ wird als wirtschaftlich-finanzielle und rechtliche Einheit definiert, die sich zur Verfolgung von Zielen bedient. Die drei konstitutiven Merkmale nach Gutenberg (Privateigentum, Autonomieprinzip, Gewinnstreben) werden erläutert. Die Digitalisierung wird als strategisch orientierte Transformation von Prozessen, Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen unter Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien beschrieben, mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung.
3. Aktueller Forschungsstand: Dieses Kapitel untersucht den Grund für den Anschluss von Unternehmen an die Digitalisierung. Der zentrale Punkt ist die Notwendigkeit der Digitalisierung zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit. Der Abschnitt verweist auf weiterführende Literatur, die den aktuellen Forschungsstand vertieft.
4. Methode: Der Methodenteil beschreibt die gewählte Erhebungstechnik (Experteninterview), die Auswahl des Interviewpartners, die Leitfadenerstellung und -durchführung, die Auswertung der Ergebnisse und den Feldzugang. Die Reflexion der gewählten Methode wird ebenfalls angesprochen.
5. Auswertung: Die Auswertung des Experteninterviews wird in verschiedenen Kategorien präsentiert (Mitarbeiteranzahl, Abläufe, Ziele, Digitalisierungsmaßnahmen, Anforderungen, Marktentwicklung, Auswirkungen, Zufriedenheit, Zukunft). Die Ergebnisse der einzelnen Kategorien werden analysiert und bilden die Grundlage für die folgenden Kapitel.
6. Diskussion der Ergebnisse: Die Diskussion der Ergebnisse umfasst die Grenzen und Unschärfen der eigenen Forschungsarbeit und die Ableitung quantifizierbarer Hypothesen aus den gewonnenen Erkenntnissen. Hier werden die Stärken und Schwächen der Studie reflektiert und der Ausblick auf weiterführende Forschung gegeben.
Schlüsselwörter
Digitalisierung, Unternehmen, Herausforderungen, Experteninterview, Wettbewerbsfähigkeit, Geschäftsmodelle, Informations- und Kommunikationstechnologien, Transformationsprozesse, Hypothesen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Digitalisierung und Unternehmen
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Bedeutung der Digitalisierung und die damit verbundenen Herausforderungen für Unternehmen. Sie basiert auf einem Experteninterview und umfasst eine Einleitung, Definitionen zentraler Begriffe (Unternehmen und Digitalisierung), einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand, die Beschreibung der angewandten Methode (Experteninterview), die Auswertung des Interviews, eine Diskussion der Ergebnisse und ein Fazit. Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel, die jeweils einzelne Aspekte der Thematik behandeln.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: Definition und Bedeutung von Digitalisierung für Unternehmen, Herausforderungen der Digitalisierung für Unternehmensprozesse, Analyse der Auswirkungen der Digitalisierung auf Unternehmensziele, Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit im Kontext der Digitalisierung und die Formulierung von Hypothesen basierend auf den Interviewergebnissen. Die Auswertung des Interviews wird in Kategorien wie Mitarbeiteranzahl, Abläufe, Ziele, Digitalisierungsmaßnahmen, Anforderungen, Marktentwicklung, Auswirkungen, Zufriedenheit und Zukunftsaussichten unterteilt.
Welche Methode wurde in der Seminararbeit angewendet?
Die Hauptmethode der Seminararbeit ist ein Experteninterview. Der Methodenteil beschreibt detailliert die Auswahl des Interviewpartners, die Erstellung und Durchführung des Leitfadens, die Auswertung der Ergebnisse und den Zugang zum Forschungsfeld. Die Reflexion der gewählten Methode und ihrer Limitationen wird ebenfalls angesprochen.
Welche Ergebnisse wurden in der Seminararbeit erzielt?
Die Auswertung des Experteninterviews liefert Ergebnisse in verschiedenen Kategorien (siehe oben). Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für die Diskussion der Ergebnisse, die Grenzen und Unschärfen der eigenen Forschungsarbeit aufzeigt und quantifizierbare Hypothesen ableitet. Die konkreten Ergebnisse werden im Kapitel 5 detailliert dargestellt.
Welche Definitionen von "Unternehmen" und "Digitalisierung" werden verwendet?
„Unternehmen“ wird als wirtschaftlich-finanzielle und rechtliche Einheit definiert, die sich zur Verfolgung von Zielen bedient. Die drei konstitutiven Merkmale nach Gutenberg (Privateigentum, Autonomieprinzip, Gewinnstreben) werden erläutert. Die Digitalisierung wird als strategisch orientierte Transformation von Prozessen, Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen unter Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien beschrieben, mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Digitalisierung, Unternehmen, Herausforderungen, Experteninterview, Wettbewerbsfähigkeit, Geschäftsmodelle, Informations- und Kommunikationstechnologien, Transformationsprozesse und Hypothesen.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: 1. Einführung, 2. Definitionen, 3. Aktueller Forschungsstand, 4. Methode, 5. Auswertung, 6. Diskussion der Ergebnisse und 7. Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik und baut auf den vorherigen Kapiteln auf.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Seminararbeit?
Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse der Arbeit zusammen und bewertet die Bedeutung der Digitalisierung und ihre Herausforderungen für Unternehmen. Es enthält auch einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und -möglichkeiten.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Welche Herausforderungen bringt die Digitalisierung für Unternehmen mit sich?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/583474