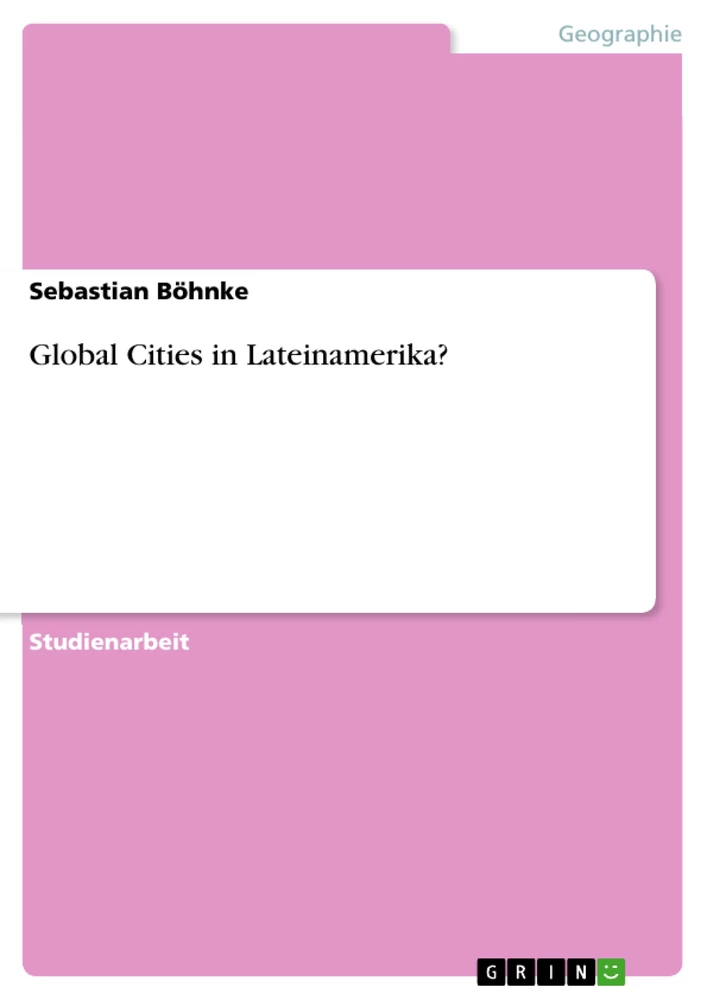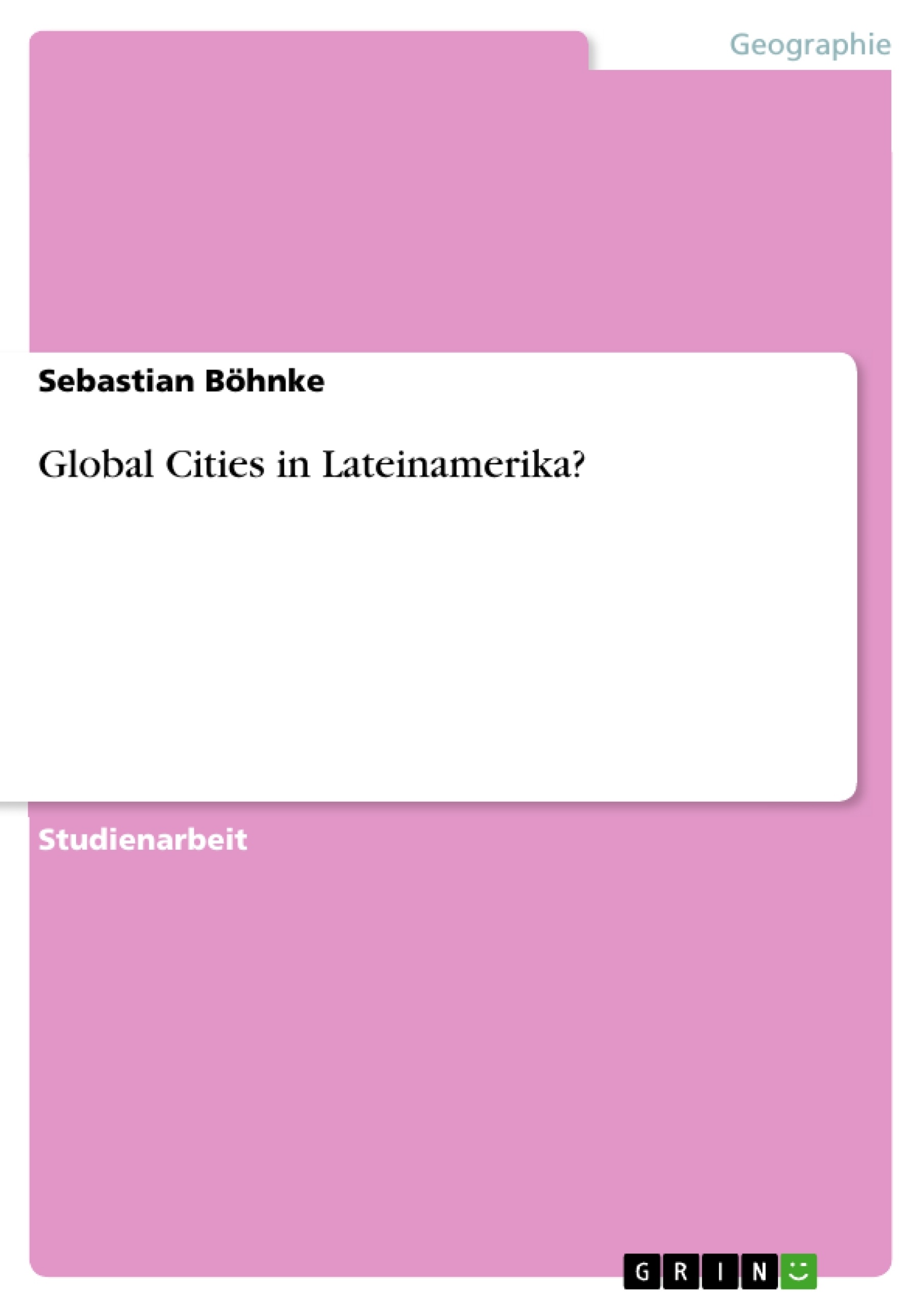Bevor ich die Frage nach Global Cities in Lateinamerika behandeln werde, möchte ich zuerst den Begriff der Global City, wie er nach seinen „Begründern“ S. Sassen und J. Friedmann definiert wurde, erörtern. Die Global City als Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung wurde erstmals in den 1980er Jahren von J. Friedmann behandelt, da die früheren Werke von Hall (1966) et al. noch keine Theorie der Global City im heutigen Sinne thematisierten, sondern sich mit World Cities etc. und demnach mit einem völlig anderen Kriterienkatalog befassten. Als Definition für eine Global City lassen sich hier die „Auswahlkriterien für Global Cities“ von J. Friedmann1anführen: Wichtiges Finanzzentrum, Headquarters von transnationalen Unternehmen, internationale Institutionen√rapider Anstieg des Dienstleistungssektors√wichtiges Produktionszentrum, wichtiger Transportknotenpunkt, Bevölkerungsgröße. Erweitert wird diese Definition durch S. Sassens „Neue Funktionsweisen von Global Cities“: hoch konzentrierte Kommandozentralen in der Organisation der Weltwirtschaft, Schlüsselstandorte für Finanzwesen und hoch spezialisierte Dienstleistungen, Orte der Produktion einschliesslich Innovationen in führenden Industriezweigen, Märkte für produzierte Güter und Innovationen Nach dieser Hypothese ist eine Global City also ein urbanes Zentrum globaler Bedeutung, das sich durch eine herausragende wirtschaftliche und administrative Stellung sowohl im nationalen als auch im globalen Kontext definiert. Für die Klassifikation von Global Cities werden dementsprechend verschiedenste Daten herangezogen, wie etwa die Summe der ausländischen Direktinvestitionen (ADIs), die Anzahl an Direktflügen in Triadenländer (Europa - Nordamerika - Japan), die Präsenz ausländischer Banken oder auch die Ausprägung des FIRE - Sektors (Finance - Insurance - Real Estate / Finanzdienstleistungen - Versicherungen - Immobilien). Wichtiger für die Einstufung einer Global City ist jedoch vor allem ihre Vernetzung mit anderen Global Cities bzw. ihre Rolle im globalen Wirtschaftssystem.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Theorie der „Global City“
- 1.1 Definition nach S. Sassen und J. Friedman...
- 1.2 Kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Global City...
- 2. Untersuchung auf Merkmale einer Global City am Beispiel einer lateinamerikanischen Stadt
- 2.1 Mexiko City - Global City oder US-orientierte Primate City?...
- 3. Einordnung der Städte Lateinamerikas in das Netz der Global Cities
- 3.1 Mexiko City, Sao Paulo, Buenos Aires - globale Peripherie oder die Zentren von morgen? Ein Fazit...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept der „Global City“ im Kontext Lateinamerikas. Sie zielt darauf ab, die Definition und Relevanz des Begriffs im Hinblick auf lateinamerikanische Städte zu beleuchten und kritisch zu hinterfragen.
- Definition und Entwicklung des Begriffs „Global City“
- Analyse von Merkmalen der Global City am Beispiel einer lateinamerikanischen Stadt (Mexiko City)
- Einordnung lateinamerikanischer Städte im Netzwerk der Global Cities
- Potenzielle Entwicklungsperspektiven lateinamerikanischer Städte im globalen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Theorie der „Global City“
Dieses Kapitel erläutert die Entstehung des Konzepts der Global City, indem es auf die Definitionen von S. Sassen und J. Friedmann eingeht. Es werden die wichtigsten Kriterien und Merkmale einer Global City vorgestellt, wie z.B. die Bedeutung als Finanzzentrum, Headquarters von transnationalen Unternehmen und wichtiges Produktionszentrum.
1.2 Kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Global City
Dieser Abschnitt beleuchtet die kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Global City, insbesondere die Debatten um die Relevanz der gewählten Kriterien und die Einseitigkeit der ursprünglichen Forschung. Es wird die Entwicklung des Begriffs hin zu einem Netzwerk von Städten dargestellt, die sich im Zuge der Globalisierung wandeln und weiterentwickeln.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe „Global City“, „Lateinamerika“, „Stadtentwicklung“, „Globalisierung“, „Wirtschaftsentwicklung“, „Finanzwesen“, „Dienstleistungssektor“, „transnationale Unternehmen“, „Netzwerk von Städten“, „Entwicklungsperspektiven“.
Häufig gestellte Fragen
Was definiert eine 'Global City'?
Nach Sassen und Friedmann ist eine Global City ein Finanzzentrum, Sitz transnationaler Unternehmen und ein Knotenpunkt für hochspezialisierte Dienstleistungen in der Weltwirtschaft.
Ist Mexiko-Stadt eine Global City?
Mexiko-Stadt weist viele Merkmale auf, wird jedoch oft auch als US-orientierte 'Primate City' analysiert, deren globale Vernetzung spezifischen regionalen Dynamiken unterliegt.
Welche lateinamerikanischen Städte spielen eine globale Rolle?
Neben Mexiko-Stadt werden vor allem São Paulo und Buenos Aires als wichtige Zentren im globalen Städtenetzwerk betrachtet.
Welche Kriterien werden für die Klassifikation genutzt?
Kriterien sind unter anderem ausländische Direktinvestitionen (ADIs), die Anzahl von Direktflügen in Triadenländer und die Ausprägung des FIRE-Sektors (Finance, Insurance, Real Estate).
Was bedeutet 'globale Peripherie' im Kontext von Städten?
Es beschreibt Städte, die zwar groß sind, aber im globalen Wirtschaftssystem eher eine abhängige oder weniger zentrale Rolle spielen als Zentren wie New York oder London.
- Quote paper
- Sebastian Böhnke (Author), 2006, Global Cities in Lateinamerika?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58366