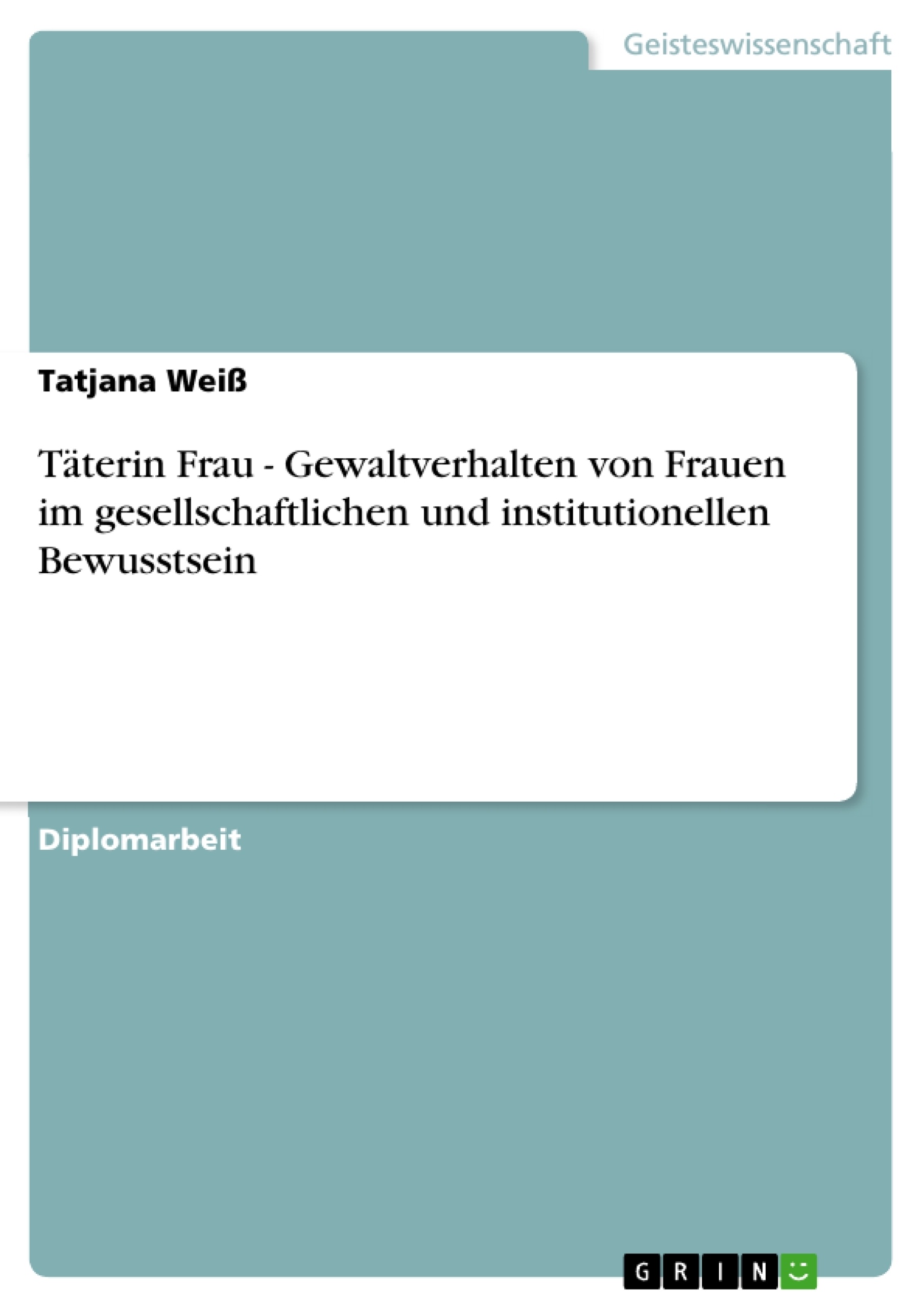Die Worte Gewalt und Frauen lösen in erster Linie die Assoziation der Frau als Gewaltopfer aus. Die Frau als Täterin ist meist nur im Zusammenhang mit Tötungsdelikten in den Chronikteilen der Zeitungen zu finden, und auch hier neigt die Berichterstattung tendenziell dazu, diese Taten als außerordentliche Einzelphänomene darzustellen oder diese dem Bereich der Pathologie zu zuordnen. Gewalt von Frauen ist auch noch im 21. Jahrhundert ein Tabu, es scheint als wolle die Gesellschaft am Bild der Frau als fürsorgendes und sanftes Wesen festhalten, selbst feministische Gruppierungen verweigern den Blick auf Aggressionsverhalten von Frauen und ziehen es vor die Frau in ihrer Rolle als Opfer patriarchaler Gewalt und Systeme zu determinieren. Gewalt wird vorwiegend vom männlichen Aspekt betrachtet. Dies wird dahingehend argumentiert, dass Männer häufiger gewalttätig sind und durch ihren höheren Status in der Gesellschaft über mehr Macht verfügen. Durch die Kombination von Gewalt und Machtungleichgewicht ist der männliche Bedrohungsaspekt ein höherer und daher Gewalt von Frauen mit Gewalt von Männern nicht zu vergleichen. Dieser Ansatz verknüpft Gewalt mit Gesellschaftsstrukturen und setzt durch diese Verknüpfung, meines Erachtens, auf einer zu hohen Ebene des Gewaltphänomens an. In dieser Diplomarbeit soll Gewalt, auf der Grundlage des Gewaltverbots betrachtet werden. Gewalt als ein Verhalten, das den gesellschaftlichen Regeln widerstrebt. Das Gewaltverbot besteht in seiner Gültigkeit für beide Geschlechter im gleichen Maße und muss für seinen Bestand von beiden Geschlechtern als gesellschaftlicher Wert getragen werden. Um die Einhaltung dieses Verbots zu gewährleisten oder dahingehend zu intervenieren, müssen beide Geschlechter in gleicher Weise beobachtet und ihr Gewaltverhalten erhoben werden. Daher werden am Beginn die unterschiedlichen Definitionen aus allgemeiner, psychologischer, soziologischer und pädagogischer Sicht vorgestellt, sowie eine Klärung des Gewaltbegriffs, der dieser Arbeit zu Grunde liegt, vorgenommen. Anschließend soll geklärt werden, warum von Frauen verübte Gewalt nicht bis kaum wahrgenommen wird. Dafür wird der Begriff des Tabus herangezogen und erläutert wie es zum Bestehen dieses Tabus kommt. Der Bestand des Tabus wird von den soziologischen Geschlechterrollen abgeleitet. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I. Theoretischer Teil
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen von Gewalt...
- 2.1. Allgemeine Definition.
- 2.2. Psychologischer Gewaltbegriff..
- 2.3. Soziologischer Gewaltbegriff.
- 2.4. Pädagogischer Gewaltbegriff..
- 2.5. Der dieser Diplomarbeit zugrunde liegende Gewaltbegriff.
- 3. Gewalttätige Frauen - ein Tabu.……………………………..
- 3.1. Das Tabu.
- 3.2. Die weibliche Geschlechterrolle und ihre soziologische Bedeutung
- 3.3. Gewalttätige Frau im Zusammenhang von sozialer Rolle und Hierarchie
- 3.4. Faktoren zur Aufrechterhaltung des Tabus..
- 3.5. Über die Sinnhaftigkeit des Tabubruchs..
- 4. Historischer Abriss des Gewaltverständnisses.
- 5. Theorien zur Ursache von Gewalt...
- 5.1. Aggressionstriebmodelle
- 5.2. Frustrations-Aggressions-Hypothese.
- 5.3. Katharsishypothese.
- 5.4. Die Lerntheorien und ihre familiensoziologischen Erweiterungen.
- 5.5. Stresstheoretischer Ansatz.
- 5.6. Konflikttheorie..
- 5.7. Theorie der Subkultur von Gewalt.
- 5.8. Ressourcentheoretischer Ansätze
- 5.9. Austausch und Kontrolltheorie.
- 5.10. Symbolisch-interaktionistische Ansätze.
- 5.11. Soziostrukturelle Ansätze.
- 6. Formen personaler Gewalt.
- 6.1. Physische Gewalt..
- 6.2. Psychische Gewalt.
- 6.3. Sexuelle Gewalt.
- 7. Forschungen zum Thema Gewalt in der Familie betrachtet unter dem Aspekt der
Frau als Täterin ……………………….……………
- 7.1. Gewalt von Frauen gegen Minderjährig.
- 7.1.1. Physische Gewalt von Frauen gegen Minderjährige..
- 7.1.2. Psychische Gewalt von Frauen gegen Minderjährige..
- 7.1.3. Sexuelle Gewalt von Frauen gegen Minderjährige..
- 7.1.4. Zusammenfassung.
- 7.2. Gewalt von Frauen gegen Intimpartner .
- 7.2.1. Physische Gewalt von Frauen gegen Männer.
- 7.2.2. Psychische Gewalt von Frauen gegen Männer
- 7.2.3. Sexuelle Gewalt von Frauen gegen Männer
- 7.3. Gewalt gegen alte Menschen im sozialen Nahraum
- 7.4. Gewalt von Frauen im öffentlichen Raum.
- 7.4.1. Frauenkriminalität…...
- 7.4.2. Gewaltausübung am Arbeitsplatz.
- 7.4.2.2. Mobbing...
- 7.4.3. Menschenhandel
- 7.4.4. Gewalttätige Mädchen und junger Erwachsene.
- 7.1. Gewalt von Frauen gegen Minderjährig.
- 8. Gewaltverhalten von Frauen
- 8.1. Erkenntnisse zu frauenspezifischen Gewaltverhalten...
- 8.2. Eigener Ansatz zur weiblichen Gewalt..
- 9. Gewalttätige Frauen, eine Aufgabe für die Sozialarbeit?
- 9.2. Sozialarbeiterische Hilfsangebot.
- 9.3. Mögliche Interventionsangebote...
- 10. Zusammenfassung.
- II. Empirischer Teil..........\
- 1. Die Methode des Fragebogens.
- 2. Thesen und Hypothesen.....
- 2.1. Hypothesen zum allgemeinen Fragebogen.
- 2.1.1. Hypothesen zum Zusatzfragebogen für Frauen
- 2.2. Hypothesen zum Expertenfragebogen.
- 2.1. Hypothesen zum allgemeinen Fragebogen.
- 3. Auswertung
- 3.1. Allgemeiner Fragebogen
- 3.1.1. Konstruktion
- 3.1.2. Kritik des Fragebogens
- 3.1.3. Stichprobe.
- 3.1.4. Befragung zu Gewaltverhalten
- 3.1.5. Gewalthandlungen gegen Minderjährige.
- 3.1.7. Gewalthandlungen gegen Erwachsene
- 3.1.8. Interpretation des Unterschiedes der Erfahrungen von Gewalthandlungen als Minderjährige(r) und Erwachsne(r)...
- 3.1.9. Häufigkeiten von Gewalterfahrungen als Minderjährige.
- 3.1.10. Häufigkeiten von Gewalterfahrungen als Erwachsener.
- 3.1.11. Intensität der Auswirkung von Gewalthandlungen als Minderjährige(r).
- 3.1.12. Intensität der Auswirkung als Erwachsene(r).
- 3.1.13. Vergleich der Beurteilung der Intensität der Auswirkung von Gewalthandlungen als Minderjähriger und im Erwachsenenalter.
- 3.1.14. Gewaltverhalten von Frauen.
- 3.1.15. Gewalthandlungen von Frauen .
- 3.1.16. Häufigkeit von Gewalthandlungen von Frauen
- 3.1.17. Opfer von Gewalthandlungen von Frauen.
- 3.1.18. Ursachen der Gewaltausübung von Frauen
- 3.1.19. Hypothesenprüfung und Zusammenfassung.
- Hypothesenprüfung des Zusatzfragebogens für Frauen.
- 3.2. Expertenfragebogen
- 3.2.1. Konstruktion
- 3.2.2. Kritik des Fragebogens.
- 3.2.3. Schwierigkeiten bei der Fragebogenerhebung.
- 3.2.4. Stichprobe...
- 3.2.5. Befragung zur Ausübung von Gewalt..
- 3.2.6. Einschätzung der Häufigkeit der Ausübung von physischer Gewalt.
- 3.2.7. Einschätzung der Häufigkeit der Ausübung von psychischer Gewalt.
- 3.2.8. Einschätzung der Häufigkeit der Ausübung von sexueller Gewalt..
- 3.2.9. Konfrontation.
- 3.2.10. Einstellungen
- 3.2.11. Ursachen der Gewaltausübung
- 3.3. Gegenüberstellung der Auswertungen.
- 3.3.2. Hypothesenprüfung und Zusammenfassung..
- 3.1. Allgemeiner Fragebogen
- III. Resümee.......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema der Gewalt von Frauen im gesellschaftlichen und institutionellen Bewusstsein. Sie analysiert die vielschichtigen Ursachen, Folgen und Ausprägungen weiblichen Gewaltverhaltens, wobei der Fokus auf der Darstellung der Frau als Täterin liegt. Darüber hinaus untersucht die Arbeit die Wahrnehmung und Behandlung von Gewalt von Frauen in der Gesellschaft und in der Sozialarbeit.
- Das Tabu der weiblichen Gewalt und die Herausforderungen seiner Überwindung
- Theoretische Ansätze zur Erklärung von Gewalt, mit besonderem Augenmerk auf lerntheoretische und soziostrukturelle Perspektiven
- Formen und Ausprägungen weiblichen Gewaltverhaltens in verschiedenen Lebensbereichen
- Mögliche Interventionsangebote und Herausforderungen der Sozialarbeit im Umgang mit Gewalt von Frauen
- Empirische Befunde zur Wahrnehmung und Bewertung von Gewalt von Frauen in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Der theoretische Teil dieser Diplomarbeit beschäftigt sich zunächst mit der Definition von Gewalt aus verschiedenen Perspektiven und beleuchtet das gesellschaftliche Tabu der weiblichen Gewalt. Es werden wichtige theoretische Ansätze zur Erklärung von Gewalt vorgestellt, darunter Lerntheorien und soziostrukturelle Ansätze. Des Weiteren werden verschiedene Formen personaler Gewalt, wie z.B. physische, psychische und sexuelle Gewalt, erläutert. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Gewalt in der Familie und in verschiedenen öffentlichen Bereichen, wobei die Frau als Täterin im Vordergrund steht. Erkenntnisse zu frauenspezifischen Gewaltverhalten und die Bedeutung der Sozialarbeit im Umgang mit gewalttätigen Frauen werden ebenfalls behandelt.
Im empirischen Teil der Arbeit wird die Methode des Fragebogens als Forschungsinstrument eingesetzt, um die Wahrnehmung und Bewertung von Gewalt von Frauen in der Gesellschaft zu untersuchen. Die Ergebnisse werden mit Hilfe von Hypothesen geprüft und interpretiert, um ein tieferes Verständnis für die Thematik zu gewinnen.
Schlüsselwörter
Weibliche Gewalt, Tabu, Geschlechterrolle, Soziale Rolle, Gewaltformen, Lerntheorien, Soziostrukturelle Ansätze, Familienkonflikt, Sozialarbeit, Interventionsangebote, Empirische Forschung, Fragebogen, Wahrnehmung, Bewertung, Gesellschaft
Häufig gestellte Fragen
Ist Gewalt von Frauen ein gesellschaftliches Tabu?
Ja, die Gesellschaft hält oft am Bild der Frau als sanftes Wesen fest, wodurch weibliches Aggressionsverhalten häufig ignoriert oder pathologisiert wird.
In welchen Bereichen tritt weibliche Gewalt häufig auf?
Die Arbeit untersucht Gewalt gegen Minderjährige, gegen Intimpartner (Männer), gegen alte Menschen sowie Gewalt im öffentlichen Raum und am Arbeitsplatz.
Welche Formen der Gewalt werden unterschieden?
Es wird zwischen physischer, psychischer (z.B. Mobbing) und sexueller Gewalt unterschieden.
Welche Theorien erklären die Ursachen weiblicher Gewalt?
Die Diplomarbeit zieht Aggressionstriebmodelle, Lerntheorien, soziostrukturelle Ansätze und die Frustrations-Aggressions-Hypothese heran.
Wie reagiert die Sozialarbeit auf gewalttätige Frauen?
Die Arbeit diskutiert spezifische Hilfsangebote und Interventionsmöglichkeiten, die auf die besonderen Bedürfnisse und Rollenbilder von Täterinnen zugeschnitten sind.
Warum wird Gewalt oft nur männlich assoziiert?
Dies liegt an Machtungleichgewichten und traditionellen Geschlechterrollen, die Gewalt mit Männlichkeit und Opferrolle mit Weiblichkeit verknüpfen.
- Quote paper
- Tatjana Weiß (Author), 2006, Täterin Frau - Gewaltverhalten von Frauen im gesellschaftlichen und institutionellen Bewusstsein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58376