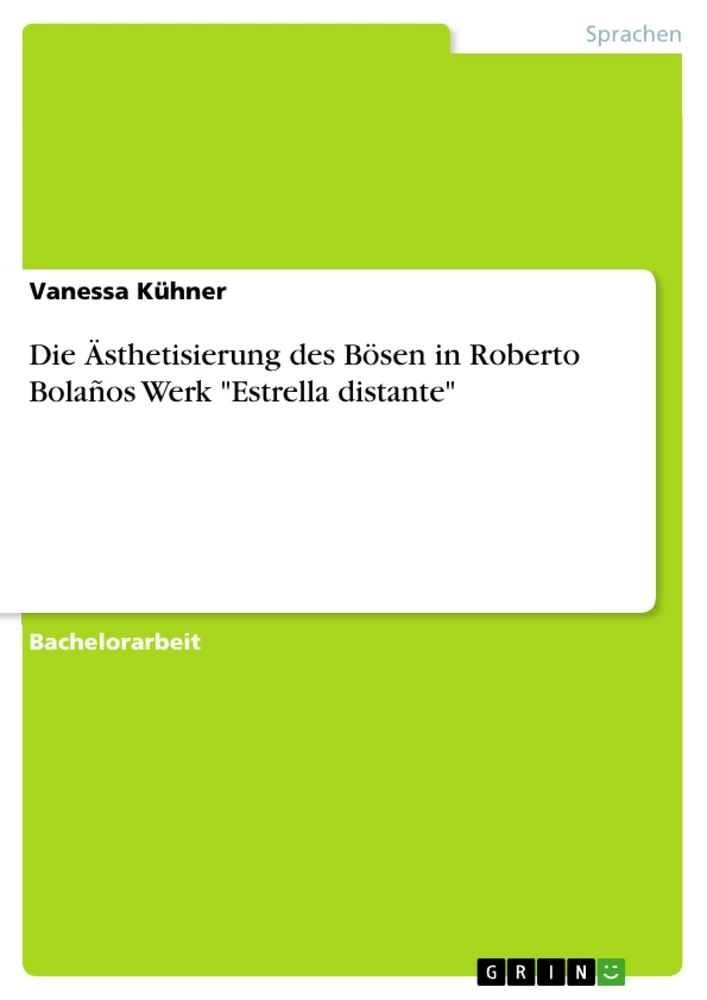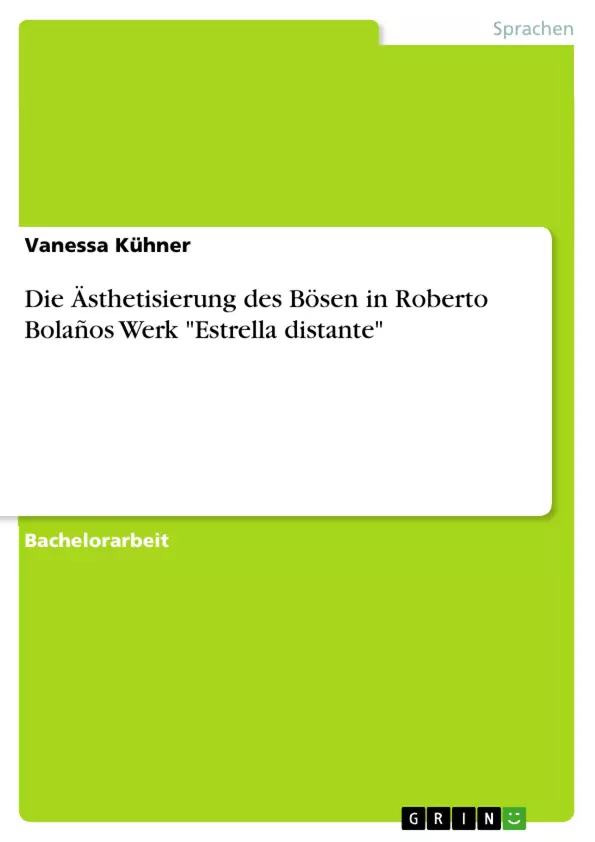Durch den Protagonisten der Novelle "Estrella distante" erzeugt Roberto Bolaño eine Fusion zwischen exzessiver Gewalt und purer Kunst, denn insbesondere die originelle Modellierung der Hauptfigur, welche Wieder als Repräsentant und zugleich als ausführende Kraft der künstlerischen Inszenierung von Gewalt darstellt, erlaubt es dem Werk, das Böse zu ästhetisieren. Eben diese Ästhetisierung des Bösen, durch welche der Rezipient enorme emotionale Belastung sowie gleichermaßen Faszination erfährt, wird in der folgenden Arbeit im Zentrum der Untersuchung stehen. Da der wissenschaftliche Diskurs nicht die Analyse des Bösen an sich und die damit verbundenen philosophischen Theorien Baudillards, Sichères oder de Sades intendiert, sondern die Untersuchung der Art und Weise der Ästhetisierung des Bösen fokussiert, wird in der Arbeit wie folgt vorgegangen:
Um die Untersuchung in einen theoretischen Rahmen zu betten, werden zunächst die Studie von Peter-André Alt über die Ästhetik des Bösen sowie Julia Kristevas Theorie hinsichtlich des Abjekten erläutert. Aufgrund der äußerst detaillierten und literarisch gut fundierten Thematisierung der Ästhetik des Bösen wurde Alts Werk bei der folgenden Arbeit rezipiert. Insbesondere die von dem Germanist erläuterte Entwicklung der literarischen Darstellung des Bösen ist ausschlaggebend für die folgende Analyse, da Alt hierbei die durch die aufklärerische Kritik im 18. Jahrhundert evozierte Verflüchtigung des repräsentativ Bösen in die Psyche der Figuren betont und somit ebenfalls die dadurch errungene Komplexität und Vielfalt des Bösen auf literarischem Terrain konstatiert. Kristevas weitläufige und in sich komplexe Theorie über das Abjekte wurde ebenfalls für die Schaffung eines theoretischen Fundaments adaptiert, wobei vor allem die von der Wissenschaftlerin ausgearbeiteten Charakteristika des Abjekten bei der folgenden Untersuchung großen Anklang finden. Nach der ausführlichen Thematisierung der Studien Alts und Kristevas erfolgt eine kurze Conclusio, um die für die folgende Analyse ausschlaggebenden Aspekte der teils nur schwer fassbaren Theorien zu verdeutlichen und miteinander zu verbinden. Der Hauptteil der Arbeit, welcher die Analyse der Darstellung von Gewalt und Horror in Estrella distante repräsentiert, wird eingeleitet, indem zunächst die Analogien zum Nationalsozialismus und zur Pinochet-Diktatur untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die Ästhetik des Bösen und das Abjekte – Eine theoretische Basis
- Peter-André Alts Studie zur Ästhetik des Bösen
- Julia Kristeva und der Begriff des Abjekten
- Conclusio
- Analyse der Darstellung von Gewalt und Horror in Estrella distante
- Die Rezeption des Horrors der Pinochet-Diktatur und des Nationalsozialismus
- Carlos Wieder/Alberto Ruiz-Tagle: Die Inkarnation des mal absoluto
- Die Darstellung der Persönlichkeit Wieders/Ruiz-Tagles
- Die Kunstdarbietungen des Protagonisten: el arte nuevo
- Exkurs: Wieder in Bezug auf den Titel Estrella distante
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ästhetisierung des Bösen in Robert Bolaños Novelle Estrella distante. Ziel ist es, die Darstellung von Gewalt und Horror im Kontext der Pinochet-Diktatur und des Nationalsozialismus zu analysieren und die Rolle des Protagonisten Carlos Wieder als Inkarnation des "mal absoluto" zu beleuchten. Die Untersuchung stützt sich auf theoretische Ansätze von Peter-André Alt und Julia Kristeva.
- Die Ästhetisierung des Bösen in der Literatur
- Die Rezeption des Horrors der Pinochet-Diktatur und des Nationalsozialismus in Bolaños Werk
- Die Charakterisierung von Carlos Wieder als mordender Poet und seine Rolle in der Novelle
- Die Verbindung zwischen Gewalt und Kunst bei Bolaño
- Die Analyse der "arte nuevo" des Protagonisten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorwort: Das Vorwort zitiert Bolaño, der das Sichtbarmachen des Abgrunds als Quintessenz hochwertigen Schreibens bezeichnet. Es wird Bolaños Bestreben herausgestellt, das Böse in seinen Werken darzustellen und dem Leser gefährlich nahe zu bringen. Estrella distante wird als eine Annäherung an das "mal absoluto" vorgestellt, wobei die Figur des Carlos Wieder als zentrale Figur zur Ästhetisierung des Bösen dient. Die Arbeit fokussiert sich auf die Art und Weise dieser Ästhetisierung, nicht auf philosophische Theorien des Bösen selbst.
2. Die Ästhetik des Bösen und das Abjekte - Eine theoretische Basis: Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament der Arbeit. Es erläutert Peter-André Alts Studie zur Ästhetik des Bösen, die die Entwicklung der literarischen Darstellung des Bösen und dessen Verlagerung in die Psyche der Figuren im 18. Jahrhundert beschreibt. Weiterhin wird Julia Kristevas Theorie des Abjekten vorgestellt, mit Fokus auf deren Charakteristika. Die Conclusio verbindet die zentralen Aspekte beider Theorien für die anschließende Analyse.
3. Analyse der Darstellung von Gewalt und Horror in Estrella distante: Dieser zentrale Teil untersucht die Analogien zwischen Estrella distante und dem Nationalsozialismus sowie der Pinochet-Diktatur unter Bezugnahme auf einschlägige wissenschaftliche Arbeiten. Die detaillierte Analyse des Protagonisten Carlos Wieder wird in drei Unterkapitel gegliedert: die Darstellung seiner Persönlichkeit (inklusive seiner Doppeldeutigkeit), seine Kunstdarbietungen ("el arte nuevo") und schließlich ein Exkurs, der Wieder mit dem Titel der Novelle in Verbindung bringt. Die Analyse stützt sich auf diverse wissenschaftliche Arbeiten, die die Ästhetik und die Darstellung des Bösen bei Bolaño untersuchen.
Schlüsselwörter
Ästhetik des Bösen, Robert Bolaño, Estrella distante, Carlos Wieder, Pinochet-Diktatur, Nationalsozialismus, Gewalt, Kunst, "mal absoluto", Abjekte, Peter-André Alt, Julia Kristeva, arte nuevo, Horror.
Häufig gestellte Fragen zu Robert Bolaños "Estrella distante"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Ästhetisierung des Bösen in Robert Bolaños Novelle "Estrella distante". Der Fokus liegt auf der Darstellung von Gewalt und Horror im Kontext der Pinochet-Diktatur und des Nationalsozialismus, insbesondere durch die Figur des Protagonisten Carlos Wieder als Inkarnation des "mal absoluto".
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorien von Peter-André Alt zur Ästhetik des Bösen und Julia Kristevas Konzept des Abjekten. Diese werden zur Interpretation der Darstellung von Gewalt und Horror in Bolaños Werk herangezogen.
Wer ist Carlos Wieder und welche Rolle spielt er?
Carlos Wieder ist der Protagonist der Novelle und wird als zentrale Figur zur Ästhetisierung des Bösen dargestellt. Die Arbeit untersucht seine Persönlichkeit, seine Kunstdarbietungen ("el arte nuevo") und seine Beziehung zum Titel der Novelle. Seine Doppeldeutigkeit und seine Rolle als "mordender Poet" stehen im Mittelpunkt der Analyse.
Wie wird Gewalt und Horror in der Novelle dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Analogien zwischen "Estrella distante" und dem Nationalsozialismus sowie der Pinochet-Diktatur. Es wird untersucht, wie Bolaño Gewalt und Horror darstellt und welche Rolle die Ästhetik dabei spielt. Die Analyse bezieht sich auf einschlägige wissenschaftliche Arbeiten zu Bolaños Werk.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in ein Vorwort, ein Kapitel zur theoretischen Basis (Ästhetik des Bösen und Abjekte), ein zentrales Kapitel zur Analyse der Gewalt- und Horrordarstellung in "Estrella distante" und eine Schlussbetrachtung. Das Vorwort stellt den Kontext dar, das Kapitel zur theoretischen Basis erläutert die verwendeten Theorien, das zentrale Kapitel analysiert die Novelle und die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ästhetik des Bösen, Robert Bolaño, "Estrella distante", Carlos Wieder, Pinochet-Diktatur, Nationalsozialismus, Gewalt, Kunst, "mal absoluto", Abjekte, Peter-André Alt, Julia Kristeva, "arte nuevo", Horror.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Ästhetisierung des Bösen in "Estrella distante" zu untersuchen und die Darstellung von Gewalt und Horror im Kontext der historischen Ereignisse zu analysieren. Die Rolle des Protagonisten Carlos Wieder als Inkarnation des "mal absoluto" soll dabei beleuchtet werden.
- Quote paper
- Vanessa Kühner (Author), 2015, Die Ästhetisierung des Bösen in Roberto Bolaños Werk "Estrella distante", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/583784