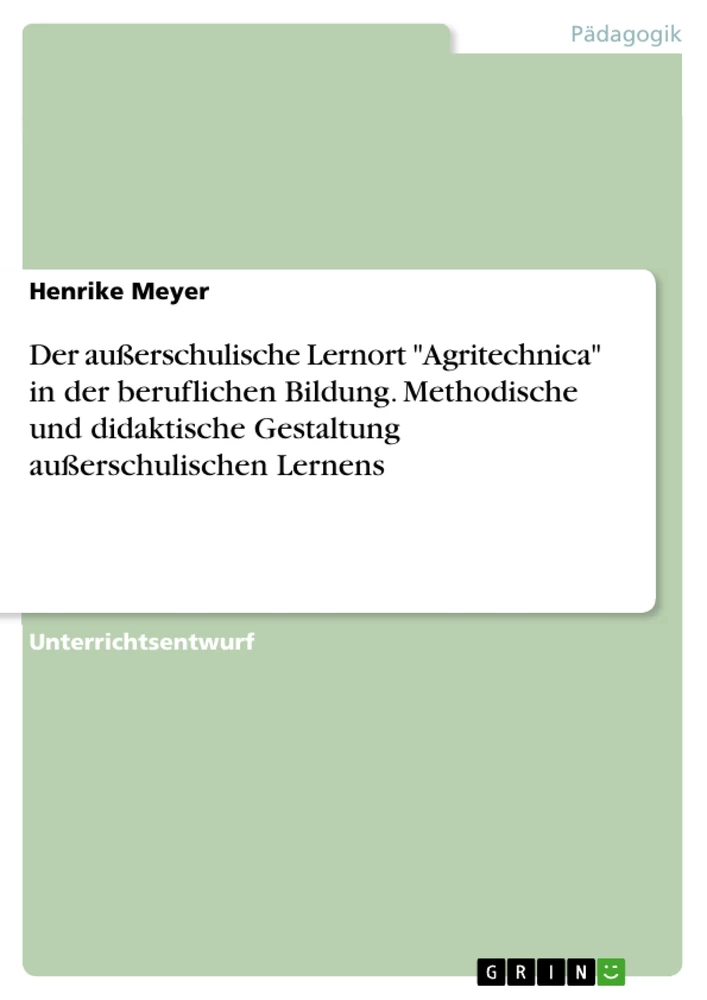Im Rahmen des Praxissemesters stellt sich die Frage, wie die außerschulischen Veranstaltungen organisiert werden können und wie das Potenzial des außerschulischen Lernens vollständig ausgeschöpft werden kann. So ergab sich die Möglichkeit, den Besuch der weltweit größten Fachmesse für Agrartechnik zu begleiten und methodisch und didaktisch aufzuarbeiten. In dieser Studienarbeit wird die folgende Forschungsfrage bearbeitet: Wie kann der außerschulische Lernort (ASL) „Agritechnica“ in der beruflichen Bildung methodisch und didaktisch gestaltet werden, damit das außerschulische Lernen einen Nutzen für die SuS hat?
Um der Thematik näher zu kommen, beschäftigt sich der erste Teil der Studienarbeit mit der Theorie der ASL im Allgemeinen als auch im Kontext der beruflichen Bildung. Neben den Begrifflichkeiten und Merkmalen des außerschulischen Lernens werden Aspekte der didaktischen und methodischen Herangehensweise konkretisiert. Dabei wird auch das Paradoxon von Nähe und Distanz schulischen Lernens thematisiert. Im zweiten Teil der Arbeit wird die Ausarbeitung des ersten Teils herangezogen, um den Besuch der „Agritechnica“ zu planen und durchzuführen. Zunächst werden die Besonderheiten und Anforderungen des Lernortes beschrieben, damit diese in den Planungsphasen berücksichtigt werden können. Die Planung selber gliedert sich in die Phase der Vorbereitung, die Phase der Durchführung und in die Phase der Reflexion. Im dritten Teil der Arbeit werden die theoretischen Ansätze des ersten Teils mit der praktischen Umsetzung des zweiten Teils anhand von Kriterien tabellarisch verglichen. Dabei werden die praktischen Erfahrungen mit Hilfe von narrativen Interviews ergänzt. Die Ergebnisse werden anschließend diskutiert und geben Anreize für einen kurzen Ausblick in das Praxissemester. Abschließend wird ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Außerschulische Lernorte in der beruflichen Bildung
- Notwendigkeit der Lernorte in der beruflichen Bildung
- Begriffserklärungen und Merkmale
- Das Potenzial von ASL für die Schule
- Didaktisch-methodische Herangehensweisen
- Das Paradoxon des schulischen Lernens
- Schulische Lernen am Lernort „Agritechnica“
- Der Lernort „Agritechnica“
- Besonderheiten und Anforderungen der „Agritechnica“
- Durchführung der Veranstaltung
- Diskussion
- Ausblick
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen der Integration des Außerschulischen Lernorts (ASL) „Agritechnica“ in die berufliche Bildung. Der Fokus liegt auf der methodischen und didaktischen Gestaltung des Besuchs, um den größtmöglichen Nutzen für die Schüler und Schülerinnen (SuS) zu erzielen.
- Die Bedeutung von ASL in der beruflichen Bildung
- Die besonderen Herausforderungen und Chancen des Lernorts „Agritechnica“
- Methodische und didaktische Konzepte für den Einsatz von ASL
- Die Rolle von Praxisbezug und Realitätsnähe im außerschulischen Lernen
- Die Evaluation des Lernprozesses und die Reflexion der Lernerfahrungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz von Lernortkooperationen in der beruflichen Bildung und stellt die Forschungsfrage nach der methodischen und didaktischen Gestaltung des Außerschulischen Lernorts „Agritechnica“.
Das zweite Kapitel definiert den Begriff des ASL und erläutert dessen Potenzial für die Schule. Es werden didaktisch-methodische Herangehensweisen vorgestellt und das Paradoxon von Nähe und Distanz schulischen Lernens diskutiert.
Das dritte Kapitel widmet sich der konkreten Planung und Durchführung des Besuchs der „Agritechnica“ als Lernort. Es werden Besonderheiten und Anforderungen des Lernorts analysiert und die Planung in Vorbereitung, Durchführung und Reflexion unterteilt.
Schlüsselwörter
Außerschulisches Lernen, berufliche Bildung, Lernortkooperation, Agritechnica, Fachmesse, Agrartechnik, methodische und didaktische Gestaltung, Praxisbezug, Realitätsnähe, Lernerfahrungen, Evaluation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein außerschulischer Lernort (ASL)?
Ein ASL ist ein Ort außerhalb des Klassenzimmers, wie z. B. eine Fachmesse, der Schülern ermöglicht, theoretisches Wissen in der Praxis zu erleben.
Warum eignet sich die „Agritechnica“ als Lernort?
Als weltweit größte Fachmesse für Agrartechnik bietet sie Einblicke in modernste Technologien und Trends, die für die berufliche Bildung essenziell sind.
Wie sollte ein Messebesuch didaktisch geplant werden?
Die Planung gliedert sich in drei Phasen: Vorbereitung (Themenwahl), Durchführung (Aufgaben vor Ort) und Reflexion (Nachbereitung im Unterricht).
Was ist das Paradoxon von Nähe und Distanz beim schulischen Lernen?
Es beschreibt die Herausforderung, dass Lernorte zwar realitätsnah sind (Nähe), aber dennoch eine gezielte pädagogische Steuerung benötigen (Distanz), um Lernerfolge zu sichern.
Welchen Nutzen haben narrative Interviews in dieser Studie?
Sie dienen dazu, die praktischen Erfahrungen der Teilnehmer zu erfassen und die theoretischen Ansätze mit der gelebten Realität zu vergleichen.
- Quote paper
- Henrike Meyer (Author), 2020, Der außerschulische Lernort "Agritechnica" in der beruflichen Bildung. Methodische und didaktische Gestaltung außerschulischen Lernens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/583974