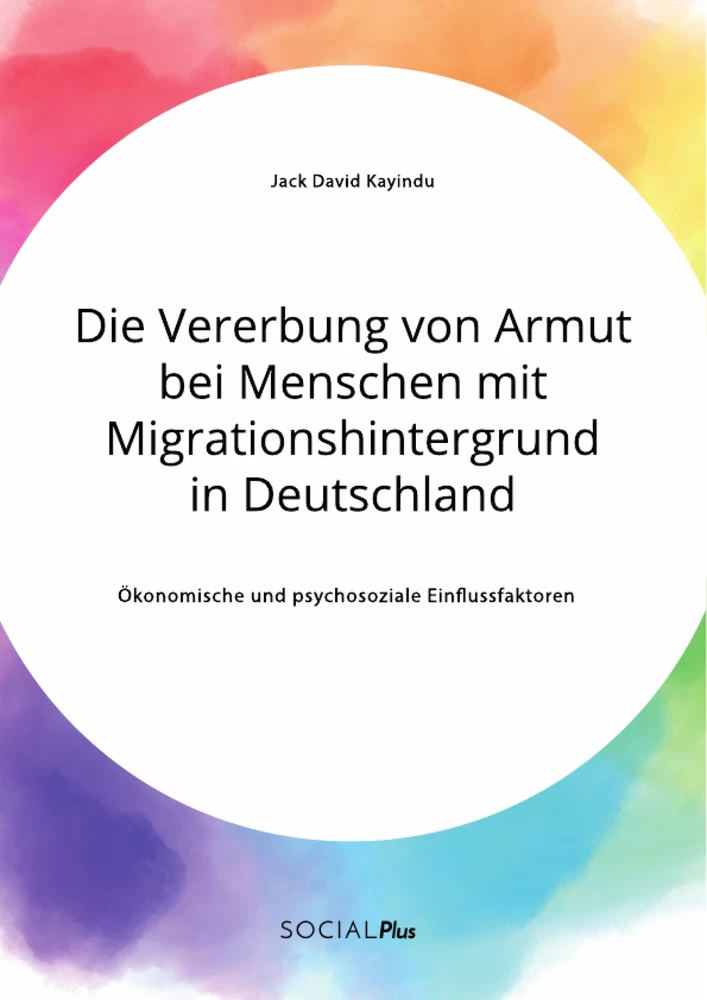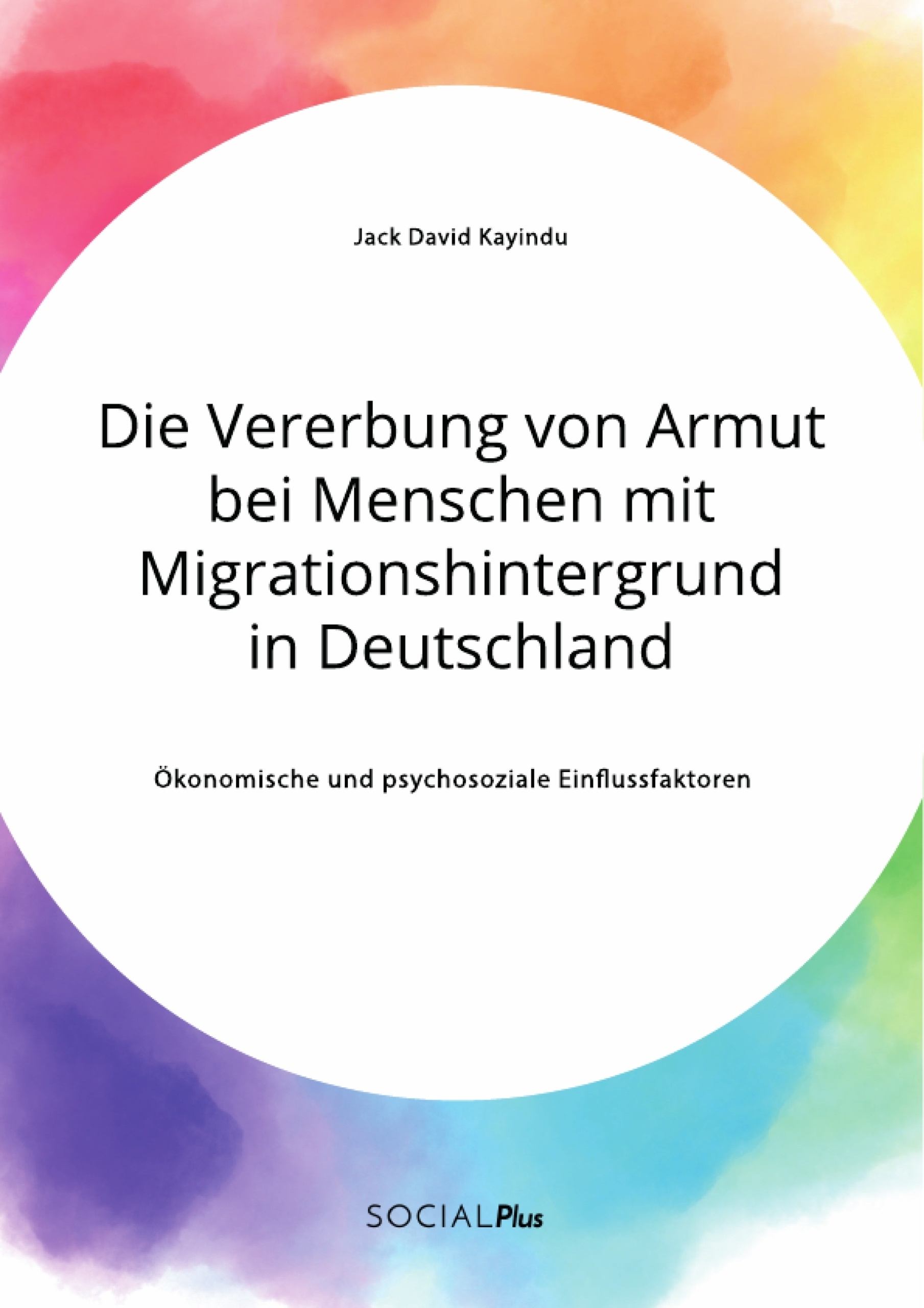Armut betrifft nicht nur die ökonomische Situation einer Person oder Familie. Sie ist ein mehrdimensionales Problem, das finanzielle, soziale und kulturelle Aspekte umfasst. Der Armuts- und Reichtumsbericht für Deutschland hat ergeben, dass nicht etwa Arbeitssuchende, Alleinerziehende oder kinderreiche Familien von Armut bedroht sind. Es sind hingegen Menschen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland besonders armutsgefährdet sind.
In vielen Fällen betrifft Armut außerdem nicht nur die Haushalte, die unmittelbar in die Armut rutschen. Sie setzt sich stattdessen von Generation zu Generation fort. Jack David Kayindu erklärt in seiner Publikation, wie es zu einer solchen Vererbung von Armut kommt.
Welche gesellschaftlichen, psychologischen und ökonomischen Faktoren beeinflussen diese Entwicklung? Und welche Entstehungsfaktoren betreffen vor allem Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland? Kayindu leistet mit seinem Buch einen wichtigen Beitrag dazu, ein brisantes gesellschaftliches Phänomen besser zu verstehen und zu lösen.
Aus dem Inhalt:
- Integration;
- Gleichstellung;
- Bildungsungleichheit;
- Chancengleichheit;
- Sozialstaat
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Menschen mit Migrationshintergrund
- Armut und die Vererbung von Armut
- Die Lebenssituationen der armutsbetroffenen MigrantInnen in Deutschland gegenüber denen ohne Migrationshintergrund
- Einflussfaktoren und Entstehungsursachen der Vererbung von Armut
- Der ökonomische Ansatz: Ressourcenansatz
- Kinderarmut
- Dauerhafte Erwerbslosigkeit bzw. „working poor" bei MigrantInnen
- Armutspolitik Deutschlands - Sozialstaatsmodell
- Einflussfaktoren und Entstehungsursachen der Vererbung von Armut II
- Der psychosoziale Ansatz
- Der Subkulturansatz
- Erlernte Hilflosigkeit
- Habitus
- Die Sozialisationstheorie
- Soziale Ausgrenzung und soziale Mobilität
- Zusammenfassung des psychosozialen Ansatzes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Vererbung von Armut bei Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf der Untersuchung der ökonomischen und psychosozialen Einflussfaktoren, die zur Perpetuierung von Armut in dieser Bevölkerungsgruppe beitragen.
- Ökonomische Faktoren wie der Ressourcenansatz, die Kinderarmut, die Dauerhafte Erwerbslosigkeit und die Armutspolitik Deutschlands
- Psychosoziale Faktoren wie der Subkulturansatz, die erlernte Hilflosigkeit, der Habitus, die Sozialisationstheorie und die soziale Ausgrenzung
- Die Lebensbedingungen von armutsbetroffenen MigrantInnen im Vergleich zu Menschen ohne Migrationshintergrund
- Die Rolle der Sozialisation und der Integration in der Entstehung und Vererbung von Armut
- Die Bedeutung von Bildungs- und Beschäftigungspolitik für die Armutsbekämpfung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung des Buches stellt den Kontext des Themas "Vererbung von Armut" vor. Sie definiert den Begriff der "Migrationshintergrund" und beleuchtet die Problematik der Armut sowie deren Vererbung in dieser Gruppe. Kapitel 2 beleuchtet die ökonomischen Faktoren, die zur Entstehung und Vererbung von Armut bei MigrantInnen beitragen. Diese reichen vom Ressourcenansatz über Kinderarmut und "working poor" bis hin zur deutschen Armutspolitik. Kapitel 3 widmet sich den psychosozialen Aspekten, die Armut begünstigen. Hier werden Theorien wie der Subkulturansatz, die erlernte Hilflosigkeit und der Habitus sowie die Rolle der Sozialisation und sozialen Ausgrenzung behandelt.
Schlüsselwörter
Migrationshintergrund, Armut, Vererbung von Armut, ökonomische Einflussfaktoren, psychosoziale Einflussfaktoren, Ressourcenansatz, Kinderarmut, "working poor", Armutspolitik, Subkulturansatz, erlernte Hilflosigkeit, Habitus, Sozialisation, soziale Ausgrenzung, soziale Mobilität, Integration, Bildung, Beschäftigung
- Quote paper
- Jack David Kayindu (Author), 2021, Die Vererbung von Armut bei Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Ökonomische und psychosoziale Einflussfaktoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/584228