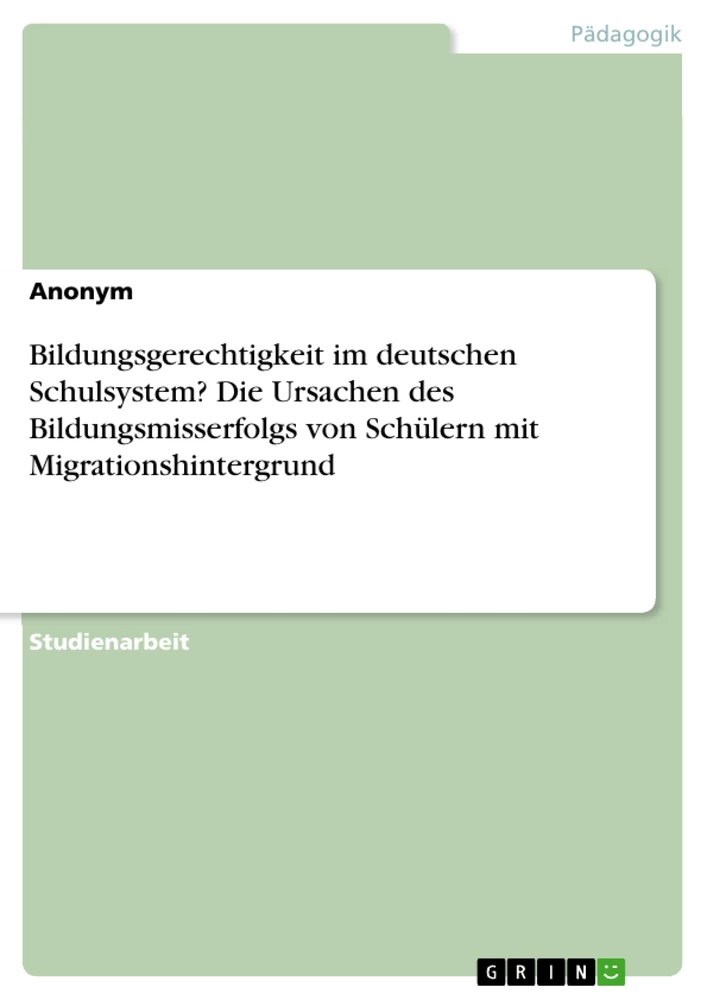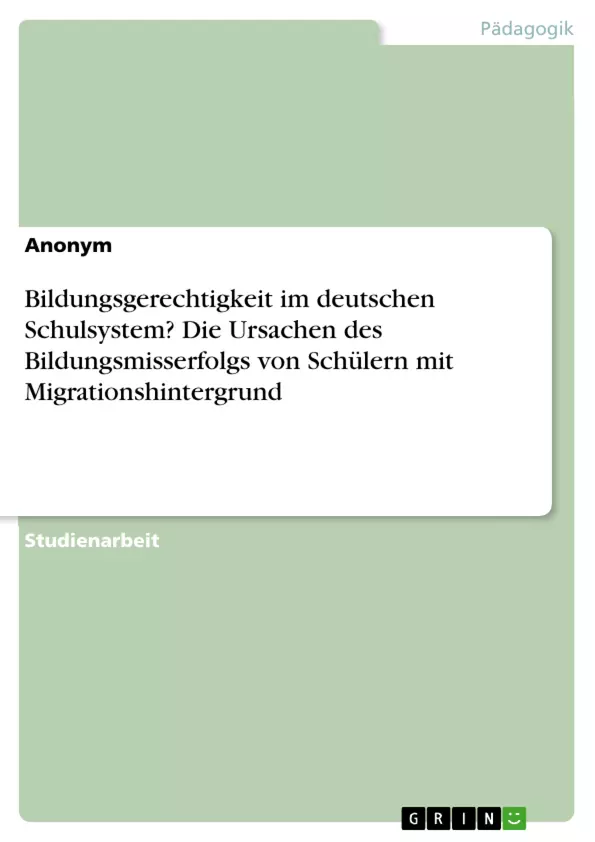Folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, weshalb Migranten im deutschen Schulsystem schlechter abschneiden als ihre autochthonen Mitschüler. Dabei wird besonders auf die Bedeutung der Sprache eingegangen sowie eine mögliche Diskriminierung auf Seiten des Schulsystems untersucht.
Die PISA-Studie, die im Jahre 2001 veröffentlicht wurde, sorgte für Aufsehen bei den Verantwortlichen des Bildungssystems, stellte sie ihm doch ein schlechtes Zeugnis aus. Denn im Vergleich zu den anderen OECD-Ländern hatte es einen unterdurchschnittlichen Wert erreicht. Zudem wurde deutlich, dass gerade in Deutschland der Bildungserfolg in erheblichem Maße von der sozialen Herkunft abhängt, also vom sozioökonomischen Status und dem Bildungsabschluss der Eltern. Das betrifft unter anderem auch die Migranten, die signifikant schlechtere Leistungen im Vergleich zu den einheimischen erbrachten. Dieser Umstand wurde von einigen genutzt, um damit das schlechte Abschneiden von Deutschland bei PISA zu erklären. Damit wurde von ihnen die Schuld nicht dem Schulsystem zugeschrieben, sondern den mangelnden Kompetenzen der Schüler mit Migrationshintergrund. Dieser Darstellung widerspricht jedoch Diefenbach, denn zum einen erreichten andere Länder wie Australien und Kanada mit einem höheren Migrantenanteil in der Schülerschaft ebenso gute Leistungen wie die einheimischen Schüler und zum anderen schnitten auch deutsche Bundesländer mit niedrigen Migrantenkonzentrationen schlecht ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutende Faktoren für den Schulerfolg im Umfeld der Migranten
- Die Bedeutung der Sprache
- Bedeutung der Muttersprache für das Erlernen der Zweitsprache
- Bedeutung der zuhause gesprochenen Sprache
- Bedeutung der Kultur
- Die Bedeutung der Sprache
- Mögliche Ursachen des Bildungsmisserfolgs von Migranten im Umfeld der Schule
- Diskriminierung
- Individuelle Diskriminierung
- Institutionelle Diskriminierung
- Das dreigliedrige Schulsystem
- Diskriminierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Bildungsgerechtigkeit im deutschen Schulsystem und analysiert die Ursachen des Bildungsmisserfolgs von Schülern mit Migrationshintergrund. Er hinterfragt, ob das Schulsystem die Nachteile von Migranten aufgrund ihrer sozialen Herkunft und ihres Migrationshintergrunds ausgleichen kann, um so von Bildungsgerechtigkeit zu sprechen.
- Die Bedeutung der Sprache für den Schulerfolg von Migranten
- Der Einfluss der Muttersprache auf das Erlernen der Zweitsprache
- Mögliche Ursachen für den Bildungsmisserfolg von Migranten
- Die Rolle von Diskriminierung und dem dreigliedrigen Schulsystem
- Die Herausforderungen des deutschen Bildungssystems in Bezug auf Integration und Chancengleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet den Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft, insbesondere im Kontext der PISA-Studie und der Leistungsunterschiede zwischen einheimischen Schülern und Schülern mit Migrationshintergrund. Sie stellt fest, dass Deutschland, trotz Verbesserungen seit PISA 2000, weiterhin Schwierigkeiten hat, den Bildungserfolg von der sozialen Herkunft zu entkoppeln. Der Text betont die Bedeutung der Chancengleichheit im Bildungssystem und kritisiert die geringe Aufmerksamkeit, die dem Bildungsschicksal von Migranten in der deutschen Öffentlichkeit zuteil wird.
Bedeutende Faktoren für den Schulerfolg im Umfeld der Migranten
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Bedeutung der Sprache für den Schulerfolg von Migranten. Es werden die verschiedenen Einflüsse der Muttersprache und der zuhause gesprochenen Sprache auf das Erlernen der Zweitsprache beleuchtet. Die Diskussion beleuchtet die unterschiedlichen Positionen zum Einfluss der Muttersprachkenntnisse auf den Erwerb der Zweitsprache und zeigt die Notwendigkeit weiterer Forschung auf diesem Gebiet auf.
Mögliche Ursachen des Bildungsmisserfolgs von Migranten im Umfeld der Schule
Dieses Kapitel untersucht mögliche Ursachen für den Bildungsmisserfolg von Migranten im Schulsystem. Es werden sowohl individuelle Diskriminierung als auch institutionelle Diskriminierung als potenzielle Faktoren für den Misserfolg genannt. Außerdem wird die Rolle des dreigliedrigen Schulsystems im Kontext von Bildungsungleichheit beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Bildungsgerechtigkeit, Bildungsmisserfolg, Migranten, Migrationshintergrund, Sprache, Zweitspracherwerb, Muttersprache, Diskriminierung, Schulsystem, Chancengleichheit, soziale Herkunft.
Häufig gestellte Fragen
Warum schneiden Schüler mit Migrationshintergrund im deutschen Schulsystem oft schlechter ab?
Hauptursachen sind die starke Kopplung des Bildungserfolgs an die soziale Herkunft, sprachliche Barrieren sowie institutionelle Diskriminierung innerhalb des Schulsystems.
Welche Rolle spielt die Muttersprache beim Erlernen der Zweitsprache Deutsch?
Es gibt verschiedene Theorien: Einige Forscher betonen, dass eine starke Basis in der Muttersprache den Erwerb des Deutschen fördert, während andere den Fokus auf die zuhause gesprochene Sprache legen.
Was ist institutionelle Diskriminierung im Schulwesen?
Darunter versteht man Strukturen im Bildungssystem (z.B. das dreigliedrige Schulsystem), die Schüler mit Migrationshintergrund benachteiligen, oft unabhängig von ihrer individuellen Leistung.
Hat der Migrantenanteil in einer Klasse Einfluss auf die Leistung?
Studien zeigen, dass nicht der Anteil der Migranten entscheidend ist, sondern die soziale Zusammensetzung und die Qualität der Förderung, wie Beispiele aus Kanada und Australien belegen.
Wie hängen Bildungserfolg und sozioökonomischer Status zusammen?
In Deutschland hängt der Schulerfolg überdurchschnittlich stark vom Bildungsabschluss und Einkommen der Eltern ab, was Migranten, die oft einer niedrigeren sozialen Schicht angehören, zusätzlich belastet.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Bildungsgerechtigkeit im deutschen Schulsystem? Die Ursachen des Bildungsmisserfolgs von Schülern mit Migrationshintergrund, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/584934