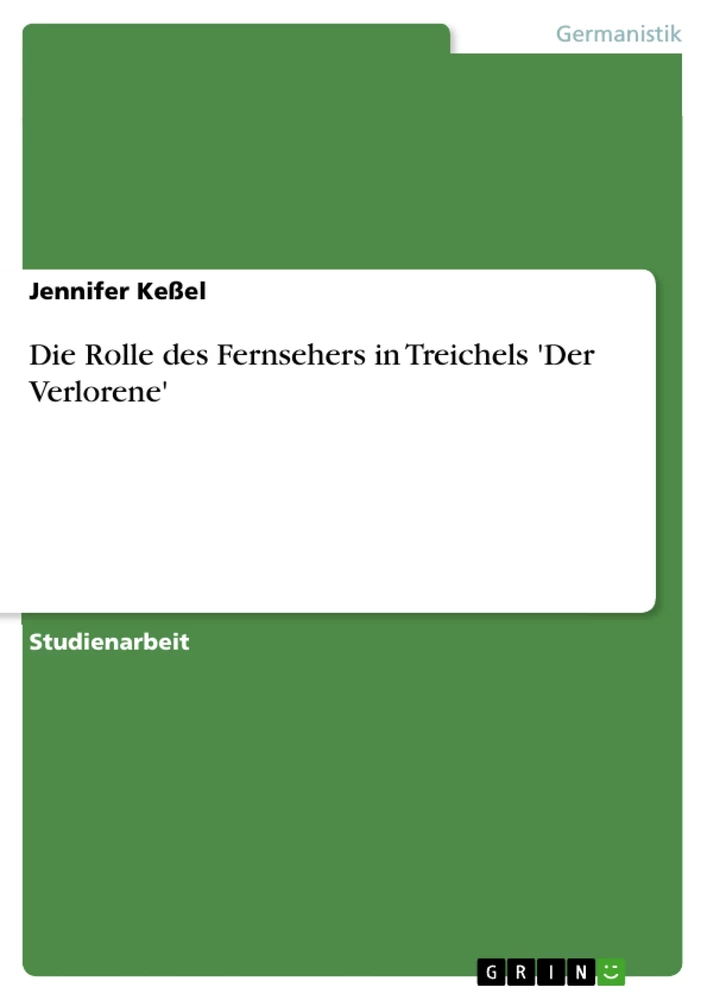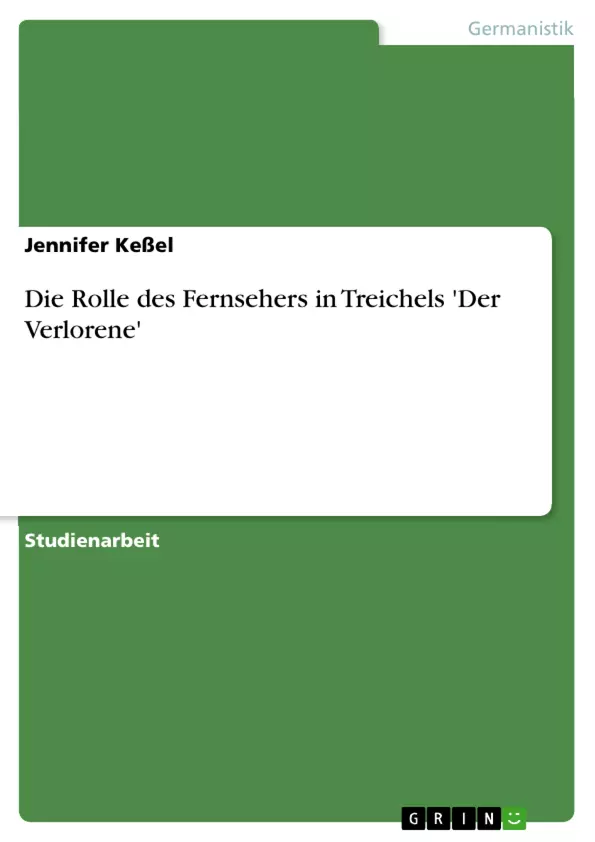In welchem Zusammenhang könnte der Begriff Wissenstransfer eine größere Rolle spielen, als im Kontext der frühkindlichen Wissensvermittlung. Sich einzulassen auf einen Transfer bestimmter Wissensinhalte auf eine völlig andere kognitive Ebene als die eigene, nämlich die, auf der sich kindliche Rezipienten befinden, kann sicherlich als Herausforderung angesehen werden. Die Macher der„Sendung mit der Maus“2, die seit Beginn der 70er Jahre den Weg für ein gezielt an Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren gerichtetes deutsches Fernsehprogramm überhaupt geebnet haben, versuchten sich dieser Herausforderung, nicht immer zugegebenermaßen3, zu stellen und das mit Blick auf die lange Sendetradition offenbar recht erfolgreich. Der Untertitel„Lach- und Sachgeschichten“ist Programm: Wissenswertes wird mit Unterhaltsamem gepaart und gerade hierin scheint das Erfolgsrezept zu liegen. In dieser Arbeit werden exemplarisch einige von Armin Maiwald und seiner Filmproduktionsfirma„Flash Film“für die SmdM produzierte und vom WDR ausgestrahlte Sachgeschichten auf ihre sprachliche Gestaltung hin untersucht. Dies kann natürlich nicht ohne nähere Beleuchtung des Kontextes geschehen: Zum einen sind der Produktions- und Rezeptionskontext und die Einbettung der Sachgeschichten in das Sendungskonzept zu beleuchten. Wichtig erscheint hier die Frage nach den eigentlichen Voraussetzungen für den Wissenstransfer„mit der Maus“und nach den Relationen zwischen den Sachgeschichten und den sonstigen Beiträgen. Neben der im Zentrum stehenden Untersuchung der sprachlichen Gestaltung der Sachgeschichten darf die Betrachtung der Text-Bild-Beziehung auf Grund des audiovisuellen Charakters des Untersuchungsmaterials nicht außen vor gelassen werden, darum wird auch hier ein Schwerpunkt gesetzt. Welche Schlüsse lassen sich auf Grundlage der Untersuchungen für den Wissenstransfer für Kleinkinder ziehen? Welche Strategien der Sachgeschichten-Produzenten ließen sich als vorbildlich charakterisieren und wären auch in anderen Kontexten fruchtbar zu machen? Und vor allem: Welche Rolle kommt der Sprache in dieser speziellen Form des Wissenstransfers zu?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhalt des Buches „Der Verlorene“
-
Die Rolle des Fernsehers
- Text: Hilft das Fernsehen der Literatur?
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Rolle des Fernsehens in Hans-Ulrich Treichels Erzählung „Der Verlorene“. Die Autorin analysiert die Darstellung des Mediums im Kontext der 1950er Jahre und untersucht die Frage, ob das Fernsehen der Literatur hilft oder umgekehrt. Dabei werden theoretische Texte von Villem Flusser und Christoph Schmitz-Scholemann herangezogen.
- Die Rolle des Fernsehens in der Nachkriegsgesellschaft
- Der Einfluss von Medien auf die Literatur
- Die Bedeutung von Flucht und Erinnerung im Roman
- Das Familienleben in der Wirtschaftswunderzeit
- Die Auswirkungen des Krieges auf das Leben einer Familie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert das Thema der Hausarbeit, das Verhältnis von Fernsehen und Literatur. Die Autorin skizziert den theoretischen Rahmen, der durch die Texte von Flusser und Schmitz-Scholemann bestimmt wird.
Kapitel 2 stellt die Familie im Zentrum der Handlung vor. Die Eltern suchen in den 1950er Jahren ihren "verlorenen" Sohn, während der jüngere Sohn, der Erzähler, unter dem Druck der Familiensituation leidet. Die Geschichte zeigt die Auswirkungen des Krieges auf das Leben der Familie.
In Kapitel 3a steht der Fernseher als Medium im Vordergrund. Die Autorin untersucht die Rolle des Fernsehers in der Zeit der Wirtschaftswunder und diskutiert den Konflikt zwischen den Eltern und dem Fernseher.
Der Abschnitt 3b widmet sich der Frage, ob das Fernsehen der Literatur hilft.
Schlüsselwörter
Fernsehen, Literatur, Medien, Nachkriegszeit, Wirtschaftswunder, Familie, Krieg, Erinnerung, Flucht, "Der Verlorene", Hans-Ulrich Treichel, Villem Flusser, Christoph Schmitz-Scholemann.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt der Fernseher in Treichels "Der Verlorene"?
Der Fernseher wird als Medium der 1950er Jahre analysiert, das im Spannungsfeld zwischen Familienleben, Wirtschaftswunder und der Verdrängung der Kriegsvergangenheit steht.
Worum geht es in der Erzählung "Der Verlorene"?
Es geht um eine Familie in der Nachkriegszeit, die ihren im Krieg verlorenen Sohn sucht, während der jüngere Bruder unter dem psychischen Druck dieser Suche leidet.
Hilft das Fernsehen der Literatur?
Die Arbeit untersucht diese Frage anhand theoretischer Texte von Villem Flusser und Christoph Schmitz-Scholemann und beleuchtet das wechselseitige Verhältnis beider Medien.
Was sind "Lach- und Sachgeschichten"?
Dies ist das Konzept der "Sendung mit der Maus", bei dem Wissen unterhaltsam vermittelt wird. Die Arbeit untersucht die sprachliche Gestaltung dieser Geschichten.
Welche Bedeutung hat die Wirtschaftswunderzeit für das Buch?
Die Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs bildet den Hintergrund für das Familienleben, das trotz materiellem Wohlstand von den Traumata des Krieges überschattet bleibt.
- Quote paper
- Jennifer Keßel (Author), 2003, Die Rolle des Fernsehers in Treichels 'Der Verlorene', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58545