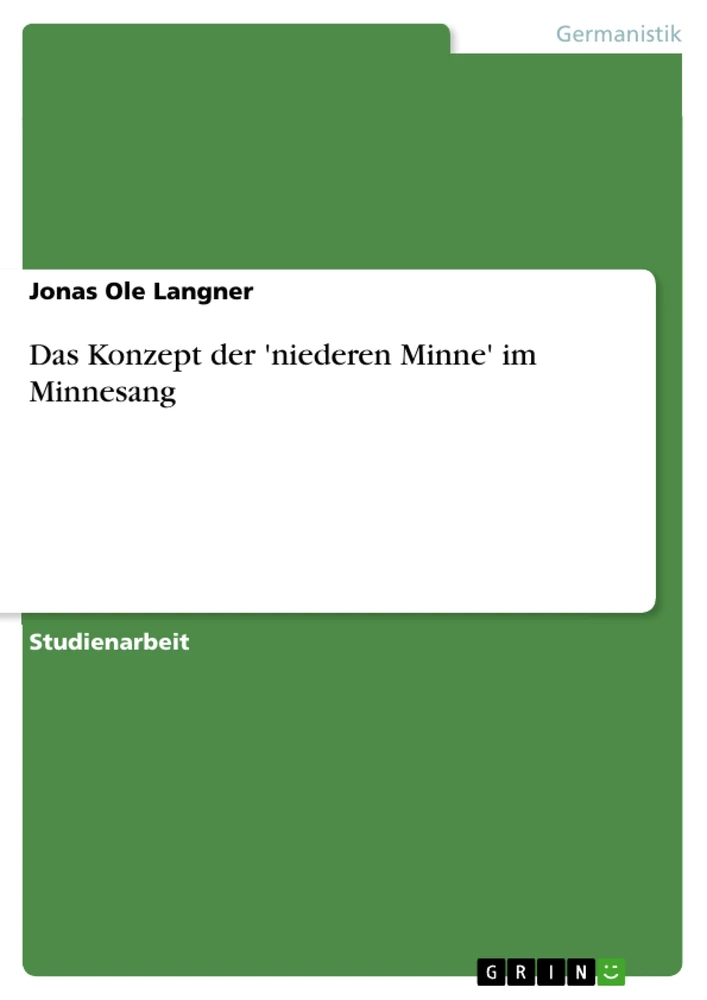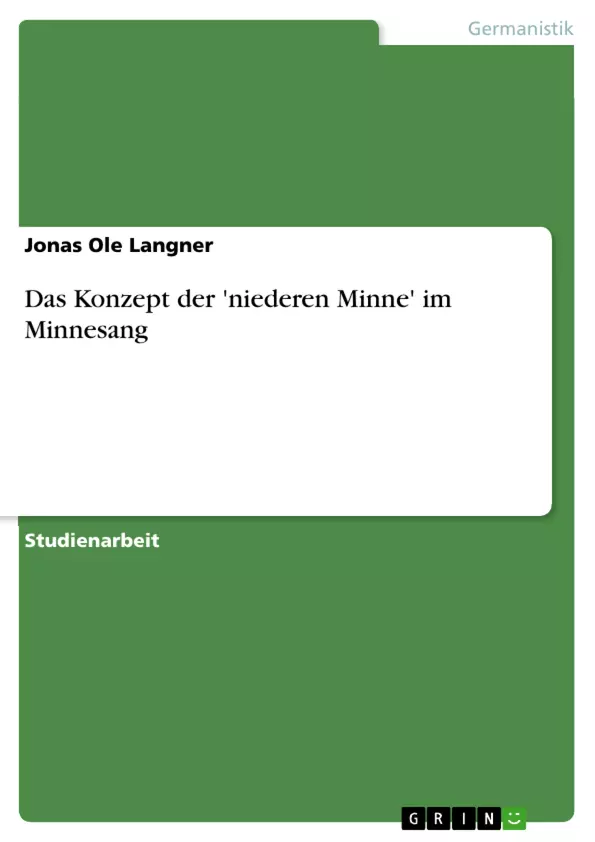Die Vorstellung vieler vom Minnesang ist geprägt durch die so genannte‚ hohe Minne’ bzw. die Minnekanzone. In ihr glaubt man die Beschreibung des höfischen Liebesideals zu finden und läuft Gefahr dieses eins zu eins auf die damalige höfische Gesellschaft zu übertragen, ohne zu wissen, ob dem wirklich so war. Beeinflusst ist dieses Empfinden durch Sammlungen von Minneliedern, in denen sich vorherrschend Kanzonen, und kaum andere Gattungstypen, befinden. Außerdem wird das Augenmerk in der Schule hauptsächlich auf die ‚hohe Minne’ gelegt und die Forschungsliteratur beschäftigt sich in der Mehrzahl ebenfalls mit ihr. Da verwundert es, dass die Kanzone bzw. das ‚minneliet’ in einer Spottstrophe Reinmars des Fiedlers nicht genannt wird, obwohl er ansonsten keine andere Gattung unerwähnt zu lassen scheint. Bedeutet dies, dass die Minnekanzone von ihren Zeitgenossen doch nicht als so dominierend wahrgenommen wurde oder war es andernfalls selbstverständlich, dass sie zum Repertoire eines jeden Minnesängers gehörte? Doch gibt es auch andere Gattungstypen. Vom Konzept der ‚hohen Minne’ scheint sich zumindest allein begrifflich das der ‚niederen’ abzugrenzen. Wenn die Dominanz der Kanzone im Minnesang bestätigt werden kann, handelt es sich bei der ‚niederen Minne’ folglich um eine Kategorie, zu der weniger Minnelieder gezählt werden können. Dass solche Lieder in der Aufzählung Reinmars keine Erwähnung finden, ist nicht verwunderlich, da es sich hier um ein Liebeskonzept und nicht um eine Gattung handelt. Da in der vorliegenden Arbeit dem Konzept der ‚niederen Minne’ im Minnesang und dem, was sich dahinter verbirgt, auf den Grund gegangen werden soll, ist es hilfreich, dieses in Abgrenzung zur ‚hohen Minne’ zu definieren. Letztere ist folgendermaßen gekennzeichnet: In den Liedern der Hohen Minne äußert sich […] ein männliches lyrisches Ich. Das Werberitual ist […] eingeengt auf eine bestimmte Konstellation - auf die Werbung um eine Frau, die der Werbende als gleichgültig, hochmütig, unnahbar, abweisend, ja feindselig erfährt. Er stilisiert sie als Minneherrin, erhebt sie in eine dominierende ethische Position, entrückt sie geradezu […]. Diesem Idol unterwirft sich der Mann als demütigerdienstman [sic!]. Er bittet sie, als seine >Herrin<, seinendienstanzunehmen, in der ständigen Hoffnung auf letztlichen Lohn für seine Treue. Aus dieser Unterwerfungsgeste resultieren ethische und gesellschaftliche Werte: Steigerung des Lebensgefühls und Anerkennung in der Gesellschaft.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II.1 Beschreibung der niederen Minne' im Minnesang: Walthers ,,Aller werdekeit ein füegerinne“ (46,32)
- II.2 Forschungsdiskussion zum Konzept der, niederen Minne' im Minnesang
- II.3 Überprüfung der Forschungsthesen an Hand von Walthers ,,Nemt, frowe, disen kranz!“ (74,20)
- II.4 Diskurs über Liebe statt Konzepte von Liebe im Minnesang?
- III. Fazit und Perspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Seminararbeit befasst sich mit dem Konzept der „niederen Minne“ im Minnesang und untersucht, wie sich dieses Konzept von der „hohen Minne“ abgrenzt und in den Liedern der Minnesänger manifestiert. Die Arbeit geht der Frage nach, ob sich die niedere Minne als eigenständiges Konzept etablieren lässt und welche Bedeutung ihr in der Minnelyrik zukommt.
- Abgrenzung der „niederen Minne“ von der „hohen Minne“
- Analyse von Beispielen aus dem Minnesang
- Kritische Auseinandersetzung mit Forschungspositionen zum Konzept der „niederen Minne“
- Suche nach alternativen Interpretationsansätzen für das Konzept der „niederen Minne“
- Bedeutung des Konzepts der „niederen Minne“ im Kontext der mittelalterlichen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Konzepts der „niederen Minne“ ein und beleuchtet die Bedeutung der „hohen Minne“ im Kontext des Minnesangs. Dabei werden verschiedene Definitionen und Interpretationsansätze zur „hohen Minne“ dargestellt und die Notwendigkeit der Abgrenzung von der „niederen Minne“ betont. Das erste Kapitel analysiert Walthers Gedicht „Aller werdekeit ein füegerinne“ (46,32) und untersucht, wie sich das Konzept der „niederen Minne“ in diesem Text manifestiert. Das zweite Kapitel widmet sich der Forschungsliteratur zum Konzept der „niederen Minne“ und stellt verschiedene Standpunkte und Thesen gegenüber. Das dritte Kapitel überprüft die Gültigkeit der im zweiten Kapitel dargestellten Thesen an Hand von Walthers Gedicht „Nemt, frowe, disen kranz!“ (74,20). Das vierte Kapitel hinterfragt die Gültigkeit von Konzepten der Liebe im Minnesang und diskutiert die Möglichkeit, den Diskurs über Liebe im Vordergrund zu stellen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Minnesang, insbesondere mit dem Konzept der „niederen Minne“ im Vergleich zur „hohen Minne“. Dabei werden die Werke Walthers von der Vogelweide, die Gattungen der Minnekanzone und des „Minneliets“, sowie die Minnelyrik des Mittelalters in den Fokus genommen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen „hoher Minne“ und „niederer Minne“?
Hohe Minne beschreibt die unerreichbare Werbung um eine unnahbare Herrin, während die niedere Minne ein Liebeskonzept darstellt, das stärker auf Gegenseitigkeit und Erfüllung beruht.
Welche Rolle spielt Walther von der Vogelweide in dieser Debatte?
Walthers Lieder wie „Aller werdekeit ein füegerinne“ und „Nemt, frowe, disen kranz!“ dienen als zentrale Beispiele zur Analyse des Konzepts der niederen Minne.
Ist die niedere Minne eine eigene literarische Gattung?
Nein, es handelt sich nicht um eine Gattung wie die Kanzone, sondern um ein Liebeskonzept, das sich innerhalb verschiedener Gattungstypen manifestieren kann.
Warum dominiert die „hohe Minne“ oft unser Bild vom Minnesang?
Dies liegt vor allem an der Auswahl in Liederhandschriften und der starken Fokussierung der Forschung und des Schulunterrichts auf dieses Ideal.
Was kritisiert die Forschungsdiskussion am Begriff der „niederen Minne“?
Die Arbeit hinterfragt, ob die Kategorisierung in „hoch“ und „nieder“ den tatsächlichen Diskurs über Liebe im Mittelalter ausreichend widerspiegelt.
- Quote paper
- Jonas Ole Langner (Author), 2006, Das Konzept der 'niederen Minne' im Minnesang, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58556