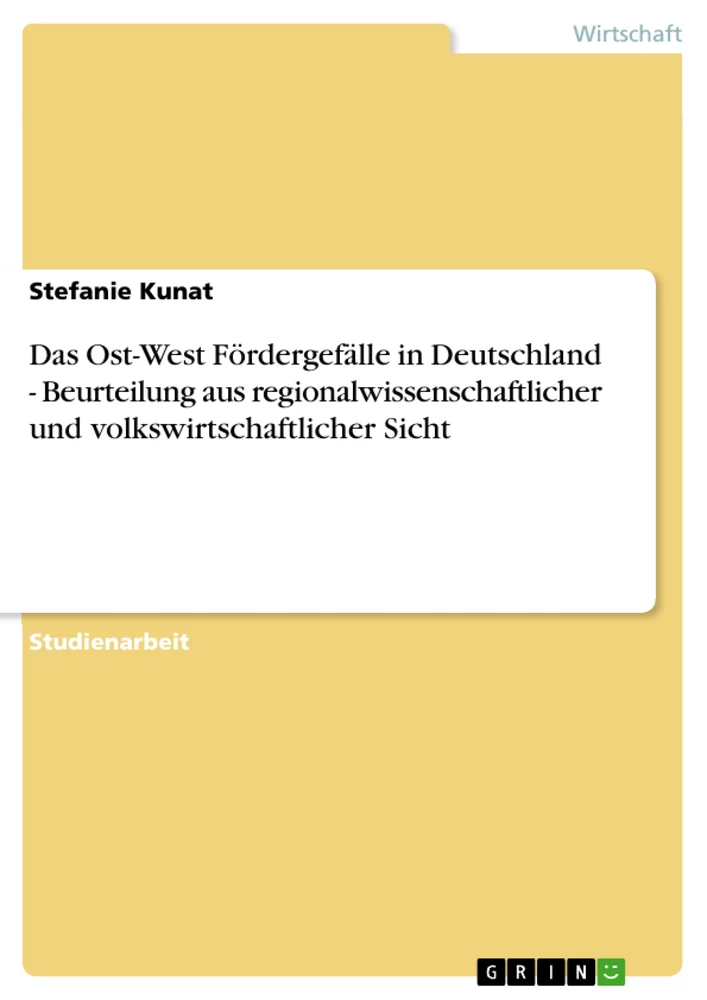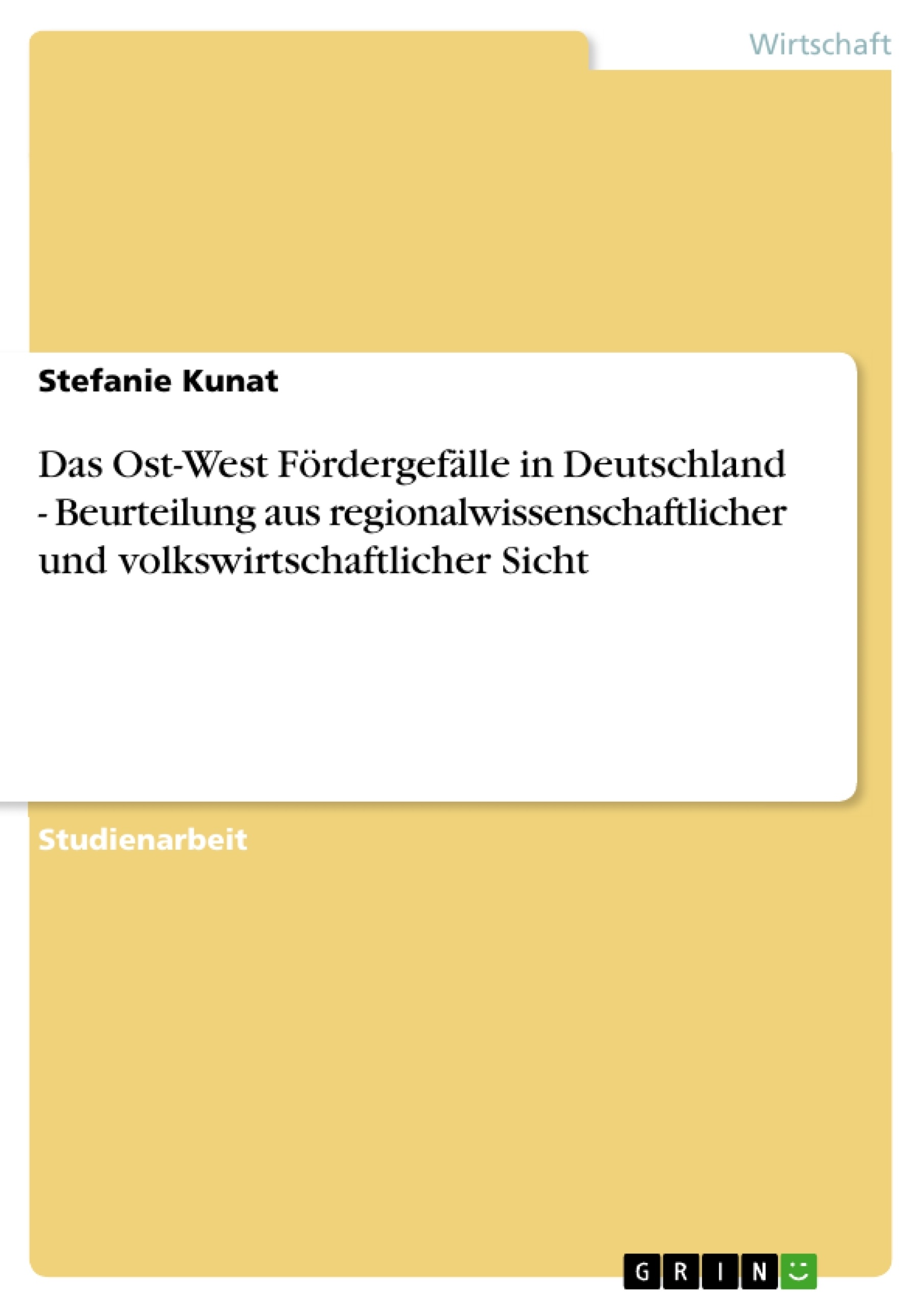Auch fast 15 Jahre nach der Wiedervereinigung ist die Bundesrepublik Deutschland ein „Staat mit zwei Teilgesellschaften“ und das obwohl in der gesamten Zeit enorme Transferzahlungen von West nach Ostdeutschland stattgefunden haben. 2003 hat das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) eine Berechnung der Transferleistungen für die neuen Länder durchgeführt. Für den Zeitraum 1991 bis 2003 schätzt das IWH hiernach die Höhe des Bruttotransfers auf ca. 1,25 Billionen Euro, die Höhe des Nettotransfers auf etwa 900 Mrd. Euro. Dabei betragen die Zahlungen nur für das Jahr 2003 116 Mrd. brutto und 83 Mrd. netto.
Nachdem der Solidarpakt I Ende 2004 ausgelaufen ist, haben sich Bundesregierung und die Bundesländer am 23. Juni 2001 auf den Solidarpakt II geeinigt, der von 2005 bis 2019 gelten soll. Diese Einigung zeigt, dass das Projekt „Aufbau Ost“ keineswegs erfolgreich abgeschlossen ist und somit weiterhin ein wichtiges politisches Thema bleibt. Darüber hinaus gibt es Forderungen, die eine „Sonderwirtschaftszone Ost“ fordern. Andere dagegen lehnen diese strikte Abgrenzung ab und fordern vielmehr verstärkt auf investive statt soziale Förderung zu achten, um endlich einen Wirtschaftsimpuls in den neuen Bundesländern zu setzen. Angesichts dieser unterschiedlichen Meinungen sowie der schlechten wirtschaftlichen Lage, in der sich Deutschland zur Zeit befindet, ist das Ost-West- Fördergefälle zweifelsohne ein sehr wichtiges Thema der aktuellen Tagespolitik.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Ost-West-Fördergefälle in Deutschland
- 2.1. Förderung nach der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW)
- 2.2. Förderung nach den EU-Strukturfonds
- 2.3. Förderung nach dem Solidarpakt II
- 2.4. Förderung nach dem Länderfinanzausgleich
- 3. Beurteilung einer verstärkten „Ost-Förderung“
- 3.1. Konzentration der Förderpolitik: Clusterförderung
- 3.2. „Sonderwirtschaftszone Ost“
- 3.3. Verstärkte Förderung gewerblicher Investitionen
- 4. Fazit
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert das Ost-West-Fördergefälle in Deutschland aus regionalwissenschaftlicher und volkswirtschaftlicher Perspektive. Sie beleuchtet die Entwicklungen seit der Wiedervereinigung und untersucht die verschiedenen Förderprogramme, die zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in den neuen Bundesländern eingesetzt werden.
- Die Analyse des Ost-West-Fördergefälles anhand verschiedener Förderprogramme.
- Die Beurteilung der Wirksamkeit der „Ost-Förderung“ aus volkswirtschaftlicher und regionalpolitischer Sicht.
- Die Untersuchung von Ansätzen zur Optimierung der Mittelverwendung.
- Die Diskussion über die Notwendigkeit einer „Sonderwirtschaftszone Ost“ und der verstärkten Förderung gewerblicher Investitionen.
- Die Herausforderungen und Chancen, die mit dem Ost-West-Fördergefälle verbunden sind.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet das Ost-West-Fördergefälle anhand einzelner Förderprogramme, wie der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW), der EU-Strukturfonds, des Solidarpakts II und des Länderfinanzausgleichs. Es werden die historischen Hintergründe der unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklung in Ost- und Westdeutschland erläutert und die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Strukturpolitik für die neuen Bundesländer aufgezeigt.
Kapitel 3 widmet sich einer Beurteilung der verstärkten „Ost-Förderung“ und beleuchtet verschiedene Ansätze zur Veränderung der Mittelverwendung aus volkswirtschaftlicher und regionalpolitischer Sicht. Es werden die Möglichkeiten einer Clusterförderung, der Einrichtung einer „Sonderwirtschaftszone Ost“ und der verstärkten Förderung gewerblicher Investitionen diskutiert.
Schlüsselwörter
Ost-West-Fördergefälle, Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, EU-Strukturfonds, Solidarpakt II, Länderfinanzausgleich, Clusterförderung, „Sonderwirtschaftszone Ost“, gewerbliche Investitionen, regionalwirtschaftliche Entwicklung, volkswirtschaftliche Analyse, Wiedervereinigung, Strukturpolitik, Ostdeutschland, Westdeutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Ost-West-Fördergefälle"?
Es beschreibt die massiven finanziellen Transferleistungen von West- nach Ostdeutschland seit der Wiedervereinigung, um die wirtschaftlichen Unterschiede auszugleichen.
Was ist der Solidarpakt II?
Der Solidarpakt II ist eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, die von 2005 bis 2019 galt, um den weiteren "Aufbau Ost" finanziell abzusichern.
Welche Rolle spielt die Clusterförderung?
Die Clusterförderung ist ein Ansatz zur Optimierung der Mittelverwendung, bei dem gezielt regionale wirtschaftliche Schwerpunkte (Cluster) gefördert werden, um Innovationsimpulse zu setzen.
Was versteht man unter einer "Sonderwirtschaftszone Ost"?
Es handelt sich um einen politischen Vorschlag, Ostdeutschland durch besondere steuerliche oder rechtliche Bedingungen attraktiver für Investitionen zu machen.
Wie hoch waren die Transferleistungen bis 2003?
Das IWH schätzt den Bruttotransfer von 1991 bis 2003 auf ca. 1,25 Billionen Euro, mit einem Nettotransfer von etwa 900 Milliarden Euro.
- Quote paper
- Stefanie Kunat (Author), 2005, Das Ost-West Fördergefälle in Deutschland - Beurteilung aus regionalwissenschaftlicher und volkswirtschaftlicher Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58568