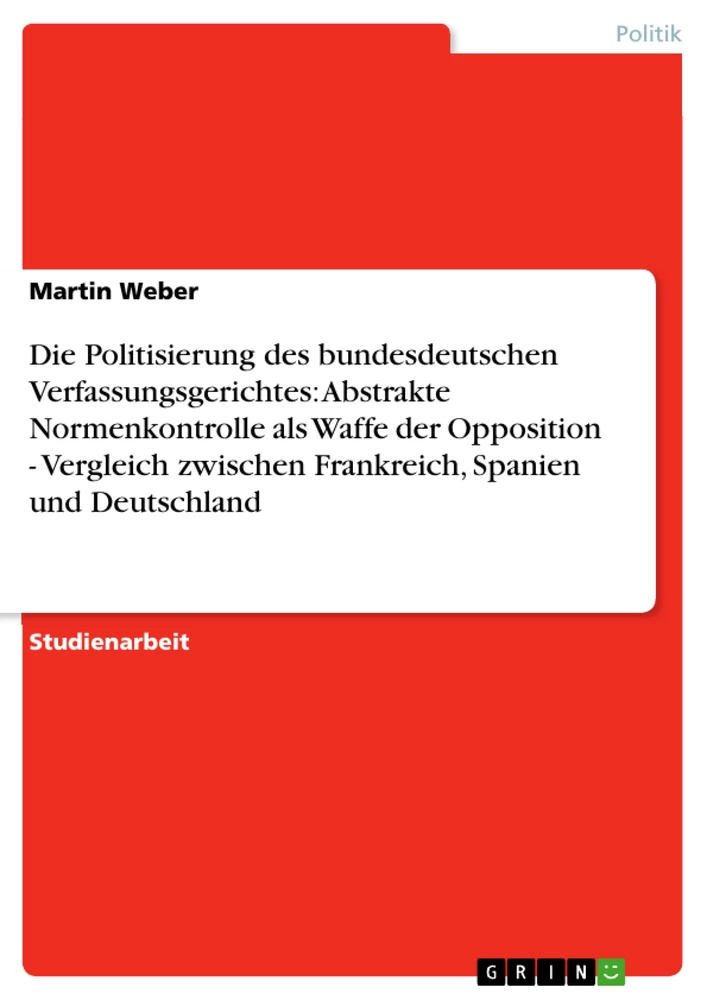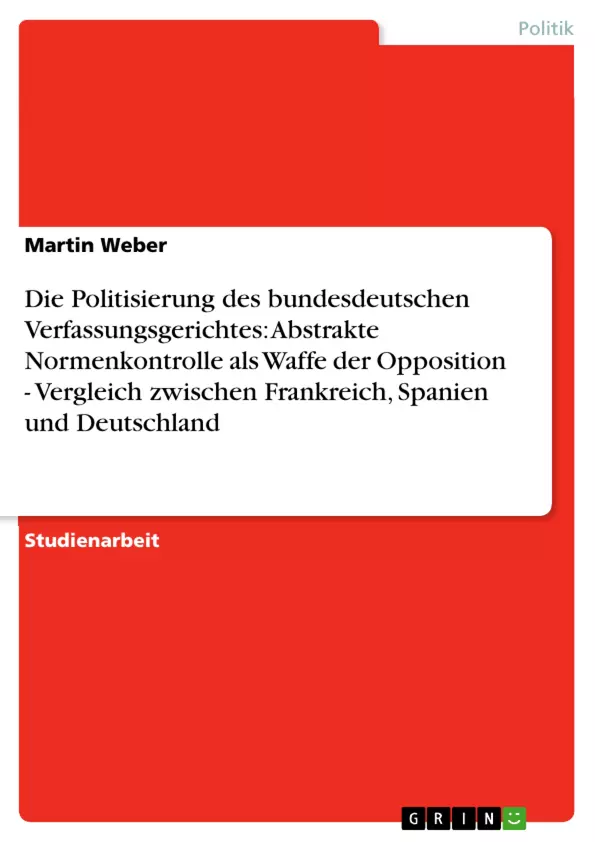In Deutschland wird dem Bundesverfassungsgericht häufig vorgeworfen, es fungiere als „verlängerter Arm der Opposition“ , mache Politik und lege dem Gesetzgeber Ketten an. Ob Vorwürfe dieser Art gerechtfertigt sind, sei dahingestellt. Wichtig hingegen ist, dass selbst Jutta Limbach als ehemalige Präsidentin des Gerichts, feststellt, „(...) dass das Bundesverfassungsgericht einen herausragenden Faktor im politischen Prozess bildet.“ Die besondere Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts ist also unbestritten wie auch die wachsende Bedeutung der Verfassungsgerichtsbarkeit in westlichen Demokratien generell in der Literatur unbestritten ist. Jedoch existieren wesentliche nationale Unterschiede hinsichtlich des Ausmaßes dieser Bedeutung.
Im folgenden werde ich zunächst allgemein auf die Gründe eingehen, die für die wachsende Bedeutung der Verfassungsgerichtsbarkeit in westlichen Demokratien verantwortlich sind und den Zusammenhang zwischen Politisierung von Verfassungsgerichten und Judizialisierung der Politik darstellen. Ich werde mich dann speziell auf die Frage konzentrieren, inwieweit insbesondere die abstrakte Normenkontrolle durch die parlamentarische Opposition in den untersuchten Ländern als „Waffe“ genutzt, parlamentarische Entscheidungsprozesse in Verfassungsgerichte verlagert werden und somit zur Politisierung letzterer beitragen. Abschließend werde ich dann auf Ursachen der nationalen Unterschiede bei der Nutzung dieses Verfahrens eingehen und Erklärungsansätze darlegen.
Aufgrund folgender Kriterien habe ich die Länder Deutschland, Spanien und Frankreich ausgewählt: Zunächst handelt es sich um europäische Staaten, die alle das europäische Modell der Verfassungsgerichtsbarkeit verwirklicht haben. Diese Staaten besitzen alle eine Institution, die die exklusive und abschließende Rechtsprechungshoheit über verfassungsrechtliche Fragen hat. Mithin handelt es sich um das Modell der zentralisierten verfassungsgerichtlichen Überprüfung von Gesetzen. Die Entscheidungen dieser Institutionen sind im Gegensatz zum dezentralen US-amerikanischen Modell nicht nur für einen konkreten Rechtsstreit, sondern allgemein bindend. Zudem kennen diese Länder alle das Institut der abstrakten Normenkontrolle, zu dessen Einleitung ein Teil der Legislative berechtigt ist. Des Weiteren sind sie hinsichtlich ihrer Staatsorganisation (Föderalismus, Quasi-Föderalismus, Zentralstaat) sowie hinsichtlich der Ausgestaltung ihres Wahlrechts verschieden.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Definition der Begriffe Politisierung und Judizialisierung
- 2. Gründe für die wachsende Bedeutung der Verfassungsgerichtsbarkeit in den westlichen Demokratien
- 2.1 Verfassungsgerichtsbarkeit als unverzichtbares Korrelat zur Herrschaft des Mehrheitsprinzips
- 2.2 Politisierung und Judizialisierung als sich gegenseitig verstärkende Phänomene
- 3. Abstrakte Normenkontrolle als „Waffe“ der Opposition: Bilanz in Deutschland, Frankreich und Spanien
- 3.1 Die abstrakte Normenkontrolle in Deutschland
- 3.2 Die abstrakte Normenkontrolle in Frankreich
- 3.3 Die abstrakte Normenkontrolle in Spanien
- 4. Ursachen für nationale Variationen
- 5. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob das Ausmaß der Politisierung des bundesdeutschen Verfassungsgerichtes einer internationalen Logik entspricht. Insbesondere wird die abstrakte Normenkontrolle als Werkzeug der Opposition in Deutschland, Frankreich und Spanien analysiert, um herauszufinden, inwieweit sie zu einer Verlagerung parlamentarischer Entscheidungsprozesse in verfassungsgerichtliche Verfahren führt.
- Politisierung von Verfassungsgerichten
- Judizialisierung der Politik
- Abstrakte Normenkontrolle als „Waffe“ der Opposition
- Nationale Unterschiede in der Nutzung der abstrakten Normenkontrolle
- Zusammenhang zwischen Politisierung und Judizialisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas und die Problematik des wachsenden Einflusses von Verfassungsgerichten in westlichen Demokratien dar. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die Auswahl der untersuchten Länder. Kapitel 1 definiert die zentralen Begriffe Politisierung und Judizialisierung, während Kapitel 2 die Gründe für die wachsende Bedeutung der Verfassungsgerichtsbarkeit in westlichen Demokratien beleuchtet. Kapitel 3 analysiert die Rolle der abstrakten Normenkontrolle in den drei untersuchten Ländern und ihre Nutzung als „Waffe“ der Opposition. Kapitel 4 untersucht die Ursachen für nationale Unterschiede in der Nutzung dieses Verfahrens. Die Schlussfolgerung fasst die Ergebnisse zusammen und präsentiert die Schlussfolgerungen der Untersuchung.
Schlüsselwörter
Politisierung, Judizialisierung, Verfassungsgerichtsbarkeit, abstrakte Normenkontrolle, Opposition, Deutschland, Frankreich, Spanien, Vergleichende Politikwissenschaft, Staatsorganisation, Wahlrecht.
Häufig gestellte Fragen
Wird das Bundesverfassungsgericht politisiert?
Kritiker werfen dem Gericht oft vor, als "verlängerter Arm der Opposition" zu agieren; die Arbeit untersucht diesen Vorwurf im internationalen Vergleich.
Was ist "abstrakte Normenkontrolle"?
Dies ist ein Verfahren, bei dem Gesetze unabhängig von einem konkreten Rechtsstreit auf ihre Verfassungsmäßigkeit geprüft werden, oft eingeleitet durch die parlamentarische Opposition.
Was bedeutet Judizialisierung der Politik?
Es beschreibt die Verlagerung von politischen Entscheidungsprozessen in den Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit.
Wie unterscheidet sich die Situation in Deutschland, Frankreich und Spanien?
Obwohl alle drei Länder das europäische Modell der Verfassungsgerichtsbarkeit nutzen, gibt es nationale Unterschiede in der Häufigkeit und Intensität der Nutzung als "politische Waffe".
Warum nutzen Oppositionsparteien die Verfassungsgerichte?
Die abstrakte Normenkontrolle dient der Opposition als Korrelat zur Herrschaft des Mehrheitsprinzips, um Regierungsentscheidungen rechtlich anzufechten.
- Quote paper
- Martin Weber (Author), 2003, Die Politisierung des bundesdeutschen Verfassungsgerichtes: Abstrakte Normenkontrolle als Waffe der Opposition - Vergleich zwischen Frankreich, Spanien und Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58584