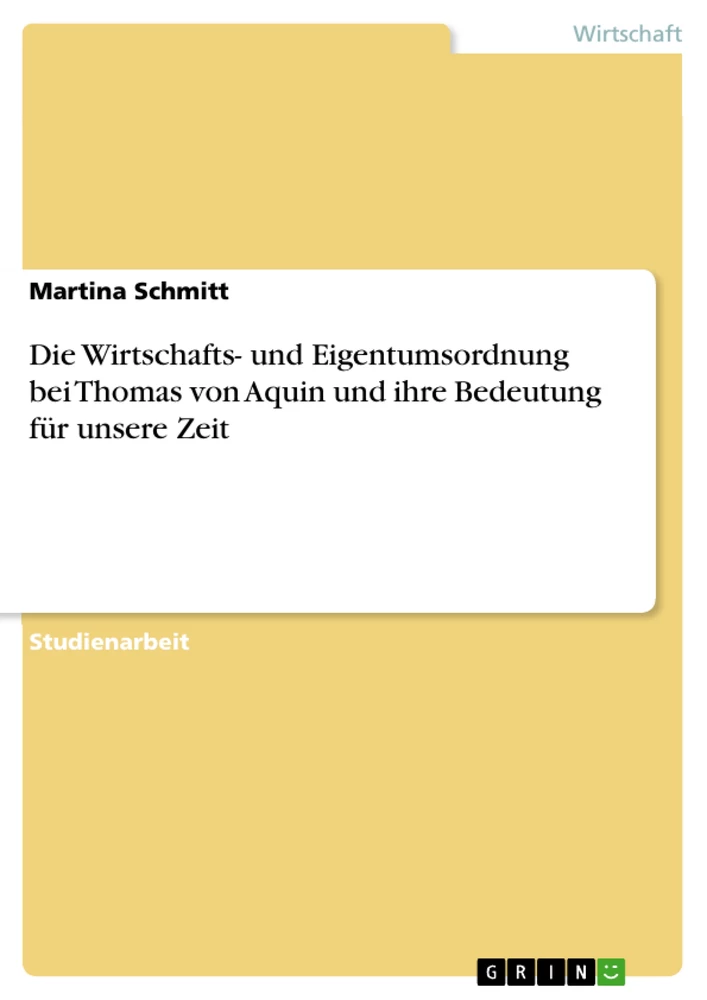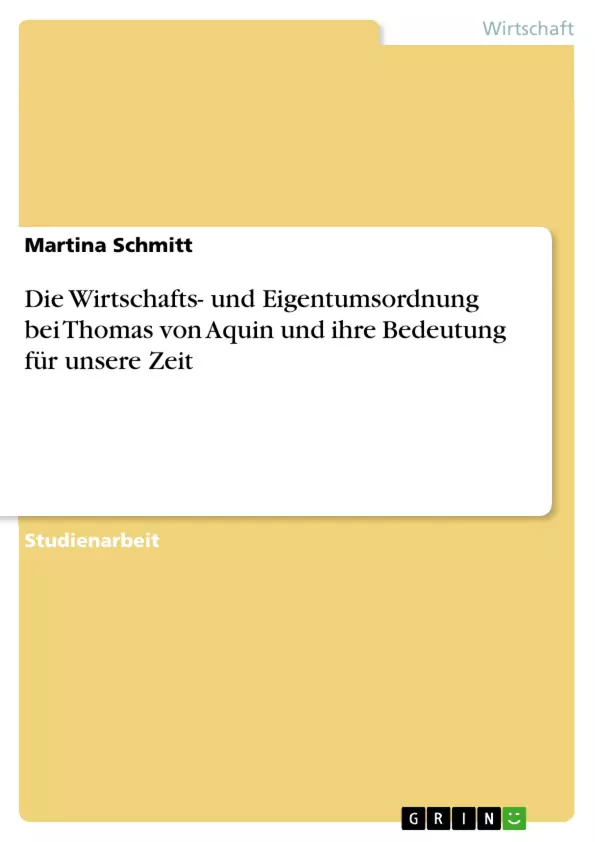Thomas von Aquin zählt zu den bedeutendsten Philosophen und Theologen des Mittelalters. Er wurde Ende 1224 oder Anfang 1225 in Roccasecca bei Neapel geboren. Seine Familie, die Grafen von Aquino, gehörte zum Adel. Im Alter von fünf Jahren kam er zur Ausbildung in das Benediktinerkloster von Monte Cassino. 1239 begann er in Neapel mit dem Studium der freien Künste, das sowohl logisch-grammatikalische als auch mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer umfaßte. Während seiner Studienzeit trat er dort dem Dominikanerorden bei. Ab 1245 setzte er das Studium der Theologie und Philosophie in Paris und später in Köln als Schüler von Albertus Magnus fort. Nach Beendigung seines Studiums im Jahr 1252 lehrte er Theologie an verschiedenen Universitäten in Italien und in Paris. In dieser Zeit entstanden seine bekanntesten Werke: Die Summa theologica, die staatsphilosophische Schrift De regimine principum und Kommentare zu den Schriften des Aristoteles. Er starb 1274 in der Zisternenabtei Fossanuova in Italien. 1323 wurde er heiliggesprochen. Thomas von Aquin ist einer der bekanntesten Vertreter der Hochscholastik. Als Scholastik bezeichnet man die Philosophie der christlichen Philosophen des Hochmittelalters, in der diese versuchen, ein vollständiges philosophisches System zu entwickeln, das die christliche Glaubenslehre und die Philosophie der aristotelischen Schule vereint. Zur Entstehung dieser Epoche haben entscheidend die zunehmende Gründung von Universitäten, die verstärkte und konkurrierende wissenschaftliche Arbeit des Franziskaner- und Dominikanerordens und die Verbreitung der Werke des Aristoteles durch ihre Übersetzung ins Lateinische beigetragen. Hieraus ergibt sich der große Einfluß der Philosophie des Aristoteles auf das Denken der Scholastik. Zentrale ökonomische Fragestellungen, die in der scholastischen Lehre untersucht werden, befassen sich mit dem gerechten Preis, dem Wert des Geldes und dem Zinsverbot. Die Absicht der Scholastiker ist hierbei, die wirtschaftlichen Gegebenheiten in Einklang mit der christlichen Lehre zu bringen. Sie streben nicht die Erschließung wirtschaftlicher Zusammenhänge oder einer Wirtschaftsordnung an, sondern formulieren stattdessen Grundsätze für das wirtschaftliche Verhalten, die mit dem christlichen Glauben zu vereinbaren sind. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die ökonomisch relevanten Inhalte der Lehre des Thomas von Aquin darzustellen und ihre Bedeutung für die heutige Zeit aufzuzeigen.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung: Historische Positionierung des Thomas von Aquin
- 2 Die Eigentumsordnung des Thomas von Aquin
- 2.1 Begriff und Arten materieller Güter
- 2.2 Das Privateigentum
- 2.2.1 Die Notwendigkeit des Privateigentums
- 2.2.2 Der Gebrauch des Eigentums
- 2.3 Soziale Pflichten des Eigentums
- 3 Die Wirtschaftsordnung des Thomas von Aquin
- 3.1 Die Prämissen und Ziele des Wirtschaftens
- 3.2 Die Arbeit
- 3.2.1 Der Begriff der Arbeit
- 3.2.2 Arbeitspflicht und Arbeitsteilung
- 3.2.3 Die verschiedenen Erwerbsarten und ihre Beurteilung
- 3.3 Der gerechte Preis
- 3.3.1 Die Bestimmung des Wertes
- 3.3.2 Die Ermittlung des gerechten Preises
- 3.3.3 Abweichungen vom gerechten Preis
- 3.4 Geld und Zinsen
- 3.4.1 Die Bedeutung des Geldes
- 3.4.2 Das Zinsverbot
- 3.4.3 Abweichungen vom Zinsverbot
- 4 Die Bedeutung der Lehre des Thomas von Aquin für die heutige Zeit
- 4.1 Die Bedeutung für die Haltung der Kirche
- 4.2 Die Bedeutung für die Beurteilung einer Wirtschaftsordnung aus heutiger Sicht
- 4.3 Die Bedeutung für die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung
- 5 Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung der ökonomisch relevanten Aspekte der Lehre Thomas von Aquins und die Aufarbeitung ihrer Bedeutung für die heutige Zeit. Die Arbeit untersucht die Konzepte des Privateigentums, der sozialen Verantwortung im Umgang mit Eigentum, sowie die von Aquin vorgeschlagene Wirtschaftsordnung mit ihren Elementen wie gerechter Preis und Zinsverbot.
- Die Eigentumsordnung nach Thomas von Aquin und deren ethische Implikationen
- Die Wirtschaftsordnung bei Thomas von Aquin: Gerechter Preis und Zinsverbot
- Die Bedeutung der Arbeit und verschiedener Erwerbsarten in Aquins Wirtschaftslehre
- Die Relevanz von Aquins Lehre für die heutige Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung
- Die Verbindung von christlichem Glauben und wirtschaftlichem Handeln bei Thomas von Aquin
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Historische Positionierung des Thomas von Aquin: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über das Leben und Wirken Thomas von Aquins, seinen Platz in der Hochscholastik und den Kontext seiner ökonomischen Schriften. Es beschreibt Aquins Studium, seine Werke und seine Bedeutung als Vertreter der Scholastik, die versucht, christliche Glaubenslehre und aristotelische Philosophie zu vereinen. Der Fokus liegt auf dem historischen Umfeld, das Aquins ökonomische Überlegungen prägte.
2 Die Eigentumsordnung des Thomas von Aquin: Dieses Kapitel befasst sich mit Aquins Verständnis von Privateigentum. Es erläutert seine Definition von Eigentum als „Herrschaft über eine Sache“ und argumentiert, dass Privateigentum zwar nicht direkt aus dem Naturrecht abgeleitet ist, aber mit diesem vereinbar und ein essentieller Bestandteil der menschlichen Rechtsordnung ist. Das Kapitel untersucht die Notwendigkeit des Privateigentums für eine geordnete Gesellschaft und die damit verbundenen sozialen Pflichten der Eigentümer. Die verschiedenen Arten materieller Güter werden differenziert dargestellt, mit besonderer Berücksichtigung des Unterschieds zwischen natürlichen und künstlichen Gütern und der Rolle des Geldes.
3 Die Wirtschaftsordnung des Thomas von Aquin: Dieses Kapitel präsentiert Aquins Wirtschaftsordnung, die eng mit seinen ethischen Prinzipien verbunden ist. Es behandelt seine Vorstellungen zum gerechten Preis, dem Zinsverbot und die Beurteilung verschiedener Erwerbsarten. Die Diskussion über den gerechten Preis beinhaltet die Bestimmung des Wertes von Gütern und die Ermittlung eines fairen Preises, unter Berücksichtigung der Vermeidung von Ausbeutung. Die Behandlung des Zinsverbots wird im Kontext der moralischen und ethischen Aspekte des Wirtschaftens eingeordnet. Schließlich werden verschiedene Erwerbsarten auf ihre moralische Vertretbarkeit hin untersucht.
Schlüsselwörter
Thomas von Aquin, Scholastik, Privateigentum, Wirtschaftsordnung, gerechter Preis, Zinsverbot, Arbeit, Erwerbsarten, soziale Gerechtigkeit, Naturrecht, christliche Ethik, Wirtschaftsmoral.
Häufig gestellte Fragen zu: Die Wirtschaftslehre des Thomas von Aquin
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die ökonomisch relevanten Aspekte der Lehre Thomas von Aquins und deren Bedeutung für die heutige Zeit. Schwerpunkte sind Aquins Konzepte von Privateigentum, sozialer Verantwortung im Umgang mit Eigentum, sowie seine Wirtschaftsordnung mit Elementen wie gerechtem Preis und Zinsverbot. Die Arbeit umfasst eine Einführung in das Leben und Wirken Thomas von Aquins, eine detaillierte Darstellung seiner Eigentums- und Wirtschaftsordnung sowie eine Diskussion über die Relevanz seiner Lehre für die heutige Zeit.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Aquins Verständnis von Privateigentum, einschließlich der Notwendigkeit und der sozialen Pflichten im Zusammenhang mit Eigentum; seine Wirtschaftsordnung mit Fokus auf gerechtem Preis und Zinsverbot; die Bedeutung der Arbeit und verschiedener Erwerbsarten in Aquins Wirtschaftslehre; die Relevanz von Aquins Lehre für die heutige Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung; und die Verbindung von christlichem Glauben und wirtschaftlichem Handeln bei Thomas von Aquin.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 bietet eine Einführung in das Leben und Wirken Thomas von Aquins; Kapitel 2 behandelt die Eigentumsordnung; Kapitel 3 die Wirtschaftsordnung (gerechter Preis, Zinsverbot, Arbeit, Erwerbsarten); Kapitel 4 diskutiert die Bedeutung von Aquins Lehre für die heutige Zeit; und Kapitel 5 bietet eine Schlussbemerkung. Jedes Kapitel ist in Unterkapitel mit spezifischen Themen unterteilt (z.B. Arten materieller Güter, Notwendigkeit des Privateigentums, Bestimmung des Wertes, etc.).
Was versteht Thomas von Aquin unter Privateigentum?
Aquin definiert Privateigentum als „Herrschaft über eine Sache“. Er sieht Privateigentum zwar nicht als direkt aus dem Naturrecht abgeleitet, aber als mit diesem vereinbar und als essentiellen Bestandteil einer geordneten Gesellschaft. Die Arbeit untersucht die Notwendigkeit von Privateigentum und die damit verbundenen sozialen Pflichten der Eigentümer.
Wie definiert Thomas von Aquin den „gerechten Preis“?
Die Arbeit erläutert Aquins Konzept des gerechten Preises, der eng mit seinen ethischen Prinzipien verbunden ist. Die Bestimmung des Wertes von Gütern und die Ermittlung eines fairen Preises, unter Berücksichtigung der Vermeidung von Ausbeutung, werden diskutiert. Die Arbeit untersucht auch Abweichungen vom gerechten Preis.
Welche Rolle spielt das Zinsverbot in Aquins Wirtschaftslehre?
Aquins Zinsverbot wird im Kontext der moralischen und ethischen Aspekte des Wirtschaftens eingeordnet. Die Arbeit untersucht die Gründe für das Zinsverbot und mögliche Ausnahmen oder Abweichungen von diesem Verbot.
Welche Bedeutung hat Aquins Lehre für die heutige Zeit?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Aquins Lehre für die heutige Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, einschließlich der Auswirkungen auf die Haltung der Kirche und die Beurteilung heutiger Wirtschaftsordnungen. Die tatsächliche Relevanz für die wirtschaftliche Entwicklung wird ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Thomas von Aquin, Scholastik, Privateigentum, Wirtschaftsordnung, gerechter Preis, Zinsverbot, Arbeit, Erwerbsarten, soziale Gerechtigkeit, Naturrecht, christliche Ethik, Wirtschaftsmoral.
- Citation du texte
- Martina Schmitt (Auteur), 2002, Die Wirtschafts- und Eigentumsordnung bei Thomas von Aquin und ihre Bedeutung für unsere Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5864