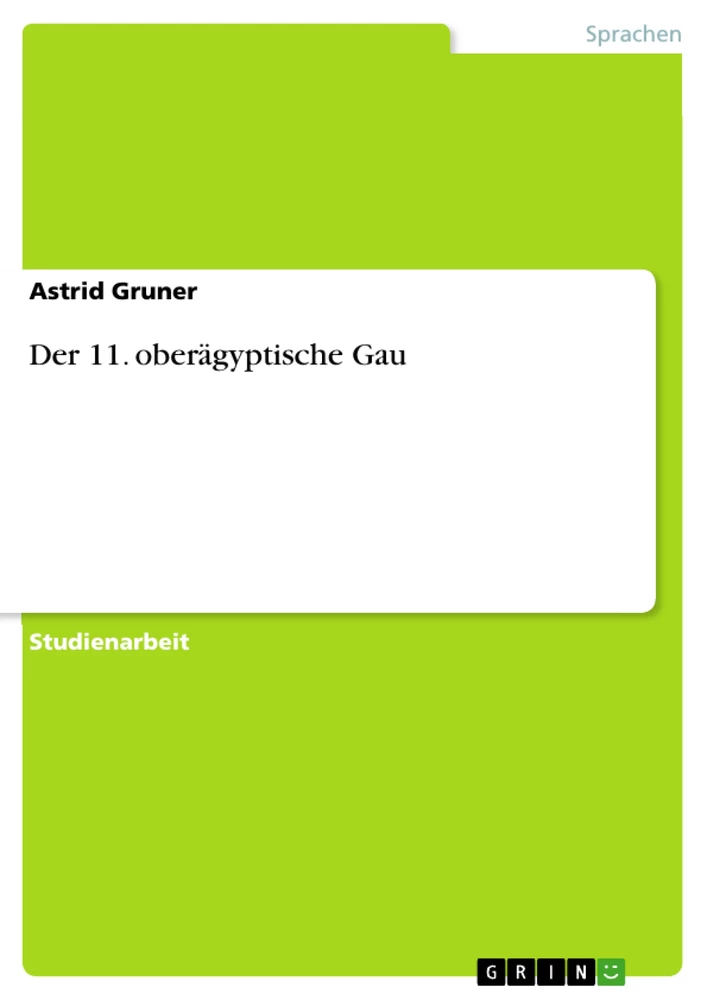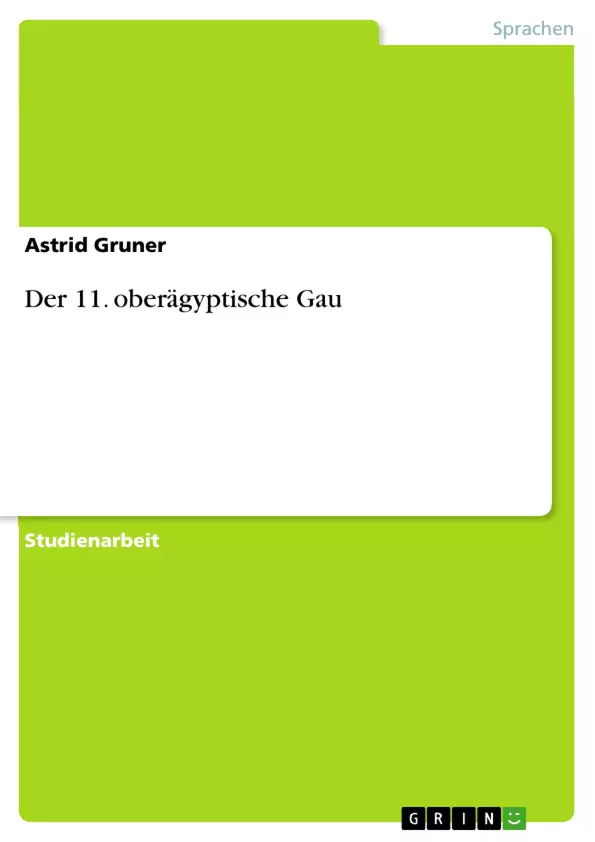Der 11. oberägyptische Gau wird als šЗj bezeichnet, was soviel wie „Der Geschlachtete“ bedeutet. Durch das Seth - Tier, welches mit oder ohne Standarte dargestellt werden kann, wird der Gau auch als Seth - Gau bezeichnet. Diese Bezeichnung ist jedoch nicht ganz korrekt, denn der Gott Seth wird šЗ gelesen und so beruht die Lesung des Gaunamens auf einer irrtümlichen Identifizierung des Seth - Tieres mit dem Schicksalsgott Schai (šЗj). Wenn man Helck Glauben schenkt, lag der kleinste Gau überhaupt ausschließlich auf der Westseite des Nils. Laut Gomaàs Theorie lag er jedoch auch auf dem Ostufer des Nils, welche er durch die vermeintliche Lokalisierung der Metropole mjqr untermauert. Denn auf dem Sesostriskiosk ist eine Stadt mjqr erwähnt und Gomaà fast sicher, dass sich diese bei oder an der Stelle der Stadt al - Maţmar befand (TAVO 66/1, S.250). Laut Helck sind alle ägyptischen Gaue ungefähr gleich groß gewesen, dass heißt sie hatten eine Länge von 3-4 jtrw. Doch beim 11. oberägyptischen Gau geht er davon aus, dass die Zahl der zerstörten Angabe auf dem Sesostriskiosk nicht größer als 2 jtrw (Einer) war. Vollständig würde die Angabe dann wie folgt lauten: 2 jtrw, 3 hЗ, 5 stЗt. Dadurch ergibt sich eine Gesamtlänge von 22,8305km, da die Nordgrenze des Gaues ca. 3km südlich von Assiut, und die Südgrenze ca. 2-3km nördlich von Abutîg verlief.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Darstellungen des Gauzeichens = Seth-Tier
- Belege für Darstellungen des š3
- Entwicklung
- Gaugötter und ihre Kultstätten
- Zusammenfassung
- Entwicklung der hieroglyphischen Schreibung von Schashotep
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem 11. oberägyptischen Gau, auch bekannt als „Der Geschlachtete“, und untersucht seine Geschichte, seine Entwicklung, seine Gaugötter und seine Kultstätten sowie die Entwicklung der hieroglyphischen Schreibung seines Namens. Der Fokus liegt dabei auf der Identifizierung und Analyse der verschiedenen Phasen und Veränderungen des Gaues über verschiedene Dynastien hinweg.
- Die Entwicklung des 11. oberägyptischen Gaues von der Entstehung bis zum Ende der Spätzeit
- Die Bedeutung des Seth-Tieres als Gauzeichen und seine Verbindung zum Gaugott Seth
- Die Rolle von Gaufürsten und die administrative Organisation des Gaues
- Die Lokalisierung der Gaumetropole mjqr und die Bedeutung der Stadt Schashotep
- Die Verehrung von Göttern im 11. oberägyptischen Gau und ihre Kultstätten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den 11. oberägyptischen Gau vor und erläutert seine Benennung, basierend auf dem Seth-Tier, das als Gauzeichen diente. Es wird auf die irrtümliche Identifizierung des Tieres mit dem Schicksalsgott Schai (š3j) hingewiesen. Das Kapitel beleuchtet zudem die geografische Lage und die Größe des Gaues.
Das Kapitel „Entwicklung“ befasst sich mit der historischen Entwicklung des Gaues von der Entstehung im Alten Reich bis zur Spätzeit. Es wird auf die administrative Organisation und die Rolle der Gaufürsten eingegangen und die verschiedenen Phasen der Gauverwaltung unter den Dynastien beleuchtet. Die Bedeutung von Schashotep als Gauhauptstadt wird erläutert.
Das Kapitel „Gaugötter und ihre Kultstätten“ befasst sich mit den Göttern, die im 11. oberägyptischen Gau verehrt wurden. Der Fokus liegt dabei auf der Rolle von Seth und seiner Verbindung zum Ort mjqr.
Schlüsselwörter
11. oberägyptischer Gau, Seth-Tier, š3j, Gauzeichen, Gauhauptstadt, Schashotep, mjqr, Gaufürsten, Verwaltung, Dynastie, Gottheiten, Kultstätten, Seth, Donner, Verwaltungsapparat, Oberägypten, 1. Zwischenzeit, Mittleres Reich, Neues Reich, Spätzeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Bezeichnung „š3j“ für den 11. oberägyptischen Gau?
Die Bezeichnung „š3j“ bedeutet wörtlich „Der Geschlachtete“. Der Name beruht auf einer historischen Identifizierung des Gauzeichens (Seth-Tier) mit dem Schicksalsgott Schai.
Wo lag der 11. oberägyptische Gau geografisch?
Nach Helck lag er ausschließlich auf der Westseite des Nils, zwischen Assiut und Abutîg. Andere Theorien (Gomaà) vermuten auch Ausläufer am Ostufer bei al-Maţmar.
Welche Stadt war die Metropole dieses Gaues?
Die Gaumetropole wird als „mjqr“ bezeichnet. Eine bedeutende Stadt und spätere Hauptstadt des Gaues war zudem Schashotep.
Welche Rolle spielte das Seth-Tier als Gauzeichen?
Das Seth-Tier diente als heraldisches Symbol des Gaues. Es wurde oft auf Standarten dargestellt und markierte die administrative und religiöse Zugehörigkeit des Bezirks.
Wie groß war die Ausdehnung des 11. Gaues?
Basierend auf dem Sesostriskiosk wird eine Gesamtlänge von etwa 22,8 km (ca. 2 jtrw) angenommen, was ihn zu einem der kleineren Gaue Oberägyptens macht.
- Quote paper
- Astrid Gruner (Author), 2004, Der 11. oberägyptische Gau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58664