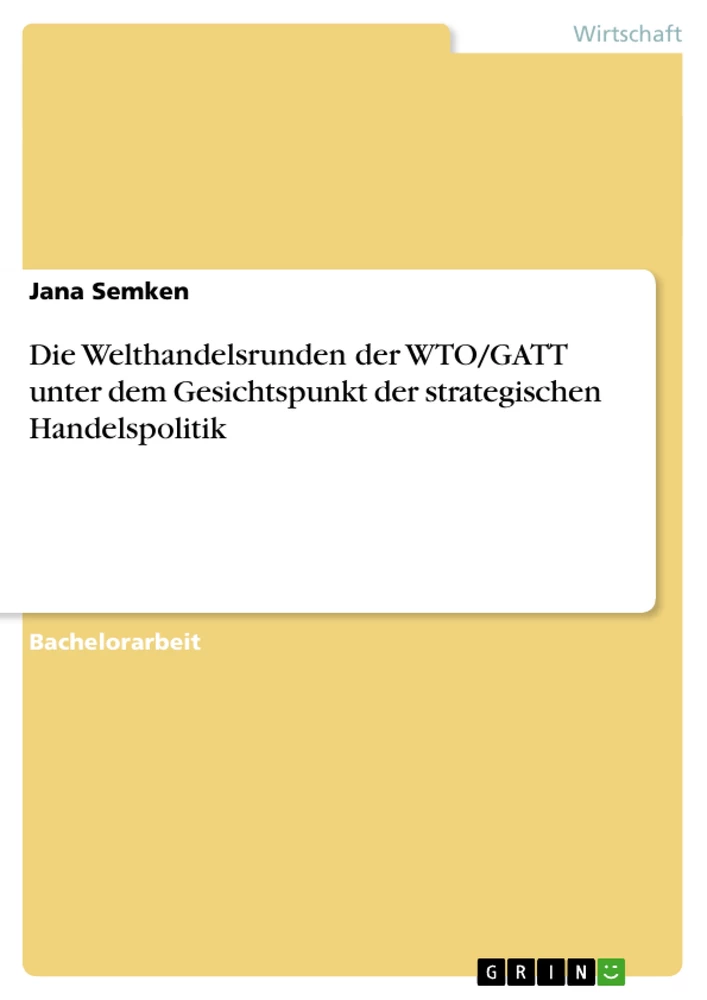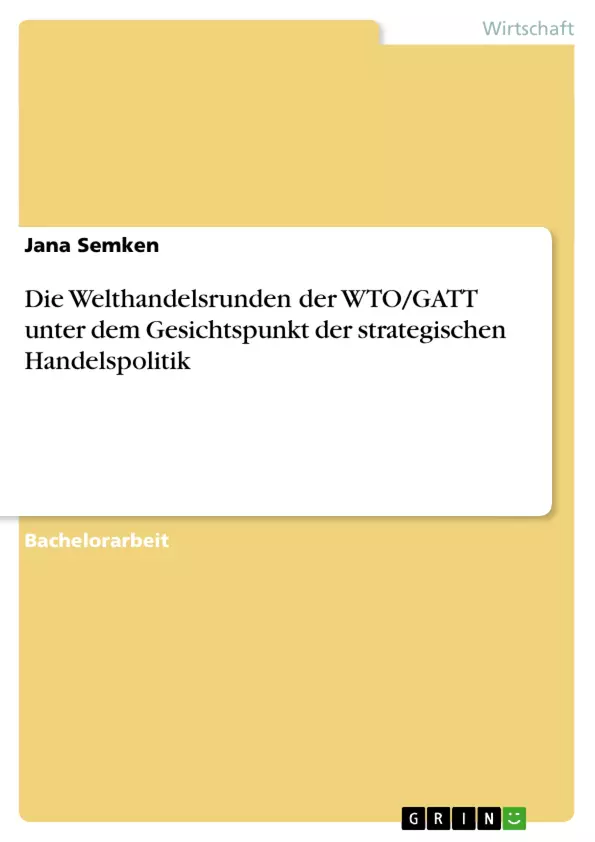Das General Agreement on Tariffs and Trade,kurz GATT, und dessen Nachfolger, die World Trade Organization,im Folgenden WTO, spielen in der Weltwirtschaft eine wichtige Rolle. Seit dem Bestehen des GATT 1947 und der nachfolgenden WTO, wurde in bisher neun Welthandelsrunden mit nunmehr 150 teilnehmenden Ländern versucht, Protektionismus zu reduzieren und eine globale Liberalisierung herbeizuführen. Die dabei erzielten Erfolge sind sichtbar. So sank beispielsweise der Zoll auf Industriegüter in den vergangenen 60 Jahren von über 40 Prozent auf unter 4 Prozent. Weiterhin wurden zwischen 1992 und 2003 nach empirischem Beleg 2,5 Millionen Arbeitsplätze im Binnenmarkt der Europäischen Union geschaffen. Dank des grenzfreien Binnenmarktes ist das Bruttoinlandsprodukt der Europäer 2002 um 164,5 Milliarden €, also etwa 1,8%, höher ausgefallen, die Wohlfahrt eines EU-Haushaltes hat sich im selben Zeitraum um durchschnittlich 5.700€ erhöht. Diese empirischen Ergebnisse bestätigen die theoretischen Resultate einer Handelsliberalisierung: Die Öffnung der Märkte, also die implizite Abschaffung jeglicher Handelshemmnisse, ermöglicht eine Wohlfahrtssteigerung und fördert das nationale Wachstum. Das Ziel des Freihandels gilt in der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie als wohlfahrtsoptimale Lösung (vgl. Abschnitt 3.1). Trotzdem liegt ein multilaterales Handelssystem mit dem Ziel der Marktöffnung nicht im Interesse eines jeden Landes. So wurde der Freihandel nach 60 Jahren GATT/WTO bis heute nie vollständig erreicht. Auch die Gründung von Zollunionen, die häufig als Richtungsweiser zum weltweiten Freihandel angesehen werden, bedeutet kein Ende des Protektionismus. Es drängt sich die Frage auf, warum der Abbau der Handelshemmnisse tarifärer und nichttarifärer Art bis heute nicht vollständig gelungen ist, und warum die Länder trotz empirischer Belege über die Optimalität des Freihandels an diesen protektionistischen Maßnahmen festhalten. Auf den Ansatz der strategischen Handelspolitik, der den Einsatz protektionistischer Instrumente zu erklären versucht, soll in dieser Arbeit eingegangen werden. Nach dieser Theorie handeln Regierungen strategisch, durch Auferlegung von Handelsbarrieren, um ihre eigenen Industrien zu schützen und einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Diese Strategien stärken zwar die eigene Wohlfahrt, beeinflussen jedoch die anderer Handelspartner negativ. [...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- GRUNDLAGEN DER STRATEGISCHEN HANDELSPOLITIK
- PROBLEME DER STRATEGISCHEN HANDELSPOLITIK
- FREIHANDEL ALS REFERENZMODELL
- DAS GEFANGENENDILEMMA
- DAS ZOLLSPIEL AM BEISPIEL EINER NICHT-KOOPERATION
- DER MEHRLÄNDERFALL AM BEISPIEL DER ZOLLUNION
- EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE GATT/WTO.
- DIE WELTHANDELSRUNDEN DER GATT/WTO
- THEORETISCHE BETRACHTUNG
- WELTHANDELSRUNDEN ALS TWO-LEVEL-GAMES
- STRATEGIEN IN ZOLLSENKUNGSVERHANDLUNGEN
- ERFOLGE DER NEUN WELTHANDELSRUNDEN
- SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Welthandelsrunden der GATT/WTO unter dem Gesichtspunkt der strategischen Handelspolitik. Sie befasst sich mit der Frage, warum der Abbau von Handelshemmnissen trotz der empirischen Belege für die Optimalität des Freihandels bis heute nicht vollständig gelungen ist. Im Mittelpunkt steht der Ansatz der strategischen Handelspolitik, der den Einsatz protektionistischer Instrumente durch Regierungen zur Erklärung des Handelsgeschehens heranzieht.
- Strategische Handelspolitik als Erklärung für den Einsatz von protektionistischen Maßnahmen
- Das Gefangenendilemma und die Herausforderungen der internationalen Kooperation
- Die GATT/WTO als Rahmen für multilaterale Handelsverhandlungen und die Reduktion von Handelshemmnissen
- Die Rolle von Welthandelsrunden als Two-Level-Games und die Verhandlungsmacht der teilnehmenden Länder
- Analyse der Erfolgsfaktoren und Herausforderungen der Welthandelsrunden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die strategische Handelspolitik und der Darstellung ihrer grundlegenden Prinzipien. Im Anschluss werden die Herausforderungen der strategischen Interaktion von Regierungen und die daraus resultierenden Probleme beleuchtet. Hierzu wird das Modell des Freihandels als Referenzmodell vorgestellt, bevor die einzelnen Strategien der Länder anhand des spieltheoretischen Gefangenendilemmas erläutert werden. Das sich für die Länder ergebende Dilemma wird anhand eines Zollspiels veranschaulicht, um zu zeigen, dass Nicht-Kooperation zu Wohlfahrtseinbußen führt, während Kooperation zu einer wohlfahrtsverbessernden Situation führen kann. Anschließend wird der Fall von Zollunionen betrachtet, um zu untersuchen, ob der Effekt der Wohlfahrtseinbußen von Drittländern vermieden werden kann oder ob eine Annäherung an den Optimalfall „Freihandel“ stattfindet.
Aus diesen Grundlagen ergibt sich die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, eine Kooperation zwischen den Ländern zu ermöglichen, und ob die Zollunion eine Möglichkeit zur Umsetzung der Freihandelsidee bietet oder ob eine solche Union mit Regelsetzungen, die eine Kooperation ermöglichen, nicht konform ist. Hierzu wird die GATT/WTO als Informationsbasis und Möglichkeit multilateraler Verhandlungen vorgestellt. Nachdem die GATT als Vertragsrahmen und die WTO als Organisation in den wesentlichen Grundzügen vorgestellt werden, liegt der Fokus auf den Welthandelsrunden, in denen an der GATT/WTO partizipierende und interessierte Länder unter den vorgegebenen Regelsetzungen verhandeln können. Die Arbeit behandelt die theoretische Interpretation dieser Handelsrunden, untersucht die Welthandelsrunden als Two-Level-Games, stellt verschiedene Möglichkeiten einer Zollsenkung dar und zeigt die bisher erzielten Erfolge in den neun Welthandelsrunden auf.
Schlüsselwörter
Strategische Handelspolitik, GATT, WTO, Welthandelsrunden, Freihandel, Protektionismus, Gefangenendilemma, Zollspiel, Zollunion, Two-Level-Games, Wohlfahrt, Handelsliberalisierung, Kooperation.
- Arbeit zitieren
- Jana Semken (Autor:in), 2006, Die Welthandelsrunden der WTO/GATT unter dem Gesichtspunkt der strategischen Handelspolitik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58691