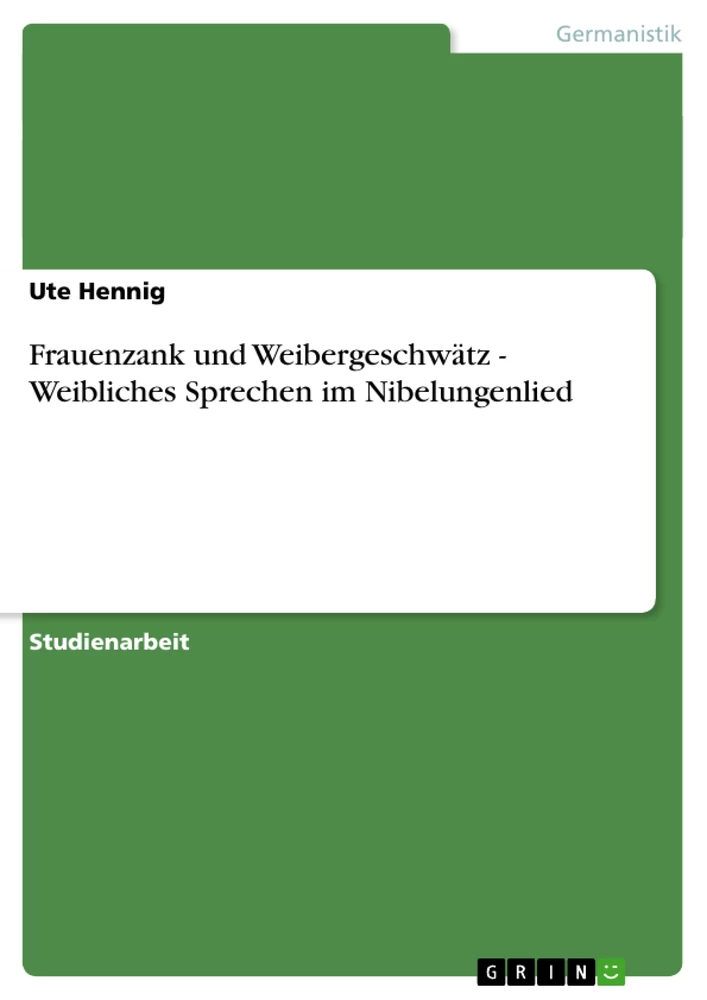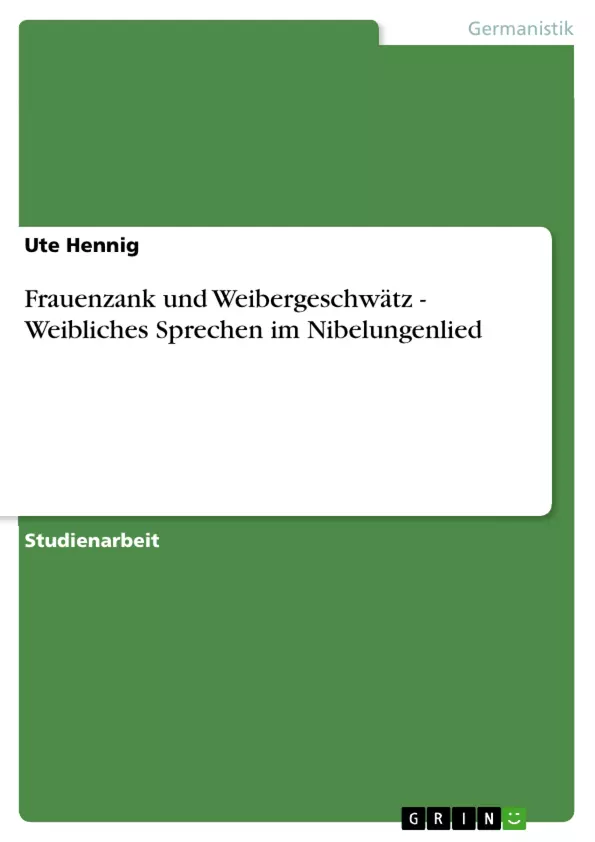„Ich habe doch nicht sprechen gelernt, um jetzt den Mund zu halten", tönt das weibliche Fotomodell der Betty-Barclay-Werbung des Jahres 1996 in diversen Frauenzeitschriften. Anscheinend war der Moment zum sprachlichen Durchbruch gekommen.
Dabei haben Frauen zu keiner Zeit sprechen gelernt, um den Mund zu halten. Er wurde und wird ihnen nur bewusst und systematisch von männlicher Seite zugehalten.
Die vorliegende Arbeit soll jedoch keinen Abriss der Geschichte der Sprecherziehung von Frauen geben, sondern sich auf die aufschlussreiche und beispielhafte Inszenierung des weiblichen Sprechens im Nibelungenlied beschränken. Dazu geht sie zunächst auf die den Frauen zugedachten Rollen im Bereich der mittelalterlichen Literatur ein und erläutert den von ihnen zu erfüllenden umfangreichen Tugendkatalog besonders im Hinblick auf ihre Artikulationsfähigkeiten.
Die im Nibelungenlied vorkommenden Gespräche unter Frauen und zwischen Frauen und Männern werden auf die Beziehungen der Gesprächspartner untereinander untersucht, wobei gesellschaftliche und geschlechtliche Hierarchien und die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Sprechen und Macht im Mittelpunkt stehen. Die Autorin will die Verhaltensweisen und Reaktionen, die entstehen, wenn eine Frau verbal kommuniziert, darstellen und deuten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Literatur des Mittelalters
- Weibliches Sprechen
- Gespräche von und mit Frauen im Nibelungenlied
- Die Gespräche zwischen Mutter und Tochter
- Kampfreden und Streitgespräche der Rivalinnen und Feindinnen
- Kriemhild und Hagen
- Gespräche zwischen den Eheleuten
- Bettgespräche zwischen den Eheleuten
- Kriemhild als Untergebene
- Kriemhild als Herrscherin
- Brünhild
- Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Inszenierung des weiblichen Sprechens im Nibelungenlied und setzt sich zum Ziel, die Rolle von Frauen in der mittelalterlichen Literatur, die ihnen zugedachten Rollen und ihre Artikulationsmöglichkeiten zu beleuchten. Die Analyse fokussiert sich auf die Gespräche zwischen Frauen und Männern, die in den Texten auftreten, und untersucht dabei die Beziehungen der Gesprächspartner untereinander sowie die gesellschaftlichen und geschlechtlichen Hierarchien.
- Weibliches Sprechen in der mittelalterlichen Literatur
- Die Inszenierung von Frauenrollen im Nibelungenlied
- Gespräche von und mit Frauen im Nibelungenlied
- Beziehungen zwischen Frauen und Männern
- Der Zusammenhang zwischen Sprechen und Macht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den aktuellen Diskurs über weibliches Sprechen und stellt die Problematik der Inszenierung von Frauenrollen in der Literatur in den Vordergrund. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Literatur des Mittelalters und der Rolle von Frauen in diesem Kontext, insbesondere im Hinblick auf ihre Bildung und ihre gesellschaftliche Position.
Das dritte Kapitel widmet sich dem weiblichen Sprechen und analysiert die Erwartungen an die Artikulationsfähigkeit von Frauen im Mittelalter. Im vierten Kapitel werden die verschiedenen Gesprächssituationen im Nibelungenlied untersucht, wobei die Beziehungen zwischen den Gesprächspartnern und die Frage nach der Machtverteilung im Mittelpunkt stehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem weiblichen Sprechen im Nibelungenlied, der Inszenierung von Frauenrollen in der mittelalterlichen Literatur, den Beziehungen zwischen Frauen und Männern, den gesellschaftlichen und geschlechtlichen Hierarchien, der Macht des Sprechens und der Frage nach der Authentizität von Frauenfiguren in der Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird weibliches Sprechen im Nibelungenlied dargestellt?
Die Arbeit untersucht die Inszenierung weiblicher Rede in verschiedenen Kontexten, etwa in Streitgesprächen, Bettgesprächen oder in der Rolle als Herrscherin.
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Sprechen und Macht?
Es wird analysiert, wie Frauen verbale Kommunikation nutzen, um Einfluss zu gewinnen oder wie ihnen das Wort entzogen wird, um männliche Hierarchien zu wahren.
Welche Rollenbilder für Frauen gab es in der mittelalterlichen Literatur?
Frauen unterlagen einem strengen Tugendkatalog, der oft Schweigsamkeit oder eine kontrollierte Artikulationsfähigkeit forderte.
Wer sind die zentralen Frauenfiguren in der Untersuchung?
Im Mittelpunkt stehen Kriemhild und Brünhild, deren unterschiedliche Sprechweisen und Interaktionen mit Männern (z.B. Hagen oder ihren Ehemännern) analysiert werden.
Was thematisieren die „Bettgespräche“ im Epos?
Diese Gespräche sind oft Orte privater Verhandlung von Macht und Einfluss, die im krassen Gegensatz zum öffentlichen Auftreten der Figuren stehen können.
- Citation du texte
- Ute Hennig (Auteur), 1996, Frauenzank und Weibergeschwätz - Weibliches Sprechen im Nibelungenlied, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5870