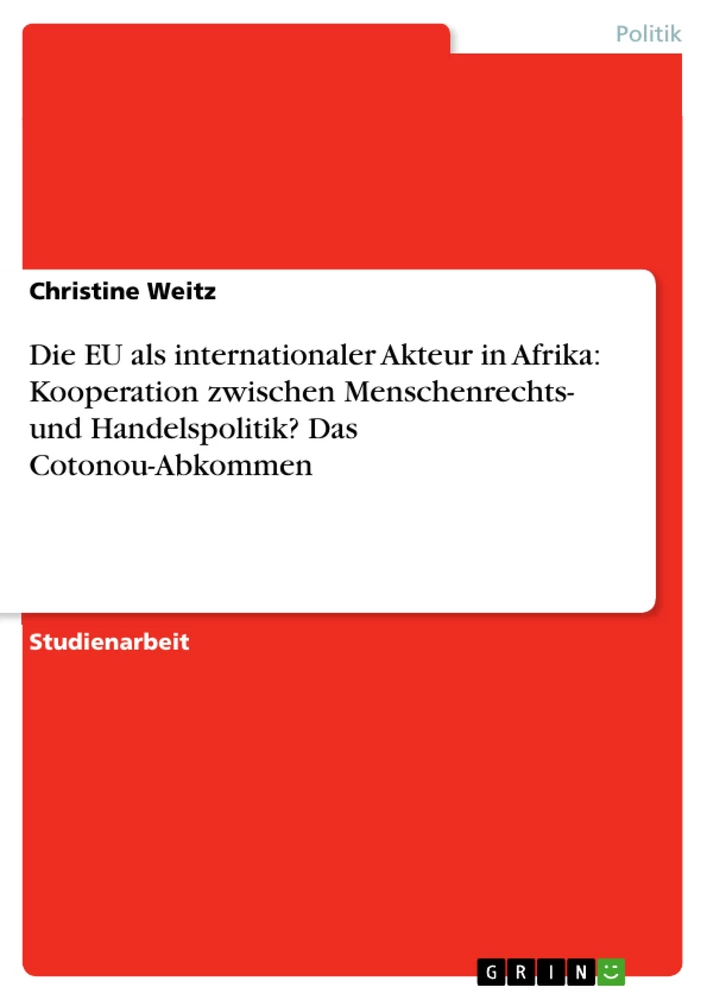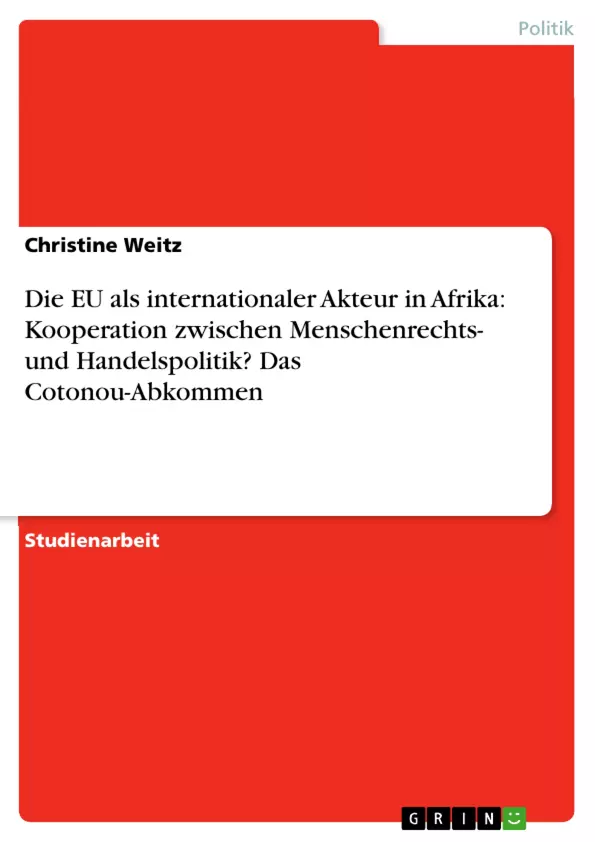Nach 2-jährigen Verhandlungen schloss die EU im Jahre 2000 mit 77 Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifik ein neues entwicklungspolitisches Kooperationsabkommen. Am 23. Juni 2000 wurde in Cotonou, der Hauptstadt von Benin, feierlich das „Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstatten andererseits“ unterzeichnet. Das Cotonou-Abkommen löste die im Februar 2000 auslaufende Lomé-IV-Konvention ab. Es wurde auf 20 Jahre Laufzeit angelegt und bietet somit den EL aber auch den IL Planungssicherheit. Allerdings besteht alle 5 Jahre die Möglichkeit der Revision des Abkommens. Das Abkommen „stützt sich auf drei miteinander verzahnte Komponenten: politischer Dialog, Handel und Investitionen und Entwicklungszusammenarbeit“. Die Multidimensionalität, welche signifikant für dieses Abkommen ist, beruht auf fünf Säulen: Eine umfassende politische Dimension, Förderung partizipatorischer Ansätze, Entwicklungsstrategien und Konzentration auf das Ziel der Armutsbekämpfung, Schaffung eines neuen Rahmens für die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit, Reform der finanziellen Zusammenarbeit. Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, wird im Folgenden der Fokus auf der Handels- und Entwicklungspolitik der EU für Afrika unter Berücksichtigung des historischen Kontextes liegen. Insbesondere soll jedoch dieses Verhältnis im Rahmen des Cotonou-Abkommen betrachtet werden. Als Grundlage zum adäquaten Einstieg in die Thematik wird im ersten Teil der Arbeit die historische Entwicklung der Zusammenarbeit skizziert. Um die Übergeordnete Fragestellung dieser Arbeit, in welchem Verhältnis wirtschaftliche und entwicklungspolitische Elemente in der Europäischen EP zueinander stehen, angemessen zu untersuchen, werden insbesondere die Demokratieförderung, der Einfluss von Menschenrechtskonformität auf die wirtschaftliche Hilfe und die hierzu zur Verfügung stehenden entwicklungspolitischen Instrumente analysiert. Welche Relevanz hat menschenrechtskonformes Verhalten der EL für die EU? Über welche Sanktionsmöglichkeiten verfügt die Gemeinschaft bei Verstößen gegen die Menschenrechte? Kann hier ein Zusammenhang zwischen Handels- und EP hergestellt werden? Werden Demokratisierungsfortschritte entlohnt? [...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Europäische Kooperation mit Afrika
- 2.1 Die historische Entwicklung
- 3. Das Cotonou-Abkommen: Neuausrichtungen der Handels- und Entwicklungspolitik
- 4. Menschenrecht und Demokratie
- 4.1 politische Instrumente zur Sicherung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
- 4.1.1 negative politische Konditionalität: Sanktionen
- 4.1.2 positive politische Konditionalität: Budgethilfe
- 4.1.3 Positivmaßnahmen
- 5. Handelspolitische Maßnahmen: Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
- 5.1 Erfolgreiche Integration der AKP-Staaten durch EPAs?
- 6. Handels- vs. Entwicklungspolitik ?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die europäische Entwicklungspolitik im Kontext des Cotonou-Abkommens mit besonderem Fokus auf die afrikanischen Partnerstaaten. Die Arbeit analysiert die Beziehung zwischen Menschenrechts- und Handelspolitik im Rahmen des Abkommens und beleuchtet die Bedeutung von politischer Konditionalität, Budgethilfe und Handelsabkommen für die Entwicklung Afrikas.
- Die historische Entwicklung der europäischen Kooperation mit Afrika
- Die Bedeutung des Cotonou-Abkommens als Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen der EU und den AKP-Staaten
- Der Zusammenhang zwischen Menschenrechten und Demokratieförderung und der europäischen Entwicklungspolitik
- Die Rolle von Handelsabkommen und Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPAs) in der Entwicklung Afrikas
- Die Herausforderungen und Chancen der Integration von Handels- und Entwicklungspolitik im Rahmen des Cotonou-Abkommens
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Cotonou-Abkommen und dessen Bedeutung für die europäische Entwicklungspolitik. Im zweiten Kapitel wird die historische Entwicklung der europäischen Kooperation mit Afrika beleuchtet. Das dritte Kapitel analysiert die Neuausrichtungen der Handels- und Entwicklungspolitik im Rahmen des Cotonou-Abkommens. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Rolle von Menschenrechten und Demokratieförderung in der europäischen Entwicklungspolitik. Das fünfte Kapitel fokussiert auf die handelspolitischen Maßnahmen, insbesondere die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen. Das sechste und letzte Kapitel thematisiert die komplexe Beziehung zwischen Handels- und Entwicklungspolitik im Rahmen des Cotonou-Abkommens.
Schlüsselwörter
Cotonou-Abkommen, Europäische Union, Afrika, AKP-Staaten, Entwicklungspolitik, Menschenrechte, Demokratie, Handelspolitik, Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, Budgethilfe, politische Konditionalität, Sanktionen
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Cotonou-Abkommen?
Das Cotonou-Abkommen ist ein im Jahr 2000 unterzeichnetes Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und 77 AKP-Staaten (Afrika, Karibik, Pazifik), das auf 20 Jahre angelegt war.
Welche drei Hauptkomponenten bilden das Abkommen?
Das Abkommen stützt sich auf den politischen Dialog, Handel und Investitionen sowie die Entwicklungszusammenarbeit.
Wie hängen Menschenrechte und Wirtschaftshilfe zusammen?
Es existiert eine politische Konditionalität: Bei Verstößen gegen Menschenrechte können Sanktionen verhängt werden, während Demokratisierungsfortschritte durch Budgethilfe belohnt werden können.
Was sind Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPAs)?
EPAs sind handelspolitische Maßnahmen im Rahmen des Cotonou-Abkommens, die die Integration der AKP-Staaten in den Weltmarkt fördern sollen.
Welches Ziel verfolgt das Abkommen primär?
Ein zentrales Ziel ist die Armutsbekämpfung durch eine verbesserte wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit.
- Quote paper
- Christine Weitz (Author), 2006, Die EU als internationaler Akteur in Afrika: Kooperation zwischen Menschenrechts- und Handelspolitik? Das Cotonou-Abkommen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58734