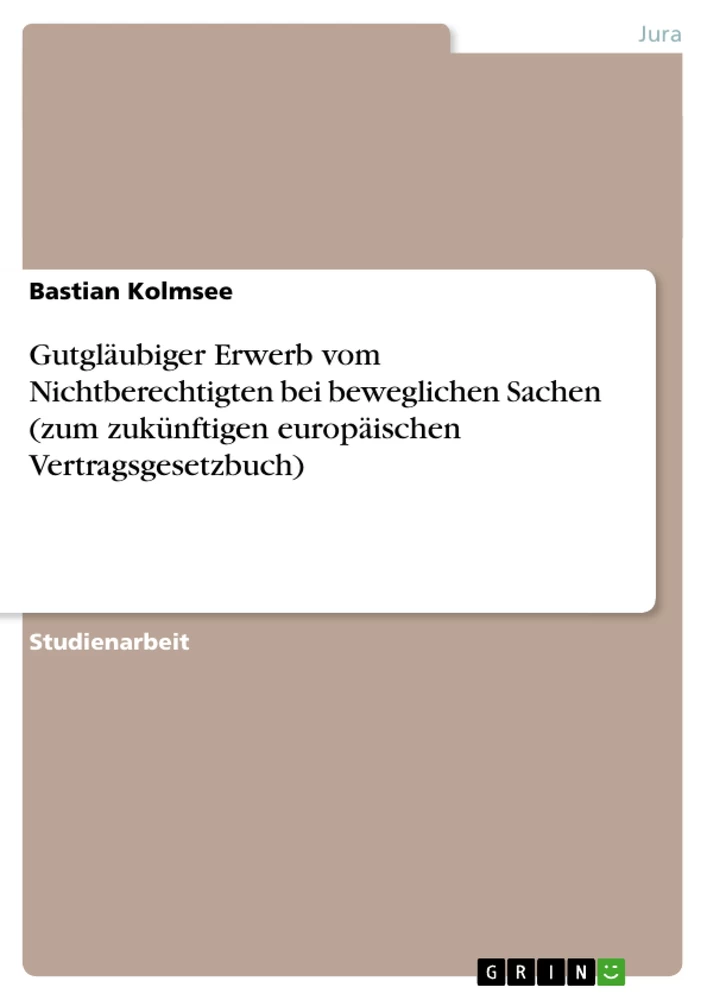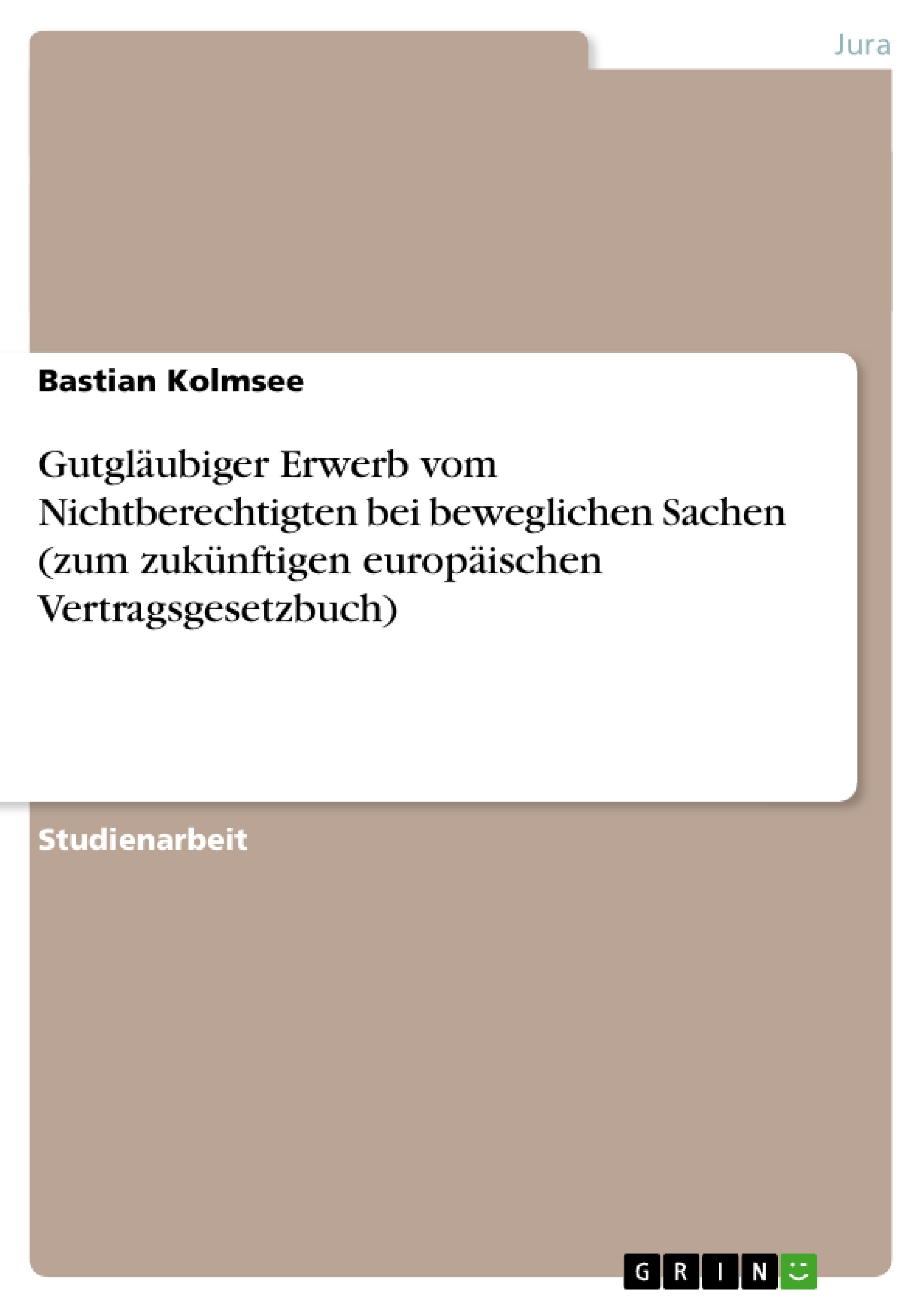Europa wächst immer mehr zusammen. Seit der Erweiterung im Jahr 2004 sind schon 25 Staaten Mitglieder der Europäischen Union. Dadurch wurden nicht nur kulturelle Barrieren, sondern auch tarifäre Hemmnisse abgebaut. Ein Austausch von Waren ist nun in fast ganz Europa problemlos möglich. Die verschiedenen Rechtskreise in den Staaten der EU, insbesondere in zivilrechtlicher Sicht gesehen, sind jedoch noch relativ verschieden. Aufgrund dessen ist es bei Verträgen zwischen privaten und juristischen Personen der einzelnen Mitgliedsländer unerlässlich auch den Rechtskreis des Vertragspartners zu kennen. Ein gesamteuropäisches Gesetzbuch bzw. Vertragsgesetzbuch könnte dem Abhilfe schaffen. Diese Arbeit befasst sich mit dem zukünftigen europäischen Vertragsgesetzbuch und speziell mit dem Punkt „Gutgläubiger Erwerb von beweglichen Sachen vom Nichtberechtigten“. Nach einer Erklärung des Problemhintergrunds und den schuldrechtlichen Verflechtungen des gutgläubigen Erwerbs, wird zunächst die historische Entwicklung geschildert. Anschließend folgt eine prägnante Darstellung der aktuellen Vorschriften in ausgesuchten Ländern der EU. Wobei dabei auch auf die Regelungen aus den Vereinigten Staaten und aus der Schweiz eingegangen wird. Als Ziel dieser Seminararbeit wird dann unter Berücksichtigung des Rechtsvergleichs und den historischen, politischen sowie wirtschaftlichen Gegebenheiten ein Vorschlag oder vielmehr eine Formulierung für den gutgläubigen Erwerb von beweglichen Sachen heraus gearbeitet, wie er auch später im europäischen Vertragsrecht vielleicht ähnlich zu finden sein könnte. Im Folgenden wird der gutgläubige Erwerb von beweglichen Sachen vom Nichtberechtigten nur noch als gutgläubiger Erwerb bezeichnet. Wegen der Komplexität der Materie, können die folgenden Ausführungen nur oberflächlich und verkürzt behandelt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil Allgemeines
- Problemhintergrund des gutgläubigen Erwerbs
- Darstellung der einzelnen Prinzipien
- Trennungsprinzip/Abstraktionsprinzip
- Konsensprinzip
- Teil Darstellung des Gutgläubigen Erwerbs
- Historische Entwicklung
- Griechenland
- Römisches Recht
- Unbeschränkter Herausgabeanspruch
- Ersitzung
- Wesen und Bedeutung
- Voraussetzungen
- Ausschluss
- Mittelalterliches Recht
- Darstellung der aktuellen Regelungen
- Deutschland
- Frankreich
- England
- USA
- Italien
- Schweiz
- Österreich
- Niederlande
- weitere Quellen:
- Historische Entwicklung
- Teil Gewichtung und Bedeutung der einzelnen Rechtskreise
- Historische Berücksichtigung, Einfluss
- Ökonomische Gegebenheiten
- Politisch
- Teil Gesetzesentwurf
- Vorschlag
- Kommentar bzw. Begründung
- Vorbemerkung
- Einzelne Voraussetzungen
- Zusammenfassung
- Teil Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den gutgläubigen Erwerb beweglicher Sachen vom Nichtberechtigten im Kontext eines zukünftigen europäischen Vertragsgesetzbuches. Ziel ist es, unter Berücksichtigung rechtsvergleichender Aspekte sowie historischer, politischer und ökonomischer Gegebenheiten, einen Vorschlag für die Formulierung dieser Rechtsmaterie im europäischen Recht zu entwickeln.
- Historische Entwicklung des gutgläubigen Erwerbs
- Rechtsvergleichende Darstellung der aktuellen Regelungen in verschiedenen europäischen Ländern und den USA
- Gewichtung und Bedeutung verschiedener Rechtskreise bei der Gesetzesformulierung
- Ausarbeitung eines Gesetzesvorschlags für den gutgläubigen Erwerb
- Begründung und Kommentierung des Gesetzesvorschlags
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des gutgläubigen Erwerbs im Kontext der europäischen Rechtsvereinheitlichung ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Sie betont die Notwendigkeit eines europäischen Vertragsgesetzbuches angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen und kulturellen Integration Europas und der damit verbundenen Herausforderungen bei der Anwendung unterschiedlicher nationaler Rechtsordnungen.
Teil Allgemeines: Dieser Teil beleuchtet den Problemhintergrund des gutgläubigen Erwerbs und erläutert grundlegende Prinzipien des Schuldrechts, wie das Trennungsprinzip/Abstraktionsprinzip und das Konsensprinzip, welche für das Verständnis des gutgläubigen Erwerbs unerlässlich sind. Er legt die Grundlage für die spätere Analyse der verschiedenen nationalen Rechtsordnungen.
Teil Darstellung des Gutgläubigen Erwerbs: Dieser Teil präsentiert eine detaillierte Analyse der historischen Entwicklung des gutgläubigen Erwerbs, beginnend mit dem antiken Griechenland und dem römischen Recht, über das Mittelalter bis hin zu den modernen Regelungen in ausgewählten Ländern. Der Abschnitt vergleicht verschiedene Rechtsordnungen (Deutschland, Frankreich, England, USA, Italien, Schweiz, Österreich, Niederlande) und analysiert die jeweiligen Voraussetzungen und Besonderheiten des gutgläubigen Erwerbs. Er untersucht dabei die unterschiedlichen Ansätze und deren geschichtliche Entwicklung, um die diversen rechtlichen Positionen im europäischen Kontext zu verstehen.
Teil Gewichtung und Bedeutung der einzelnen Rechtskreise: Dieser Teil bewertet die verschiedenen Rechtsordnungen im Hinblick auf ihre Relevanz für die Formulierung eines europäischen Gesetzesentwurfs. Er analysiert historische Einflüsse, ökonomische Gegebenheiten und politische Aspekte, um zu bestimmen, welche Rechtsordnungen besonderes Gewicht bei der Erstellung des Gesetzesvorschlags haben sollten. Es werden wichtige Faktoren für die Bewertung und Auswahl der rechtlichen Grundlagen für den europäischen Gesetzesentwurf erörtert.
Teil Gesetzesentwurf: Dieser Teil präsentiert einen konkreten Gesetzesvorschlag für den gutgläubigen Erwerb von beweglichen Sachen vom Nichtberechtigten im Rahmen eines europäischen Vertragsrechts. Er beinhaltet eine ausführliche Begründung und Kommentierung des Vorschlags, unter Berücksichtigung der vorhergehenden Analysen und des Rechtsvergleichs. Der Fokus liegt auf den einzelnen Voraussetzungen für einen wirksamen gutgläubigen Erwerb.
Schlüsselwörter
Gutgläubiger Erwerb, bewegliche Sachen, Nichtberechtigter, Rechtsvergleich, Europa, Vertragsrecht, Gesetzgebung, Römisches Recht, Deutschland, Frankreich, England, USA, Italien, Schweiz, Österreich, Niederlande, Trennungsprinzip, Abstraktionsprinzip, Konsensprinzip, Besitz, Eigentum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Gutgläubiger Erwerb beweglicher Sachen
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den gutgläubigen Erwerb beweglicher Sachen vom Nichtberechtigten im Kontext eines zukünftigen europäischen Vertragsgesetzbuches. Sie analysiert die historische Entwicklung, vergleicht verschiedene nationale Rechtsordnungen und entwickelt einen Gesetzesvorschlag für ein einheitliches europäisches Recht in diesem Bereich.
Welche Rechtsordnungen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Rechtsordnungen Deutschlands, Frankreichs, Englands, der USA, Italiens, der Schweiz, Österreichs, der Niederlande und analysiert zusätzliche Quellen. Der Vergleich umfasst die historische Entwicklung und die aktuellen Regelungen zum gutgläubigen Erwerb.
Welche Prinzipien des Schuldrechts werden behandelt?
Die Arbeit erläutert grundlegende Prinzipien des Schuldrechts, insbesondere das Trennungsprinzip/Abstraktionsprinzip und das Konsensprinzip, die für das Verständnis des gutgläubigen Erwerbs essentiell sind.
Welche historischen Entwicklungen werden beleuchtet?
Die historische Entwicklung des gutgläubigen Erwerbs wird von antikem Griechenland und römischem Recht über das Mittelalter bis zur Gegenwart nachgezeichnet. Besondere Beachtung finden dabei die Entwicklung der Ersitzung im römischen Recht und die unterschiedlichen Ansätze in den verschiedenen Rechtsordnungen.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Teile: Einleitung, einen Teil zu allgemeinen Prinzipien, einen Teil zur Darstellung des gutgläubigen Erwerbs in verschiedenen Rechtsordnungen, einen Teil zur Gewichtung und Bedeutung der einzelnen Rechtskreise, einen Teil mit einem Gesetzesvorschlag inklusive Begründung und Kommentierung, und abschließend einen Ergebnisteil.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, unter Berücksichtigung rechtsvergleichender Aspekte sowie historischer, politischer und ökonomischer Gegebenheiten einen Vorschlag für die Formulierung der Rechtsmaterie des gutgläubigen Erwerbs im europäischen Recht zu entwickeln.
Welche Faktoren werden bei der Gesetzesformulierung berücksichtigt?
Bei der Formulierung des Gesetzesvorschlags werden historische Einflüsse, ökonomische Gegebenheiten und politische Aspekte berücksichtigt. Die Arbeit analysiert die Relevanz der verschiedenen Rechtsordnungen für die Erstellung des europäischen Gesetzesentwurfs.
Was beinhaltet der Gesetzesvorschlag?
Der Gesetzesvorschlag umfasst eine konkrete Formulierung für den gutgläubigen Erwerb beweglicher Sachen vom Nichtberechtigten im Rahmen eines europäischen Vertragsrechts, einschließlich einer ausführlichen Begründung und Kommentierung der einzelnen Voraussetzungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gutgläubiger Erwerb, bewegliche Sachen, Nichtberechtigter, Rechtsvergleich, Europa, Vertragsrecht, Gesetzgebung, Römisches Recht, Deutschland, Frankreich, England, USA, Italien, Schweiz, Österreich, Niederlande, Trennungsprinzip, Abstraktionsprinzip, Konsensprinzip, Besitz, Eigentum.
- Arbeit zitieren
- Bastian Kolmsee (Autor:in), 2005, Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten bei beweglichen Sachen (zum zukünftigen europäischen Vertragsgesetzbuch), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58757