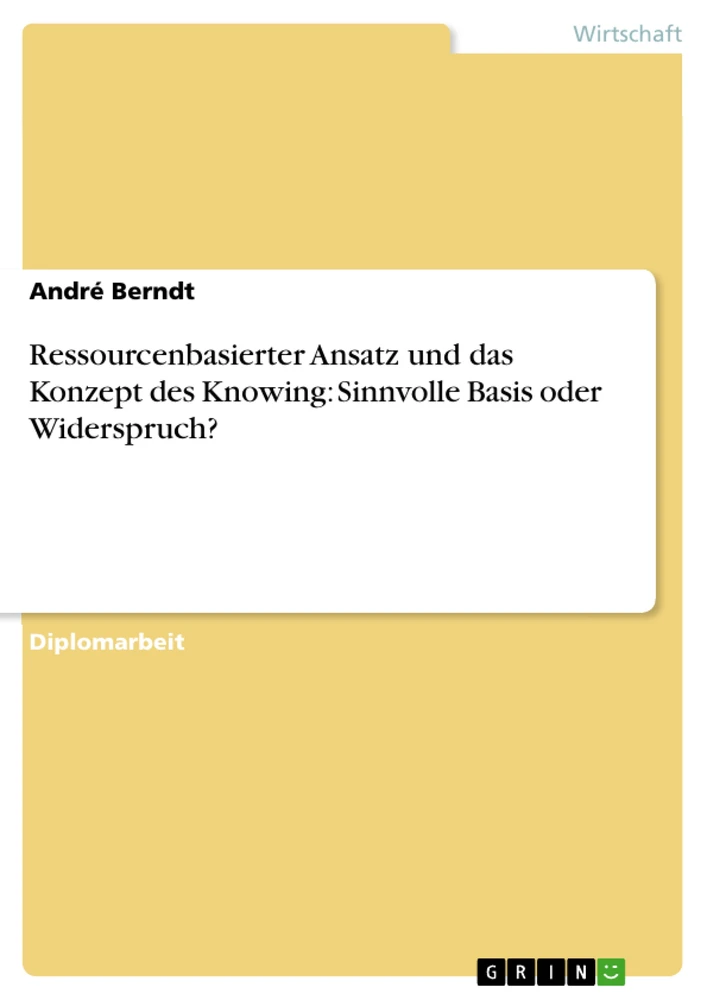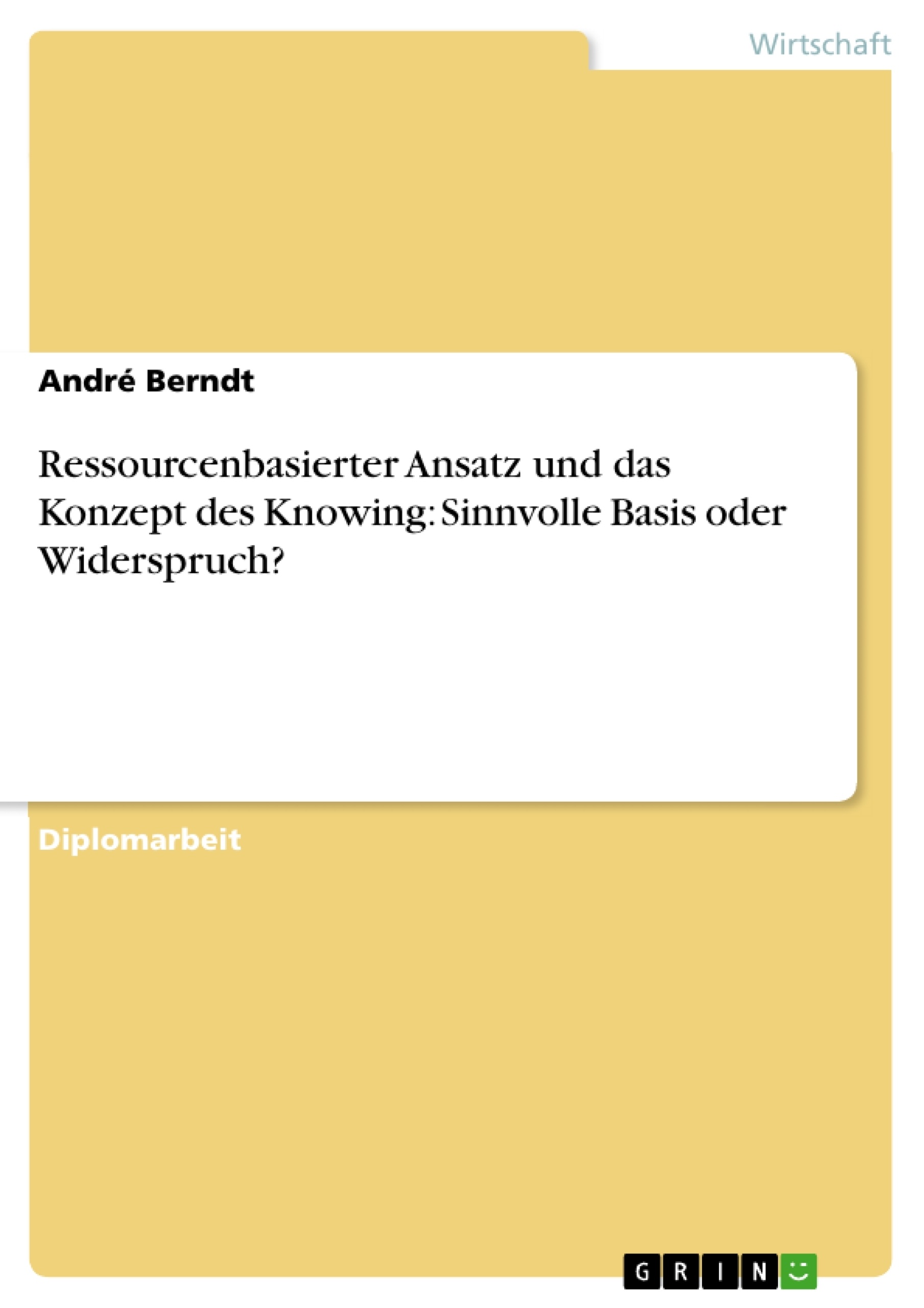Die Suche nach Ursachen für den Erfolg von Organisationen weckt ungebrochenes Interesse in der wissenschaftlichen Forschung und unternehmerischen Praxis. Die Betriebswirtschaftslehre betrachtet traditionell den im Rahmen des organisationalen Leistungsprozesses geschaffenen Mehrwert als Erfolgsbasis. Darüber hinaus wird seit einigen Jahren der Überlegenheit von Inputfaktoren, als Quell des Erfolges, besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Dieser Ursachenzuschreiben folgend, hat der ressourcenbasierte Ansatz der Unternehmensführung (resource-based view) die Argumentation entscheidend geprägt. Primärziel dieses Ansatzes ist es nicht, den Erfolg von Organisationen per se zu erklären, sondern die Ursachen für dauerhaften, organisationsspezifischen und mithin extraordinären Erfolg darzustellen. Der ressourcenbasierte Ansatz bildet die erste zentrale Säule dieser Arbeit. In der Literatur wird diesbezüglich die Operationalisierung der Zusammenhänge zwischen Ressourcenausstattung und Erfolgsgrößen, insbesondere vor dem Hintergrund intangibler Ressourcen, diskutiert. Letzteren wird häufig das solitäre Potential zur Generierung anhaltender Wettbewerbsvorteile zugesprochen. Als intangibel werden vor allem solche Ressourcen bezeichnet, die einen impliziten (tacit) Charakter aufweisen und schwer oder nicht zu separieren und mithin nicht zu kodifizieren sind. Als eine Ressource mit hohem Intangibilitätsgrad, wird häufig Wissen (knowledge) charakterisiert. Das Konstrukt Wissen wird zum Teil different sowie auf verschiedenen Aggregationsniveaus konzeptionalisiert. Allen Ansätzen gemein ist jedoch die besondere Bedeutung des Menschen respektive dessen Handlungen im Zusammenhang mit dem Konstrukt Wissen. In der jüngeren Diskussion hat sich das Interesse partiell vom Konstrukt Wissen auf das des knowing verlagert, da letzterem, aufgrund seiner Handlungsinhärenz, ein höherer Intangibilitätsgrad attribuiert wird. Knowing als vergleichsweise junges und zugleich aktuelles Konstrukt im Rahmen der Ursachenanalyse für anhaltende Wettbewerbsvorteile bildet mithin die zweite zentrale Säule dieser Arbeit. Im dritten Teil derselben wird geprüft, inwieweit die Konzeptionalisierungen von knowing im Rahmen eines ressourcenbasierten Ansatzes, Potential zur Erklärung anhaltender Wettbewerbsvorteile in sich tragen. Der dritte Teil dieser Arbeit soll somit weniger eine weitere Säule aufbauen, als vielmehr das kooperative Adhärenzpotential der ersten beiden Säulen eruieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A. Ansätze strategischer Unternehmensführung
- I. Zu den Begriffen der Strategie und des Strategischen
- II. Zu den Begriffen des Managements und der Unternehmensführung
- III. Vom Markt-Fokus zum Ressourcen-Fokus
- B. Ressourcenbasierte Unternehmensführung
- I. Heterogenität und Immobilität
- II. Werthaltigkeit
- III. Seltenheit
- IV. Nicht-Imitierbarkeit
- 1. Historizität
- 2. Kausale Ambiguität
- 3. Soziale Komplexität
- V. Nicht-Substituierbarkeit
- C. Das Konstrukt knowing
- I. Knowing nach Cook und Brown
- 1. Formen von Wissen
- 2. Wissen und knowing
- II. Knowing nach Gherardi und Nicolini
- 1. Praktik als Lokalität von knowing
- 2. Die soziale Dimension von knowing
- 3. Die situative Dimension von knowing
- III. Knowing nach Orlikowski
- 1. Knowing und Praktik
- 2. Knowing als Fähigkeit und die Auflösung von Wissen
- D. Knowing als Ressource und Basis von Wettbewerbsvorteilen
- I. Ressourcen versus knowing nach Cook und Brown
- 1. Im Lichte von Heterogenität und Immobilität
- 2. Im Lichte von Werthaltigkeit
- 3. Im Lichte von Seltenheit
- 4. Im Lichte von Nicht-Imitierbarkeit
- a. Im Lichte von Historizität
- b. Im Lichte von kausaler Ambiguität
- c. Im Lichte von sozialer Komplexität
- 5. Im Lichte von Nicht-Substituierbarkeit
- II. Ressourcen versus knowing nach Gherardi und Nicolini
- 1. Im Lichte von Heterogenität und Immobilität
- 2. Im Lichte von Werthaltigkeit
- 3. Im Lichte von Seltenheit
- 4. Im Lichte von Nicht-Imitierbarkeit
- a. Im Lichte von Historizität
- b. Im Lichte von kausaler Ambiguität
- c. Im Lichte von sozialer Komplexität
- 5. Im Lichte von Nicht-Substituierbarkeit
- III. Ressourcen versus knowing nach Orlikowski
- 1. Im Lichte von Heterogenität und Immobilität
- 2. Im Lichte von Werthaltigkeit
- 3. Im Lichte von Seltenheit
- 4. Im Lichte von Nicht-Imitierbarkeit
- a. Im Lichte von Historizität
- b. Im Lichte von kausaler Ambiguität
- c. Im Lichte von sozialer Komplexität
- 5. Im Lichte von Nicht-Substituierbarkeit
- E. Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit der ressourcenbasierte Ansatz der Unternehmensführung durch das Konzept des Knowing sinnvoll erweitert werden kann. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse, ob Knowing als eine Ressource betrachtet werden kann und welche Implikationen sich für die Generierung von Wettbewerbsvorteilen ergeben.
- Die Relevanz des ressourcenbasierten Ansatzes für die Erklärung von Unternehmenserfolg
- Die Konzeption des Knowing und seine verschiedenen Ausprägungen
- Die Bedeutung von Knowing als Ressource für die Generierung von Wettbewerbsvorteilen
- Die kritische Würdigung des Beitrags von Knowing zum ressourcenbasierten Ansatz
- Die Implikationen der Erkenntnisse für die Praxis der Unternehmensführung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und erläutert den aktuellen Forschungsstand zum ressourcenbasierten Ansatz und dem Konzept des Knowing. Es wird die Relevanz des Themas für die Praxis der Unternehmensführung hervorgehoben.
- Ansätze strategischer Unternehmensführung: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die verschiedenen Ansätze strategischer Unternehmensführung, die den Kontext für die Diskussion des ressourcenbasierten Ansatzes bilden. Es werden die Begriffsdefinitionen von Strategie, Strategischem, Management und Unternehmensführung beleuchtet.
- Ressourcenbasierte Unternehmensführung: Dieses Kapitel behandelt die zentralen Grundprinzipien des ressourcenbasierten Ansatzes. Die Kapitelthemen beinhalten die Heterogenität und Immobilität von Ressourcen, die Werthaltigkeit, Seltenheit, Nicht-Imitierbarkeit und Nicht-Substituierbarkeit von Ressourcen.
- Das Konstrukt knowing: Das Kapitel fokussiert auf das Konzept des Knowing, das im weiteren Verlauf der Arbeit als Ressource betrachtet wird. Es werden verschiedene Definitionen und Perspektiven auf Knowing präsentiert, insbesondere die Ansätze von Cook und Brown, Gherardi und Nicolini sowie Orlikowski.
- Knowing als Ressource und Basis von Wettbewerbsvorteilen: Dieses Kapitel analysiert, inwieweit Knowing die Kriterien des ressourcenbasierten Ansatzes erfüllt und somit als Ressource für die Generierung von Wettbewerbsvorteilen dienen kann. Es werden die Ansätze von Cook und Brown, Gherardi und Nicolini sowie Orlikowski im Hinblick auf diese Kriterien untersucht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Diplomarbeit sind ressourcenbasierter Ansatz, Knowing, Wettbewerbsvorteile, Intangible Ressourcen, Wissen, Praktik, Heterogenität, Immobilität, Werthaltigkeit, Seltenheit, Nicht-Imitierbarkeit und Nicht-Substituierbarkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der ressourcenbasierte Ansatz (RBV)?
Ein Managementansatz, der den Erfolg von Unternehmen durch spezifische, wertvolle und schwer imitierbare Ressourcen erklärt.
Was unterscheidet „Knowing“ von klassischem Wissen?
„Knowing“ ist handlungsorientiert und situativ eingebettet, was ihm einen höheren Grad an Intangibilität verleiht als reinem Faktenwissen.
Warum sind intangible Ressourcen für Wettbewerbsvorteile wichtig?
Weil sie oft implizit (tacit) sind und aufgrund sozialer Komplexität oder kausaler Ambiguität kaum von Wettbewerbern kopiert werden können.
Welche Kriterien müssen Ressourcen erfüllen, um extraordinären Erfolg zu sichern?
Sie müssen heterogen, immobil, werthaltig, selten, nicht-imitierbar und nicht-substituierbar sein.
Welche Autoren prägten das Konzept des Knowing?
Die Arbeit stützt sich auf die Ansätze von Cook und Brown, Gherardi und Nicolini sowie Orlikowski.
- Citar trabajo
- André Berndt (Autor), 2005, Ressourcenbasierter Ansatz und das Konzept des Knowing: Sinnvolle Basis oder Widerspruch?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58784