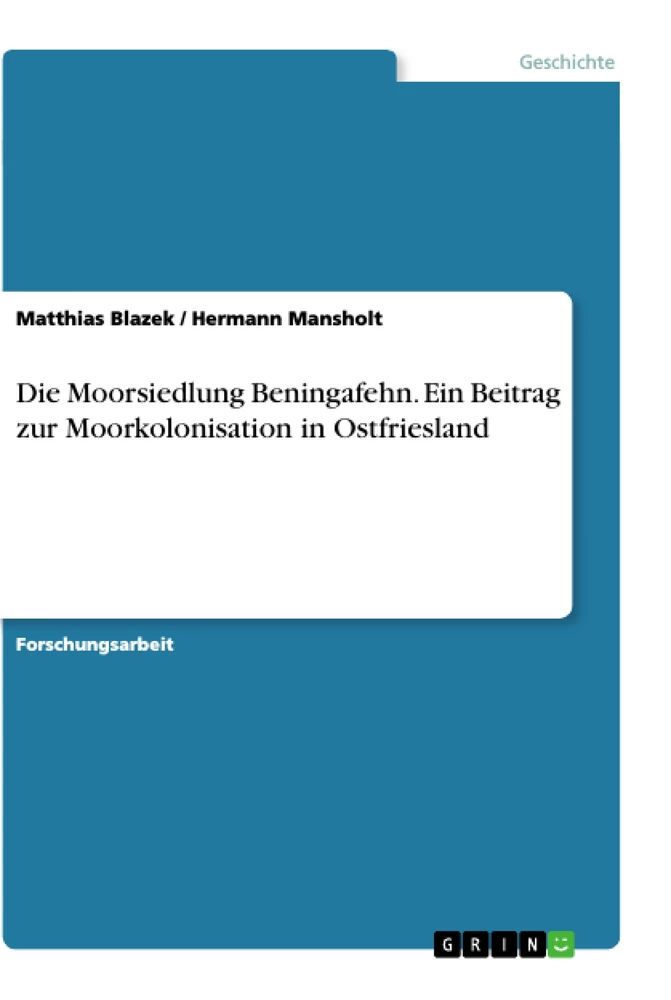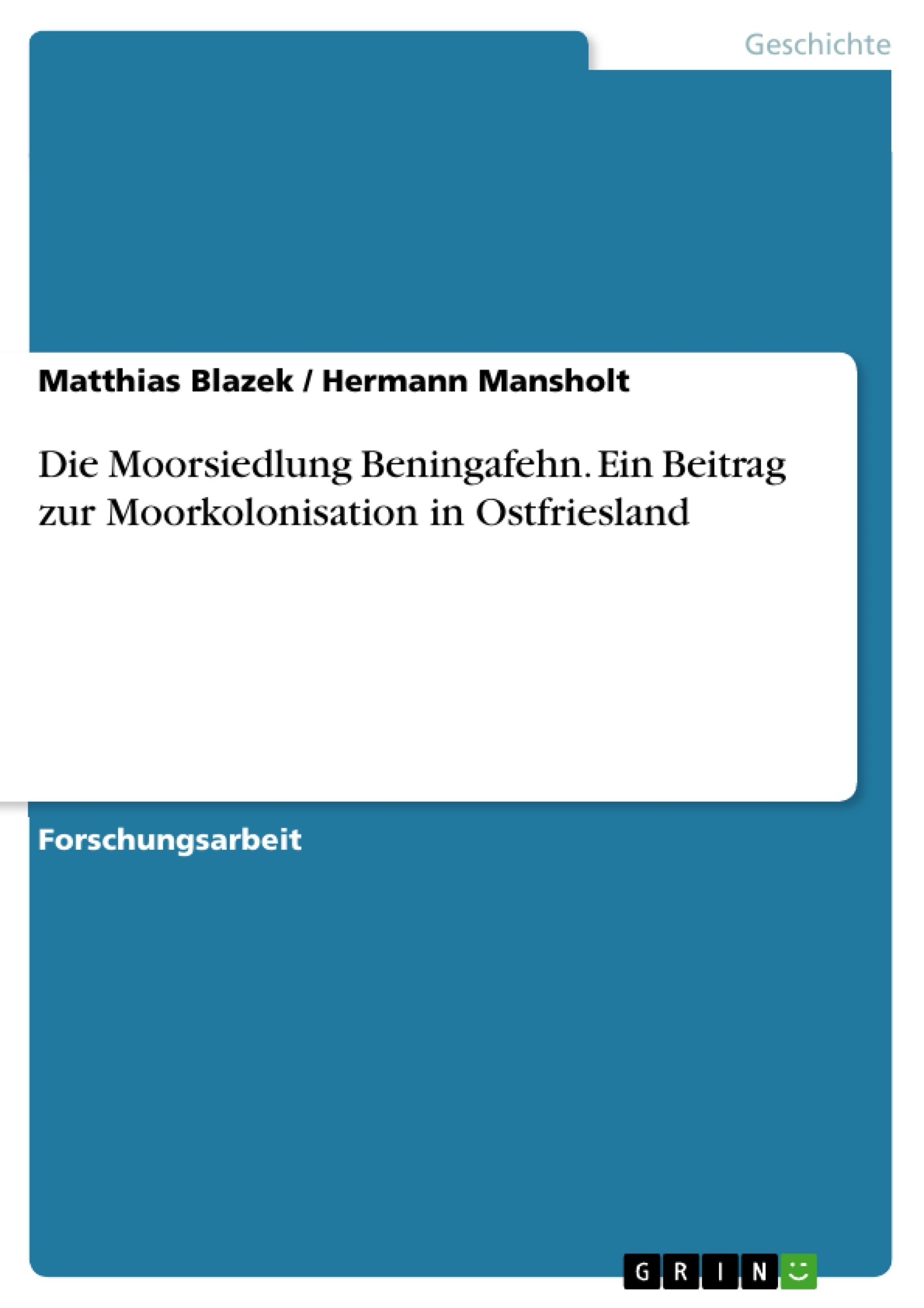Dieses Buch stellt eine Chronik zum Ort Beningafehn dar, die von Hermann Mansholt begonnen wurde. Eingebunden sind auch eine Zeittafel und ein Überblick über die Geschichte der Bezirksregierung Aurich (1823-2004). Unter Fehnsiedlungen versteht man Siedlungen der Binnenkolonisation im niederdeutschen Raum im Moor. Sie sind entlang von Kanälen (Wieken) angelegt worden. Als älteste und längste Fehnsiedlung Deutschlands gilt Papenburg. Anders als der Ortsname es vermuten lässt, ist Beningafehn nie eine Fehnsiedlung im eigentlichen Sinne geworden, da keine Fehnkanäle (Wieken) das Dorf durchziehen. Hermann Mansholt war ein Urgestein des Dorfes, ein lebendiges Geschichtsbuch; er erzählte gerne über das Gewesene und hatte schon früh begonnen, Notizen zur Dorfgeschichte zu Papier zu bringen.
Beningafehn ist eine Moorsiedlung, die ihren Namen der Familie Lantzius-Beninga verdankt. Die Kolonie wurde 1772 von Kommissionsrat Arent Jan van Louwerman in einem zur Gemarkung Hesel gerechneten Moorgebiet zwischen Kiefeld und Gut Stikelkamp als "Louwermanns Vehn" gegründet. Den Bewohnern wurde seit 1775 ein Anrecht zum Viehauftrieb auf die Heseler Gemeindeweise zugestanden, hatten dennoch aber häufig schwere Konflikte mit den Heseler Bauern auszutragen. 1788 kaufte Kriegsrat Lantzius-Beninga die Moorkolonie auf einer öffentlichen Versteigerung. 1789 lebten hier 15 Personen in vier Häusern, 1823 waren 49 Personen an zwölf "Feuerstellen". 1848 gab es 15 Wohngebäude und 68 Einwohner. Der 1820 aus der Heseler Gemeindeweide zugestandene Weideanteil wurde von den Kolonisten von Stiekelkamperfehn und Beningafehn zunächst gemeinschaftlich genutzt und erst 1860 unter den Kolonisten geteilt.
Inhaltsverzeichnis
- Zum Geleit
- Vorwort
- Die Chronik von Beningafehn als Herzenswunsch
- Zeittafel
- Brief von Hermann Mansholt an Matthias Blazek
- Spurensuche bei dem ostfriesischen Chronisten Tileman Dothias Wiarda
- Beningafehn – Ein Fehndorf im Wandel der Zeit
- Ein Erbzinsvertrag vom 26. August 1886
- Ein Kaufvertrag vom 5. Mai 1886
- Die Stiekelkampermühle
- Reparatur der Orgel in der Auricher Schlosskapelle
- Die Jahre der Fremdherrschaft
- Die Landdrostei Aurich
- Das Münz-, Maß- und Gewichtswesen im 18. Jahrhundert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser wissenschaftliche Aufsatz von Hermann Mansholt, bearbeitet von Matthias Blazek, hat zum Ziel, die Geschichte des ostfriesischen Fehndorfes Beningafehn zu dokumentieren und zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Dorfes von seinen Anfängen als Moorkolonie bis in die Gegenwart, unter besonderer Berücksichtigung der Rolle des niederländischen Unternehmers Arend Jan van Louwerman.
- Die Gründung und Entwicklung von Beningafehn als Moorkolonie.
- Die Rolle von Arend Jan van Louwerman bei der Kolonisierung des Gebietes.
- Die Beziehungen zwischen den Kolonisten und den umliegenden Bauern.
- Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Beningafehns im Laufe der Zeit.
- Die Einbindung Beningafehns in die regionale Geschichte Ostfrieslands.
Zusammenfassung der Kapitel
Zum Geleit: Dieser einleitende Abschnitt beschreibt die Entstehung der Chronik und hebt den Herzenswunsch Hermann Mansholts hervor, seine akribisch gesammelten Aufzeichnungen über Beningafehn zu veröffentlichen. Er betont die Bedeutung der lokalen Geschichtsschreibung und den Wandel derjenigen, die sich mit der Heimatforschung befassen, von Gelehrten hin zu Rentnern und Pensionären. Die Einleitung legt den Grundstein für die anschließende detaillierte Darstellung der Geschichte Beningafehns.
Beningafehn – Ein Fehndorf im Wandel der Zeit: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte Beningafehns. Es beschreibt die Namensgebung durch die Familie Lantzius-Beninga, die Gründung durch Arend Jan van Louwerman im Jahre 1772 und die anfänglichen Konflikte mit den Heseler Bauern. Der Text verfolgt die Entwicklung der Einwohnerzahl und der Bebauung über die Jahrhunderte und beleuchtet die Besonderheit Beningafehns als "Fehndorf" ohne eigentliche Fehnkanäle. Die enge Verknüpfung mit Neukamperfehn im dörflichen und kirchlichen Leben wird ebenfalls hervorgehoben. Der Abschnitt verbindet die lokale Geschichte mit breiteren Entwicklungen der Moorkolonisierung in Ostfriesland.
Die Jahre der Fremdherrschaft: Dieser Abschnitt analysiert einen spezifischen Zeitraum in der Geschichte Beningafehns, der durch die "Fremdherrschaft" gekennzeichnet ist. Es wird zu erwarten sein, dass dieser Teil detailliert die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Periode auf das Dorf beschreibt. Die Analyse wird vermutlich historische Dokumente und Quellen heranziehen, um die spezifischen Herausforderungen und Veränderungen der Dorfgemeinschaft zu beleuchten. Die Bedeutung dieses Kapitels liegt in der Erklärung, wie diese "Fremdherrschaft" die Entwicklung Beningafehns geprägt hat und zu den heutigen Gegebenheiten geführt hat.
Die Landdrostei Aurich: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rolle der Landdrostei Aurich in der Geschichte Beningafehns und der umliegenden Region. Die Analyse wird sich vermutlich auf die Verwaltung, Gerichtsbarkeit und den Einfluss der Landdrostei auf die lokale Entwicklung im Kontext der Geschichte Beningafehns konzentrieren. Es ist anzunehmen, dass der Einfluss der Landdrostei auf die politische und administrative Organisation des Dorfes, sowie auf die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, umfassend untersucht wird. Die Bedeutung dieses Kapitels liegt in der Einbettung der Geschichte Beningafehns in den größeren Kontext der regionalen Verwaltung und Politik.
Das Münz-, Maß- und Gewichtswesen im 18. Jahrhundert: Dieses Kapitel bietet einen Einblick in die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen des 18. Jahrhunderts in Beningafehn anhand des Münz-, Maß- und Gewichtswesens. Die Analyse wird vermutlich die Besonderheiten des lokalen Systems im Vergleich zu überregionalen Standards untersuchen, und möglicherweise die Auswirkungen dieser Systeme auf den Handel, die Landwirtschaft und das tägliche Leben der Bewohner Beningafehns erörtern. Es dürfte zeigen, wie das lokale Wirtschaftssystem funktioniert hat und wie es in die größeren ökonomischen Strukturen eingebunden war.
Schlüsselwörter
Beningafehn, Moorkolonisierung, Ostfriesland, Arend Jan van Louwerman, Hesel, Neukamperfehn, Landdrostei Aurich, Wirtschaftsgeschichte, Sozialgeschichte, Lokale Geschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Chronik von Beningafehn
Was ist der Inhalt der Chronik von Beningafehn?
Die Chronik von Beningafehn, bearbeitet von Matthias Blazek basierend auf den Aufzeichnungen von Hermann Mansholt, bietet eine umfassende Darstellung der Geschichte des ostfriesischen Fehndorfes Beningafehn. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung, Kapitelzusammenfassungen, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, sowie Schlüsselwörter. Die Chronik beleuchtet die Entwicklung Beningafehns von seinen Anfängen als Moorkolonie bis in die Gegenwart, mit besonderem Fokus auf die Rolle von Arend Jan van Louwerman und die Einbindung in die regionale Geschichte Ostfrieslands. Sie umfasst auch historische Dokumente wie einen Erbzins- und einen Kaufvertrag.
Welche Themen werden in der Chronik behandelt?
Die Chronik behandelt diverse Themen, darunter die Gründung und Entwicklung Beningafehns als Moorkolonie, die Rolle von Arend Jan van Louwerman, die Beziehungen zwischen den Kolonisten und den umliegenden Bauern, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Dorfes, die Einbindung in die regionale Geschichte Ostfrieslands, die "Jahre der Fremdherrschaft", die Rolle der Landdrostei Aurich, sowie das Münz-, Maß- und Gewichtswesen im 18. Jahrhundert. Besondere Aufmerksamkeit wird der Besonderheit Beningafehns als "Fehndorf" ohne eigentliche Fehnkanäle und seiner engen Verknüpfung mit Neukamperfehn gewidmet.
Wer sind die Autoren der Chronik?
Die Chronik basiert auf den akribisch gesammelten Aufzeichnungen von Hermann Mansholt, der einen Herzenswunsch in der Veröffentlichung seiner Arbeit sah. Matthias Blazek hat die Aufzeichnungen bearbeitet und für die Veröffentlichung vorbereitet.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Chronik stützt sich auf die umfangreichen Aufzeichnungen von Hermann Mansholt. Zusätzlich werden historische Dokumente wie ein Erbzinsvertrag vom 26. August 1886 und ein Kaufvertrag vom 5. Mai 1886 erwähnt. Die Analyse verschiedener Kapitel bezieht sich auf historische Quellen und Dokumente, um die Entwicklung Beningafehns zu belegen und zu interpretieren. Die Arbeit berücksichtigt auch die Bedeutung von Tileman Dothias Wiarda als ostfriesischer Chronist.
Welche Kapitel umfasst die Chronik?
Die Chronik enthält Kapitel wie "Zum Geleit", "Vorwort", "Die Chronik von Beningafehn als Herzenswunsch", "Zeittafel", "Brief von Hermann Mansholt an Matthias Blazek", "Spurensuche bei dem ostfriesischen Chronisten Tileman Dothias Wiarda", "Beningafehn – Ein Fehndorf im Wandel der Zeit", "Ein Erbzinsvertrag vom 26. August 1886", "Ein Kaufvertrag vom 5. Mai 1886", "Die Stiekelkampermühle", "Reparatur der Orgel in der Auricher Schlosskapelle", "Die Jahre der Fremdherrschaft", "Die Landdrostei Aurich", und "Das Münz-, Maß- und Gewichtswesen im 18. Jahrhundert".
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Chronik prägnant beschreiben, sind: Beningafehn, Moorkolonisierung, Ostfriesland, Arend Jan van Louwerman, Hesel, Neukamperfehn, Landdrostei Aurich, Wirtschaftsgeschichte, Sozialgeschichte, und Lokale Geschichte.
Für wen ist die Chronik von Beningafehn bestimmt?
Die Chronik richtet sich an alle, die sich für die lokale Geschichte Ostfrieslands, die Geschichte der Moorkolonisierung und die Entwicklung kleiner Dörfer interessieren. Sie ist besonders relevant für die Einwohner von Beningafehn und die Nachfahren der Kolonisten. Der wissenschaftliche Ansatz macht sie auch für Historiker und Heimatforscher wertvoll.
- Arbeit zitieren
- Matthias Blazek (Herausgeber:in), Hermann Mansholt (Autor:in), 2002, Die Moorsiedlung Beningafehn. Ein Beitrag zur Moorkolonisation in Ostfriesland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/587952