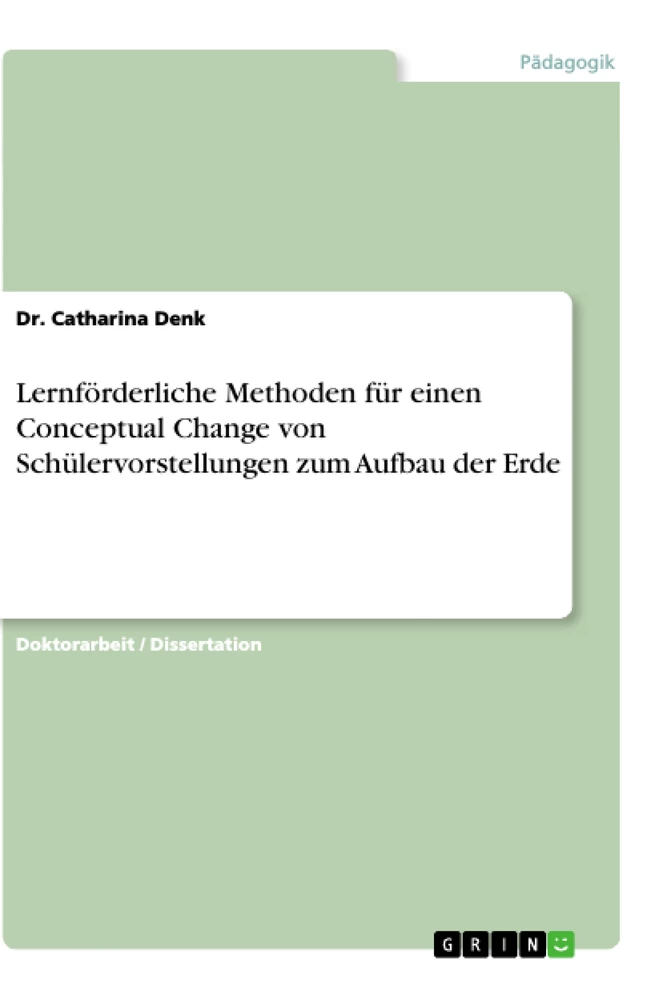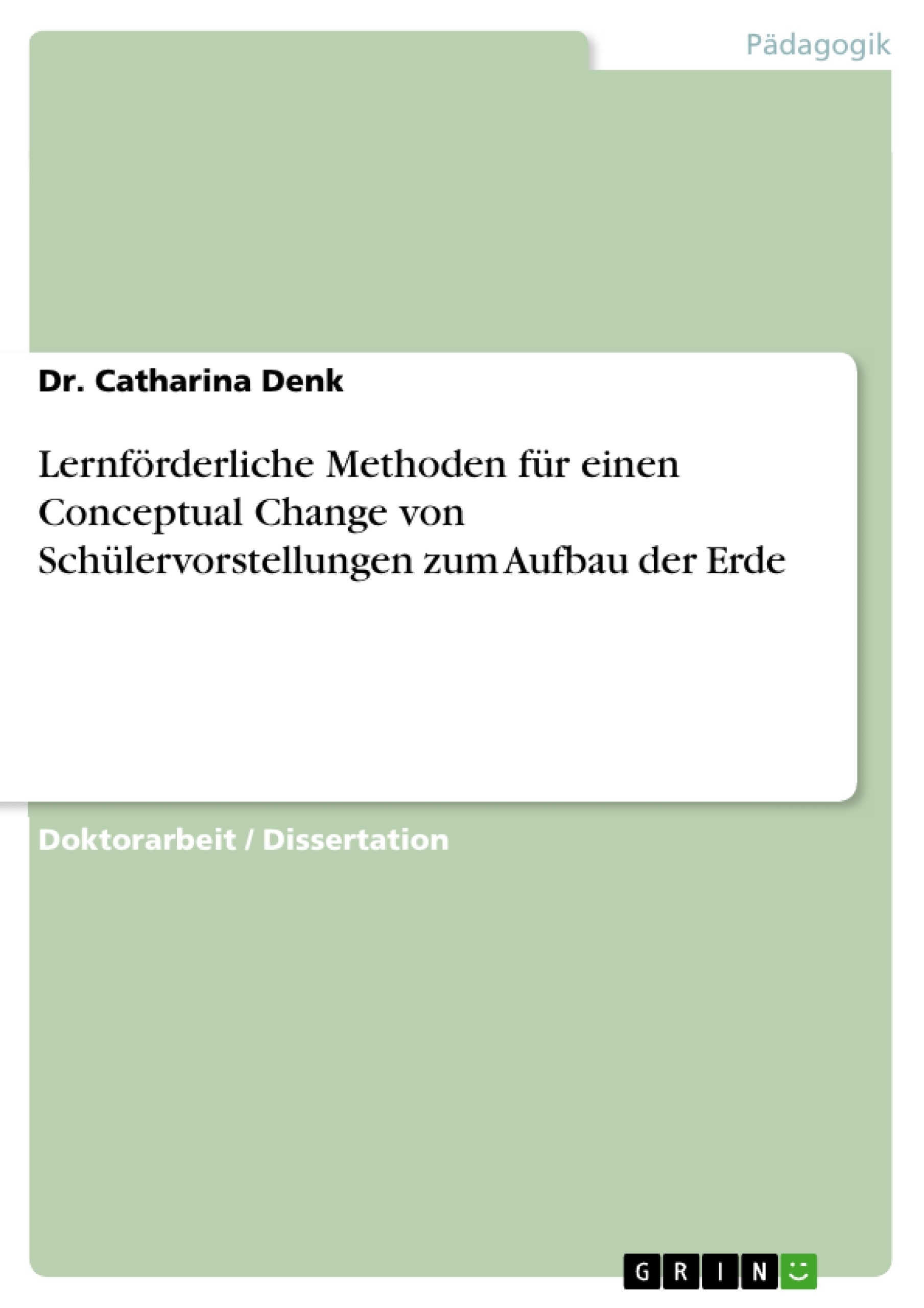Es gilt in dieser vorliegenden Dissertation, lernförderliche Methoden in einer geeigneten Lernumgebung für einen Conceptual Change zu entwickeln und ihre Tragweite empirisch zu überprüfen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Thema Aufbau der Erde.
Eine Basis hierfür bietet die Arbeit von CONRAD (2014), auf die diese Forschungsarbeit aufbaut. Als theoretischer Rahmen wurde der Conceptual Change von POSNER et al. (1982) ausgewählt. Die vier Bedingungen Unzufriedenheit, Verständlichkeit, Plausibilität und Fruchtbarkeit sind als Strukturvorgabe für die Entwicklung der didaktisch aufbereiteten Lernangebote leitend. Es wurden zehn Vermittlungsexperimente mit insgesamt 20 SchülerInnen aus bayerischen Realschulen und Gymnasien in einer qualitativen Studie durchgeführt. Die Vermittlungsexperimente beinhalten neben Interview- auch Interventionsphasen, um die ProbandInnen dazu anzuregen, ihre eigenen konstruktiven Denkprozesse zu reflektieren und ihre subjektiven Vorstellungen zu hinterfragen.
Die Ergebnisse der Studie machen deutlich, dass ein fachlich nahes Verständnis für den Aufbau der Erde erreicht werden konnte. Die didaktisch aufbereitete Lernumgebung zeichnet sich dadurch aus, dass die Thematik durch die eingesetzten Modelle und Materialien verständlicher und anschaulicher wurde. Das Lernen erfolgte selbstgesteuert, d.h. die aktive Rolle lag bei den Lernenden. 17 SchülerInnen haben eine Veränderung ihres Konzepts erreicht, wobei ein Großteil der ProbandInnen ein fachwissenschaftlich nahes Konzept mit über fünf adäquaten Begrifflichkeiten konstruierte. Es wurde deutlich, dass ein hohes Interesse der ProbandInnen für die Initiierung eines deutlichen Conceptual Changes vorteilhaft sein kann. Alle ProbandInnen, die ein hohes Interesse aufwiesen, haben einen deutlichen Conceptual Change vollzogen.
Ein weiteres Ergebnis ist, dass bei den ProbandInnen, bei denen kein Conceptual Change initiiert werden konnte, die Phase der Unzufriedenheit anscheinend nicht erreicht wurde. Um jedoch einen erfolgreichen Conceptual Change zu erreichen, müssen die Phasen Unzufriedenheit, Verständlichkeit, Plausibilität und Fruchtbarkeit nacheinander durchschritten werden. Hieraus ergibt sich, dass die letzten drei Kriterien eines Conceptual Changes bei diesen ProbandInnen nie erreicht werden konnten, da sie bereits an der ersten Phase der Unzufriedenheit scheiterten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Schülervorstellungen – Begrifflichkeiten
- 2.2 Lerntheoretischer Hintergrund
- 2.3 Conceptual Change
- 2.3.1 Definition
- 2.3.2 Bedingungen
- 2.3.3 Motivationale Faktoren
- 2.3.4 Modelle
- 2.3.5 Der Zusammenhang der unterschiedlichen theoretischen Ansätze
- 2.3.6 Der Umgang mit Conceptual Change im Unterricht
- 2.3.7 Herausforderungen der Conceptual-Change-Forschung
- 2.4 Modell der didaktischen Rekonstruktion
- 3 Forschungsstand
- 3.1 Umstrukturierung von Schülervorstellungen
- 3.2 Schülervorstellungen zum Aufbau des Erdinneren
- 4 Forschungsfragen
- 5 Forschungsdesign
- 5.1 Modell der didaktischen Rekonstruktion als Grundlage
- 5.1.1 Fachliche Klärung
- 5.1.2 Untersuchung der Schülervorstellungen
- 5.1.3 Didaktische Strukturierung
- 5.2 Methodische Überlegungen
- 5.2.1 Leitfadengestütztes Interview
- 5.2.2 Zeichnung
- 5.2.3 Gütebestimmung
- 5.3 Phasen der Untersuchung
- 5.3.1 Präkonzept
- 5.3.2 Intervention
- 5.3.3 Postkonzept
- 5.3.4 Reflexion
- 5.4 Lernumgebung nach POSNER et al. (1982)
- 5.4.1 Unzufriedenheit
- 5.4.2 Verständlichkeit
- 5.4.3 Plausibilität
- 5.4.4 Fruchtbarkeit
- 5.5 Sampling
- 5.1 Modell der didaktischen Rekonstruktion als Grundlage
- 6 Ergebnisse
- 6.1 Beschreibung der angewandten Verfahren
- 6.1.1 Qualitative Inhaltsanalyse
- 6.1.2 Diagnose von Schülerzeichnungen
- 6.1.3 Quantitative Erhebung
- 6.2 Auswertung
- 6.2.1 Präkonzept
- 6.2.2 Postkonzept
- 6.2.3 Veränderungen vom Prä- zum Postkonzept
- 6.2.4 Lernhinderliche Interventionen
- 6.2.5 Lernförderliche Interventionen
- 6.2.6 Interesse und zeitliche Bildung der Vorstellung
- 6.1 Beschreibung der angewandten Verfahren
- 7 Beantwortung der Forschungsfragen
- 8 Fazit und Schlussfolgerungen
- 8.1 Herausragende Ergebnisse
- 8.2 Grenzen der Forschungsarbeit
- 8.3 Forschungsdesiderata
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dissertation untersucht, wie lernförderliche Methoden in einer geeigneten Lernumgebung für einen Conceptual Change zum Aufbau der Erde entwickelt und deren Tragweite empirisch überprüft werden können. Ziel ist ein Beitrag zur Verbesserung des Geographieunterrichts und zur Weiterentwicklung der Conceptual-Change-Theorie.
- Entwicklung lernförderlicher Methoden für einen Conceptual Change.
- Empirische Überprüfung der Wirksamkeit der entwickelten Methoden.
- Analyse der Schülervorstellungen zum Aufbau der Erde vor und nach der Intervention.
- Identifizierung lernförderlicher und lernhinderlicher Interventionen.
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Interesse, zeitlicher Bildung der Vorstellung und fachwissenschaftlicher Nähe der Vorstellung.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit untersucht die Umstrukturierung von Schülervorstellungen zum Aufbau der Erde mithilfe einer didaktisch aufbereiteten Lernumgebung. Es werden Prä- und Postkonzepte analysiert, lernförderliche und -hinderliche Interventionen identifiziert und der Zusammenhang zwischen Interesse, Zeitpunkt der Vorstellungsbildung und fachwissenschaftlicher Nähe der Vorstellung untersucht. Der Ansatz von Posner et al. (1982) dient als theoretischer Rahmen.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar, basierend auf dem Konstruktivismus, der Conceptual-Change-Theorie und dem Modell der didaktischen Rekonstruktion. Es werden Schülervorstellungen, Lerntheorien und verschiedene Modelle des Conceptual Change erläutert, inklusive der Bedingungen für einen erfolgreichen Konzeptwechsel und der Rolle motivationaler Faktoren.
3 Forschungsstand: Dieser Abschnitt präsentiert einen Überblick über den Forschungsstand zur Umstrukturierung von Schülervorstellungen in verschiedenen naturwissenschaftlichen Fächern und speziell zum Aufbau der Erde. Er zeigt Forschungslücken auf und begründet die Notwendigkeit der vorliegenden Arbeit.
4 Forschungsfragen: Hier werden die zentralen Forschungsfragen der Dissertation formuliert, die sich auf die Möglichkeit und das Ausmaß eines erfolgreichen Conceptual Change zum Thema Aufbau der Erde beziehen.
5 Forschungsdesign: Das Kapitel beschreibt das Forschungsdesign, inklusive der methodischen Überlegungen (leitfadengestütztes Interview, Zeichnungen, quantitative Erhebung) und der vier Phasen der Untersuchung (Präkonzept, Intervention, Postkonzept, Reflexion). Das Modell der didaktischen Rekonstruktion bildet die Grundlage.
6 Ergebnisse: Dieser Abschnitt präsentiert die Ergebnisse der Studie, einschließlich der Beschreibung der verwendeten Verfahren (qualitative Inhaltsanalyse), der Auswertung der Prä- und Postkonzepte (Schülerzeichnungen, Multiple-Choice-Test) und der Analyse lernförderlicher und -hinderlicher Interventionen. Es werden auch die Zusammenhänge zwischen Interesse, zeitlicher Bildung der Vorstellung und fachwissenschaftlicher Nähe der Vorstellung untersucht.
Schlüsselwörter
Conceptual Change, Schülervorstellungen, Aufbau der Erde, Geographiedidaktik, Didaktische Rekonstruktion, Lernumgebung, qualitative Inhaltsanalyse, Posner-Modell, Motivation, Interesse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Dissertation: Conceptual Change zum Aufbau der Erde
Was ist das Thema der Dissertation?
Die Dissertation untersucht, wie lernförderliche Methoden in einer geeigneten Lernumgebung für einen Conceptual Change (Konzeptwandel) zum Aufbau der Erde entwickelt und deren Wirksamkeit empirisch überprüft werden können. Das Ziel ist ein Beitrag zur Verbesserung des Geographieunterrichts und zur Weiterentwicklung der Conceptual-Change-Theorie.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf dem Konstruktivismus, der Conceptual-Change-Theorie und dem Modell der didaktischen Rekonstruktion. Es werden Schülervorstellungen, Lerntheorien und verschiedene Modelle des Conceptual Change erläutert, inklusive der Bedingungen für einen erfolgreichen Konzeptwechsel und der Rolle motivationaler Faktoren. Das Modell von Posner et al. (1982) dient als theoretischer Rahmen.
Welche Forschungsmethoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet ein Mixed-Methods-Design. Qualitative Methoden umfassen leitfadengestützte Interviews und die Analyse von Schülerzeichnungen (qualitative Inhaltsanalyse). Quantitative Methoden beinhalten einen Multiple-Choice-Test. Die Untersuchung gliedert sich in vier Phasen: Präkonzept, Intervention, Postkonzept und Reflexion.
Welche Daten wurden erhoben und wie wurden sie ausgewertet?
Es wurden Daten zu den Schülervorstellungen zum Aufbau der Erde vor (Präkonzept) und nach (Postkonzept) einer didaktisch gestalteten Intervention erhoben. Die Auswertung umfasst eine qualitative Inhaltsanalyse der Interviews und Zeichnungen sowie eine quantitative Analyse der Testergebnisse. Es wurden lernförderliche und -hinderliche Interventionen identifiziert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse zeigen, inwieweit ein Conceptual Change zum Aufbau der Erde durch die entwickelten Methoden erreicht werden konnte. Es wird analysiert, welche Faktoren den Lernerfolg fördern oder behindern (z.B. Interesse, Zeitpunkt der Vorstellungsbildung, fachwissenschaftliche Nähe der Vorstellung). Die Ergebnisse werden im Detail in Kapitel 6 beschrieben.
Welche Forschungsfragen werden beantwortet?
Die zentralen Forschungsfragen beziehen sich auf die Möglichkeit und das Ausmaß eines erfolgreichen Conceptual Change zum Thema Aufbau der Erde. Konkret wird untersucht, wie effektiv die entwickelten lernförderlichen Methoden sind und welche Faktoren den Lernerfolg beeinflussen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen fassen die wichtigsten Ergebnisse zusammen, besprechen die Grenzen der Forschungsarbeit und formulieren Forschungsdesiderata für zukünftige Untersuchungen. Es werden herausragende Ergebnisse hervorgehoben und mögliche Verbesserungen der entwickelten Methoden diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Conceptual Change, Schülervorstellungen, Aufbau der Erde, Geographiedidaktik, Didaktische Rekonstruktion, Lernumgebung, qualitative Inhaltsanalyse, Posner-Modell, Motivation, Interesse.
Wie ist die Dissertation strukturiert?
Die Dissertation ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung, Theoretische Grundlagen, Forschungsstand, Forschungsfragen, Forschungsdesign, Ergebnisse, Beantwortung der Forschungsfragen und Fazit und Schlussfolgerungen. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis findet sich im Dokument.
Für wen ist diese Dissertation relevant?
Diese Dissertation ist relevant für Geographiedidaktiker, Lehrkräfte, Wissenschaftler im Bereich der Bildungsforschung und alle, die sich für Conceptual Change und die Verbesserung des naturwissenschaftlichen Unterrichts interessieren.
- Citation du texte
- Dr. Catharina Denk (Auteur), 2019, Lernförderliche Methoden für einen Conceptual Change von Schülervorstellungen zum Aufbau der Erde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/587993