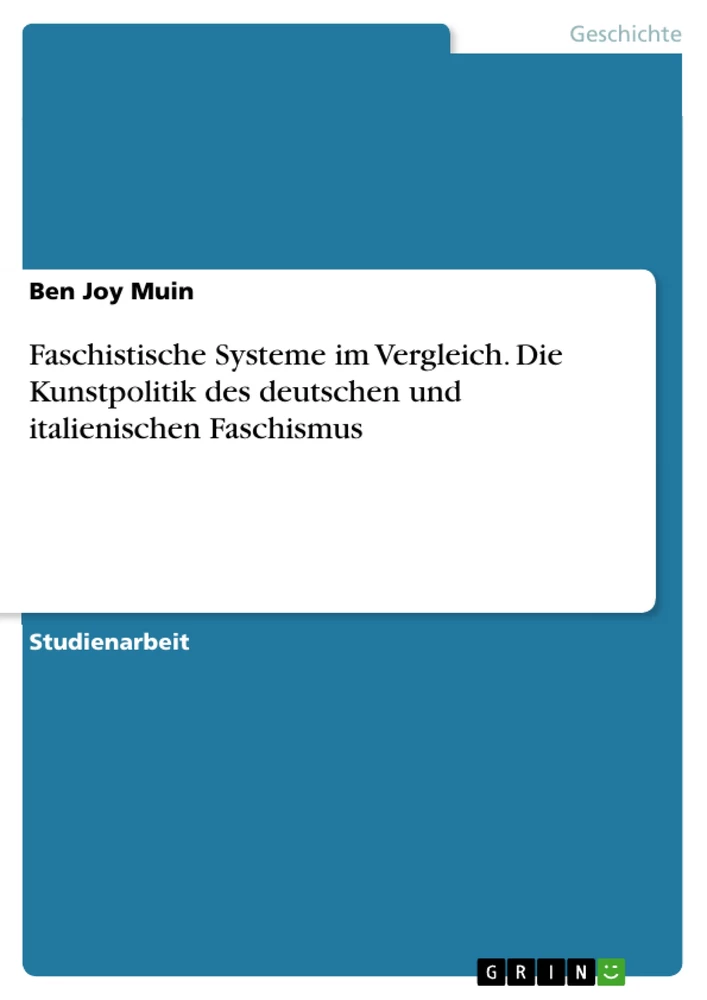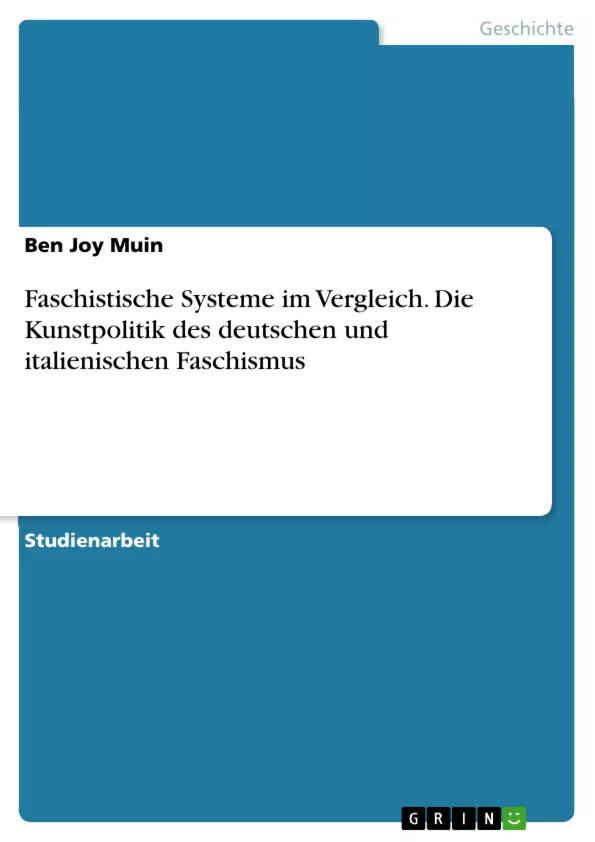Auch wenn Kunst und Kunstpolitik nur einen Teilbereich der Politik faschistischer System einnehmen, so geben sie doch Auskunft wie faschistische Systeme als Ganzes funktionieren, weshalb im Rahmen dieser Hausarbeit die Frage beantwortet werden soll, welchen Einfluss der Faschismus in Deutschland und Italien auf die Kunst hatte und ob es möglich ist daraus übergreifende Merkmale faschistischer Systeme zu erkennen.
Der historische Vergleich soll hier als Methode genutzt werden. Durch den analytischen Vergleich sollen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Systeme dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kunst in der Zeit des Italienischen Faschismus
- Faschismus und Futurismus
- Die Situation vor dem Marsch auf Rom
- Die Situation nach dem Marsch auf Rom
- Die Situation der Künstler
- Kunst im ,,Dritten Reich“
- Kunstpolitik in Deutschland
- „Deutsche Kunst“ und „Entartete Kunst“
- Die Situation der Künstler
- Der Kampf gegen die Moderne
- Vergleich Deutschland und Italien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss des Faschismus in Deutschland und Italien auf die Kunst. Sie analysiert die Kunstpolitik der jeweiligen Systeme und sucht nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden, um übergreifende Merkmale faschistischer Systeme im Bereich der Kunst aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Malerei, um den Umfang der Arbeit einzuschränken.
- Der Zusammenhang zwischen Faschismus und Futurismus in Italien
- Die Rolle der Kunstpolitik in der Durchsetzung der nationalistischen und faschistischen Ideologie
- Die Situation der Künstler unter dem Faschismus in Deutschland und Italien
- Der Umgang mit moderner Kunst in beiden Systemen
- Ein Vergleich der Kunstpolitik des deutschen und italienischen Faschismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit diskutiert die Schwierigkeiten bei der Definition von "Faschismus" und untersucht den Einfluss des Faschismus auf die Kunst in Deutschland und Italien, wobei der Fokus auf die Malerei liegt. Die Methode des historischen Vergleichs wird angewandt, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Systeme aufzuzeigen.
Kunst in der Zeit des Italienischen Faschismus
Obwohl die italienische Kunstpolitik stark vom Regime beeinflusst war, blieb die Kunstszene relativ aktiv und offen. Es wurden diverse Kunstrichtungen gefördert, Ausstellungen organisiert und Preise verliehen, jedoch immer im Rahmen der nationalistischen und faschistischen Ideologie. Die Arbeit untersucht die Verbindung zwischen Futurismus und Faschismus, die für das Verständnis der italienischen Kunstpolitik essenziell ist.
Kunst im ,,Dritten Reich“
Die Kunstpolitik im nationalsozialistischen Deutschland konzentrierte sich auf die Durchsetzung von "deutscher Kunst" und die Verfolgung von "entarteter Kunst". Die Arbeit analysiert die Auswirkungen dieser Politik auf die Künstler und den Kampf gegen die Moderne.
Schlüsselwörter
Faschismus, Kunstpolitik, Futurismus, Deutschland, Italien, Malerei, "Deutsche Kunst", "Entartete Kunst", Moderne, Nationalismus, totalitäres Regime, Historischer Vergleich.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterschied sich die Kunstpolitik im deutschen und italienischen Faschismus?
Während Italien diverse Richtungen wie den Futurismus duldete, verfolgte Deutschland die Moderne radikal als "entartete Kunst".
Was war die Verbindung zwischen Faschismus und Futurismus in Italien?
Der Futurismus mit seiner Verherrlichung von Geschwindigkeit und Gewalt bot ideologische Anknüpfungspunkte für das Regime Mussolinis.
Was bedeutete der Begriff 'Entartete Kunst' im Dritten Reich?
Damit diffamierten die Nationalsozialisten moderne Kunstrichtungen, die nicht ihrem rassistischen und nationalistischen Schönheitsideal entsprachen.
Welche Rolle hatte die Kunst in faschistischen Systemen?
Kunst diente als Propagandainstrument zur Festigung der Ideologie und zur Inszenierung der Macht des Staates.
Wie erging es Künstlern unter diesen Regimen?
In Deutschland erlebten sie Berufsverbote und Verfolgung, während italienische Künstler oft mehr Spielraum hatten, solange sie dem Regime nicht offen widersprachen.
- Quote paper
- Ben Joy Muin (Author), 2018, Faschistische Systeme im Vergleich. Die Kunstpolitik des deutschen und italienischen Faschismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/588002