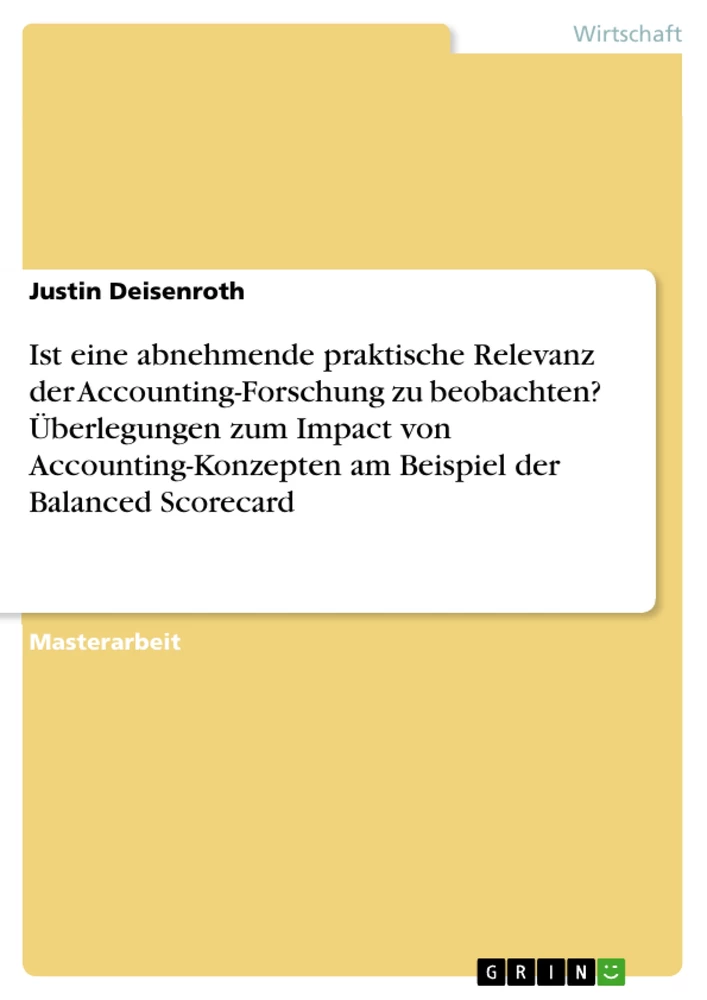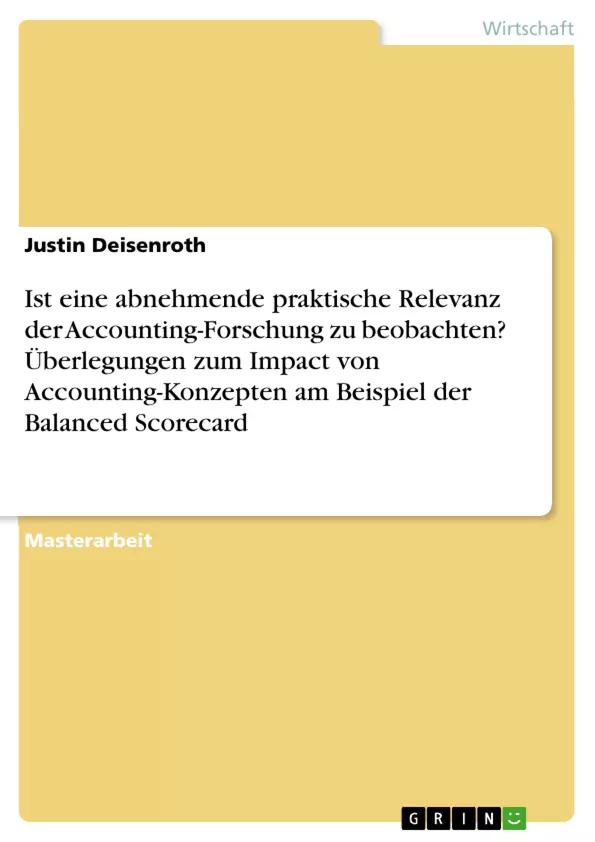Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, ob eine abnehmende praktische Relevanz in der Accounting-Forschung zu beobachten ist. Dazu orientiert sie sich an bestehenden Accounting-Konzepten, wobei genauer darauf eingegangen wird, ob in den letzten 30 Jahren eine Entfremdung zwischen Praxis und Forschung stattgefunden hat. Der bestehende Impact dieser Konzepte soll darüber Aufschluss geben, ob sich die heutige Accounting-Forschung von einem praktischen Problemlösungsansatz entfernt hat. Ebenso werden die Gründe für eine eventuelle Differenzierung dieser beiden Disziplinen dargelegt. Das hierzu verwendete Beispiel zum Impact von Accounting-Konzepten ist die Balanced Scorecard, die von Kaplan und Norton im Jahre 1992 das erste Mal in der Zeitschrift „Harvard Business Review“ veröffentlicht wurde.
Ausschlaggebend für diese Fragestellungen ist der Artikel von Christopher Humphrey und Yves Gendron „What is going on? The sustainability of accounting academia“. Die Autoren behaupten, dass Karriere und institutionell geprägte Forschung mehr in den Vordergrund gerückt sei. Dabei legen die Forscher mehr Wert auf ihren beruflichen Werdegang als auf die Relevanz der Forschung. Es gilt zu prüfen, ob die Faktoren der Relevanz der Forschung nicht auch mit persönlichen Karrierezielen vereinbar sind.
Zur Klärung dieser Frage müssen die Beweggründe der Forschung klargestellt werden. Woran wird der Erfolg der Forschung gemessen? Als Ansatz können viele verschiedene Möglichkeiten überprüft werden, wie man die unterschiedlichen Herangehensweisen und den Erfolg von Forschung bewerten kann. Es gilt zu überprüfen, ob eine Diffusion von Wissen aus der Wissenschaft in die Praxis überhaupt als ein relevantes und beabsichtigtes Ziel in Betracht gezogen wird. Hierzu stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, den Erfolg von Forschungsarbeiten darzulegen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsdesign
- 3. Accounting-Forschung
- 3.1 Paradigmenwechsel in der Entwicklung der Accounting-Forschung
- 3.2 Entfremdung durch Paradigmenwechsel
- 3.2.1 Anreizsysteme
- 3.2.2 Veränderungen des Umfeldes
- 3.3 Der Wandel als Fortschritt?
- 4. Die persönlichen Anreizsysteme der Forscherinnen und Forscher
- 4.1 Ursprung der Forschungsfrage
- 4.2 Gesellschaftliche Relevanz
- 4.3 Innovation
- 4.4 Gap-Spotting-Research
- 4.5 Kostenkontrolle
- 5. Impact
- 5.1 Was ist der Impact der Accounting-Forschung und wie sieht dessen Diffusion aus?
- 5.1.1 Der direkte und indirekte Impact als Diffusionsweg
- 5.1.2 Journals
- 5.2 Qualität von Forschung
- 5.3 Sprache
- 5.1 Was ist der Impact der Accounting-Forschung und wie sieht dessen Diffusion aus?
- 6. Balanced Scorecard
- 6.1 Wie kam es zur Idee der BSC?
- 6.2 Wie wurde die BSC erforscht?
- 6.3 Impact der BSC
- 6.4 Ist so etwas wie die Balanced Scorecard heute noch einmal möglich?
- 7. Conclusion
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob eine abnehmende praktische Relevanz in der Accounting-Forschung zu beobachten ist. Sie analysiert, ob in den letzten 30 Jahren eine Entfremdung zwischen Praxis und Forschung stattgefunden hat, indem sie den Impact bestehender Accounting-Konzepte, insbesondere der Balanced Scorecard, untersucht. Die Arbeit hinterfragt, ob sich die heutige Accounting-Forschung von einem praktischen Problemlösungsansatz entfernt hat und untersucht die Gründe für eine mögliche Differenzierung zwischen Theorie und Praxis.
- Die Entwicklung von Paradigmenwechseln in der Accounting-Forschung und deren Auswirkungen auf die Relevanz der Forschung für die Praxis.
- Die persönlichen Anreizsysteme von Forschenden und deren Einfluss auf die praktische Relevanz der Forschung.
- Der Impact von Accounting-Konzepten auf die Praxis und die Diffusion von Wissen aus der Wissenschaft in die Praxis.
- Die Balanced Scorecard als Beispiel für ein Accounting-Konzept und dessen Impact auf die Praxis.
- Die Frage, ob ein Konzept wie die Balanced Scorecard heute noch einmal möglich wäre.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der abnehmenden praktischen Relevanz der Accounting-Forschung und erläutert die Bedeutung des Themas. Kapitel 2 beschreibt das Forschungsdesign der Arbeit. Kapitel 3 analysiert den Paradigmenwechsel in der Entwicklung der Accounting-Forschung, die Entfremdung durch diesen Wandel und dessen Einfluss auf die praktische Relevanz. Kapitel 4 untersucht die persönlichen Anreizsysteme von Forschenden und deren Einfluss auf die praktische Relevanz der Forschung. Kapitel 5 beleuchtet den Impact von Accounting-Forschung und die Diffusion von Wissen aus der Wissenschaft in die Praxis. Kapitel 6 analysiert die Balanced Scorecard als Beispiel für ein Accounting-Konzept und dessen Impact auf die Praxis.
Schlüsselwörter
Accounting-Forschung, Paradigmenwechsel, praktische Relevanz, Impact, Diffusion, Balanced Scorecard, Anreizsysteme, Forschungsethik, Gesellschaftliche Relevanz.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es eine Entfremdung zwischen Accounting-Forschung und Praxis?
Die Arbeit untersucht die These, dass Forscher heute mehr Wert auf akademische Karrieren und Publikationen in Fachjournalen legen als auf die Lösung praktischer Probleme in Unternehmen.
Was ist der „Impact“ von Accounting-Konzepten?
Impact bezeichnet die messbare Wirkung wissenschaftlicher Konzepte auf die Unternehmenspraxis. Die Arbeit analysiert dies am Beispiel der Balanced Scorecard (BSC), die eine enorme Verbreitung fand.
Warum wurde die Balanced Scorecard als Beispiel gewählt?
Die BSC von Kaplan und Norton (1992) gilt als eines der erfolgreichsten Konzepte, das den Transfer von der Forschung in die Praxis geschafft hat. Sie dient als Benchmark für heutigen Forschungs-Impact.
Welche Rolle spielen Anreizsysteme für Forscher?
Akademische Karrieren hängen oft von Veröffentlichungen in hochgelisteten Journals ab. Dies kann dazu führen, dass Themen gewählt werden, die theoretisch komplex (Gap-Spotting), aber praktisch wenig relevant sind.
Was bedeutet „Diffusion von Wissen“?
Diffusion beschreibt den Prozess, wie wissenschaftliche Erkenntnisse ihren Weg in die Praxis finden – entweder direkt durch Beratung oder indirekt durch Fachzeitschriften und Ausbildung.
Wäre ein Konzept wie die Balanced Scorecard heute noch möglich?
Die Arbeit diskutiert, ob die heutigen strengen akademischen Anforderungen und die Spezialisierung der Forschung die Entstehung solch breit anwendbarer Praxiskonzepte eher verhindern.
- Arbeit zitieren
- Justin Deisenroth (Autor:in), 2020, Ist eine abnehmende praktische Relevanz der Accounting-Forschung zu beobachten? Überlegungen zum Impact von Accounting-Konzepten am Beispiel der Balanced Scorecard, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/588074