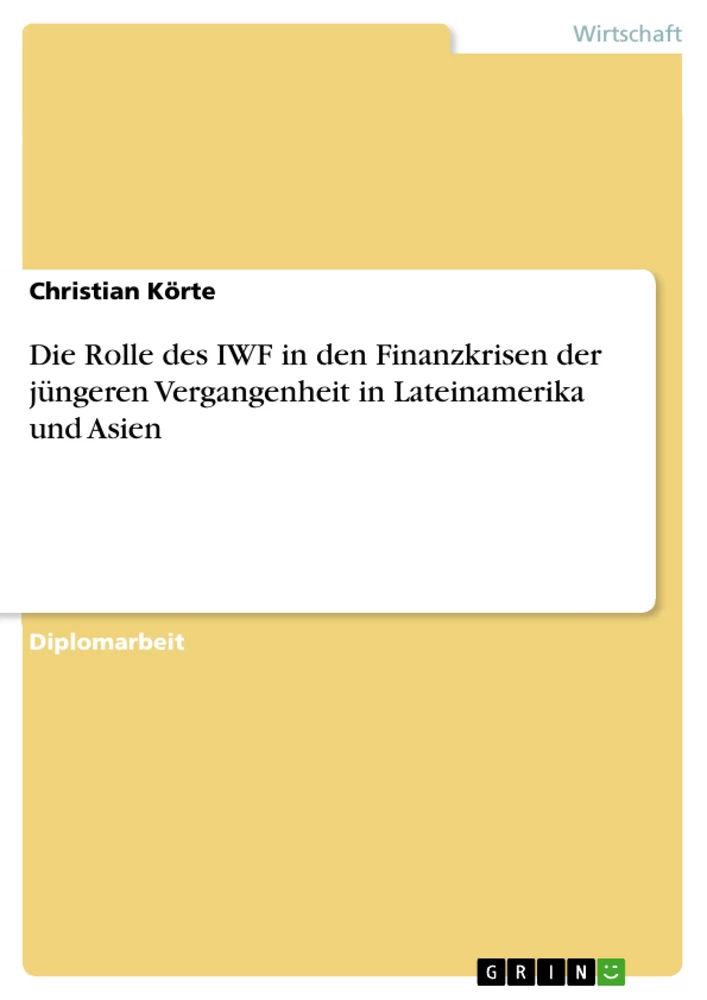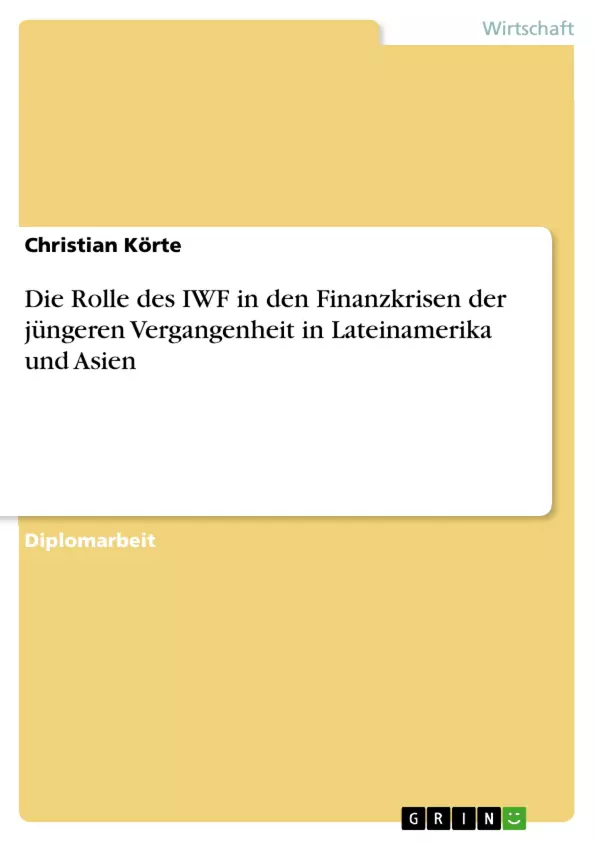Die Globalisierung der internationalen Märkte hat den Entwicklungs- und Schwellenländern dieser Welt viele Vorteile gebracht. Aufgrund einer großen Verfügbarkeit von natürlichen Ressourcen sowie den Lohnkostenvorteilen gegenüber den westlichen Industrieländern ist ihr Anteil am Welthandel stetig gestiegen. In den 80ern und 90ern sind in den meisten Ländern Asiens und Lateinamerikas die Handelsbeschränkungen fast vollständig beseitigt worden. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass diese Länder für ausländische Investoren zunehmend attraktiver wurden. Die Liberalisierung der Handels- und Kapitalmärkte hat die aufstrebenden Länder jedoch auch verwundbarer gegenüber externen Einflüssen gemacht. Da die Öffnung der nationalen Märkte ohne entsprechende Rahmenbedingungen begleitet wurde, z.B. fehlte oft eine effiziente Bankenaufsicht, wurden die Länder anfällig gegenüber kurzfristigen Kapitalzuflüssen, die sofort wieder abgezogen werden können, sobald die Investoren ihr Kapital in Gefahr sehen. Verstärkt wurde diese Entwicklung noch durch die Gewinnaussichten der Spekulanten, die auf die Abwertung einer Währung spekulieren, und wenn diese dann schließlich auch abgewertet wird, beträchtliche Gewinne erzielen können. Die Finanzkrisen in Mexiko 1994/95, Ostasien 1997/98, Russland 1998, Brasilien 1998/99, Türkei 2001 und Argentinien 2001/2002 sind der Beweis dafür, dass mit einer globalisierten Welt auch große Gefahren verbunden sind, die in den betroffenen Ländern die Arbeitslosigkeit und die Armut in der Bevölkerung anwachsen lassen. Im Rahmen dieser Finanzkrisen geriet auch der Internationale Währungsfonds (IWF) zunehmend in den Mittelpunkt der Kritik. Die Haltung, dass die Programme des IWF die Krisen noch verschärften, vertreten nicht nur Globalisierungskritiker, sondern auch bedeutende Ökonomen wie Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs oder Paul Krugman. Diese Arbeit hat daher zum Ziel, die Rolle des IWF in den Finanzkrisen in Ostasien und Lateinamerika näher zu untersuchen und zu beurteilen, ob die an dem IWF geäußerte Kritik berechtigt ist. Zunächst sollen in Kapitel 2 dieser Arbeit die Entstehung und Entwicklung des IWF, seine Organisation, seine Finanzierungspolitik sowie die verschiedenen Fazilitäten und Maßnahmen, die ihm zur Unterstützung seiner Mitgliedsländer zur Verfügung stehen, aufgezeigt werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung und Gang der Untersuchung
- Der Internationale Währungsfonds
- Entstehung und Entwicklung des IWF
- Die Organisation des IWF
- Die drei Hauptfunktionen des IWF
- Überwachung
- Finanzhilfen
- Technische Hilfen
- Finanzierung und Kreditfazilitäten
- Finanzierungspolitik
- Kreditfazilitäten
- Reguläre Kreditfazilitäten
- Sonderfazilitäten
- Konzessionäre Hilfe
- Das Prinzip der Konditionalität
- Entstehung und Ausbreitung von Finanzkrisen
- Entstehung von Finanzkrisen
- Modelle der ersten Generation
- Modelle der zweiten Generation
- Modelle der dritten Generation
- Übertragung von Finanzkrisen
- Spillover-Effekte
- Wake-up call
- Pure Contagion
- Die Asienkrise 1997/1998
- Ostasien vor der Krise
- Ausbruch und Verlauf der Krise
- Die Hilfsprogramme des IWF
- Thailand
- Indonesien
- Südkorea
- Malaysias Sonderweg ohne IWF-Unterstützung
- Bewertung der IWF-Maßnahmen in Ostasien
- Finanzkrisen in Lateinamerika
- Die mexikanische Peso-Krise
- Die Brasilien-Krise
- Der Plano Real und die Entwicklung bis zur Finanzkrise 1998/1999
- Das erste Abkommen mit dem IWF und das Ende des Plano Real
- Das überarbeitete Abkommen vom 18.3.1999
- Brasiliens weitere Entwicklung bis zur Rückzahlung der IWF-Kredite
- Die Krise in Argentinien 2001/2002
- Argentinien in den Neunziger Jahren
- Die Entwicklung bis zur Finanzkrise
- Der Ausbruch der Finanzkrise 2001/2002
- Ansteckungseffekte durch die Argentinien-Krise
- Argentiniens wirtschaftliche Erholung
- Bewertung der IWF-Maßnahmen in Lateinamerika
- Maßnahmen zur Vermeidung von Finanzkrisen
- Einbeziehung des privaten Sektors
- Kapitalverkehrskontrollen
- Tobin-Steuer
- Verbesserung der Transparenz
- Die zukünftige Rolle des IWF
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Rolle des Internationalen Währungsfonds (IWF) in den Finanzkrisen der jüngeren Vergangenheit in Lateinamerika und Asien. Ziel ist es, die Funktionsweise des IWF und seine Rolle in der Bewältigung von Finanzkrisen zu analysieren. Zudem soll untersucht werden, inwieweit die IWF-Maßnahmen zur Stabilisierung der Krisenländer erfolgreich waren.
- Die Funktionsweise und Organisation des IWF
- Die Entstehung und Ausbreitung von Finanzkrisen
- Die Rolle des IWF in der Bewältigung von Finanzkrisen
- Die Analyse der IWF-Maßnahmen in den Asienkrise 1997/1998 und den Finanzkrisen in Lateinamerika
- Maßnahmen zur Vermeidung von Finanzkrisen und die zukünftige Rolle des IWF
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Problemstellung der Arbeit vor und beschreibt den Gang der Untersuchung. Kapitel zwei beschäftigt sich mit dem IWF, seiner Entstehung, Organisation, Funktionen und Finanzierung. Dabei werden insbesondere die drei Hauptfunktionen des IWF, Überwachung, Finanzhilfen und technische Hilfen, näher beleuchtet. Das Prinzip der Konditionalität, das die Bereitstellung von Finanzhilfen durch den IWF an bestimmte Bedingungen knüpft, wird ebenfalls erläutert.
Kapitel drei behandelt die Entstehung und Ausbreitung von Finanzkrisen. Es werden verschiedene Modelle zur Erklärung der Entstehung von Finanzkrisen vorgestellt, die in drei Generationen unterteilt werden. Außerdem werden die verschiedenen Mechanismen der Übertragung von Finanzkrisen, wie Spillover-Effekte, Wake-up call und Pure Contagion, erklärt.
Kapitel vier analysiert die Asienkrise 1997/1998. Dabei wird die Situation in Ostasien vor der Krise, der Ausbruch und Verlauf der Krise sowie die Hilfsprogramme des IWF für Thailand, Indonesien und Südkorea untersucht. Außerdem wird der Sonderweg Malaysias ohne IWF-Unterstützung beleuchtet.
Kapitel fünf befasst sich mit den Finanzkrisen in Lateinamerika. Es werden die mexikanische Peso-Krise, die Brasilien-Krise und die Krise in Argentinien 2001/2002 analysiert. Dabei werden die jeweiligen Krisenverläufe, die IWF-Maßnahmen und deren Bewertung diskutiert.
Kapitel sechs beschäftigt sich mit Maßnahmen zur Vermeidung von Finanzkrisen. Es werden verschiedene Ansätze vorgestellt, wie zum Beispiel die Einbeziehung des privaten Sektors, Kapitalverkehrskontrollen, die Tobin-Steuer, die Verbesserung der Transparenz und die zukünftige Rolle des IWF.
Das letzte Kapitel bietet einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des IWF und die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit in der Bewältigung von Finanzkrisen.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit behandelt zentrale Themen der internationalen Finanzwirtschaft, insbesondere die Rolle des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Finanzkrisen, Konditionalität, Finanzhilfen, Entstehung und Übertragung von Finanzkrisen, Asienkrise 1997/1998, mexikanische Peso-Krise, Brasilien-Krise, Argentinien-Krise 2001/2002, Maßnahmen zur Vermeidung von Finanzkrisen und die zukünftige Rolle des IWF.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptfunktionen des Internationalen Währungsfonds (IWF)?
Die drei Hauptfunktionen sind die Überwachung der internationalen Währungspolitik, die Bereitstellung von Finanzhilfen (Krediten) und die technische Unterstützung der Mitgliedsländer.
Warum wird der IWF oft kritisiert?
Kritiker wie Joseph Stiglitz werfen dem IWF vor, dass seine strengen Sparauflagen (Konditionalität) Krisen in Schwellenländern oft verschärft statt gelöst haben.
Was geschah während der Asienkrise 1997/1998?
Länder wie Thailand, Indonesien und Südkorea erlebten massive Währungsabstürze. Der IWF griff mit Hilfsprogrammen ein, während Malaysia einen erfolgreichen Sonderweg ohne IWF-Hilfe wählte.
Was versteht man unter dem Prinzip der Konditionalität?
Konditionalität bedeutet, dass der IWF Kredite nur unter der Bedingung gewährt, dass das Empfängerland bestimmte wirtschaftspolitische Reformen und Sparmaßnahmen umsetzt.
Wie entstehen Ansteckungseffekte (Contagion) bei Finanzkrisen?
Finanzkrisen können durch Handelsverflechtungen (Spillover), verändertes Investorenverhalten (Wake-up call) oder rein psychologische Faktoren (Pure Contagion) von einem Land auf andere Regionen übergreifen.
- Arbeit zitieren
- Christian Körte (Autor:in), 2006, Die Rolle des IWF in den Finanzkrisen der jüngeren Vergangenheit in Lateinamerika und Asien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58890