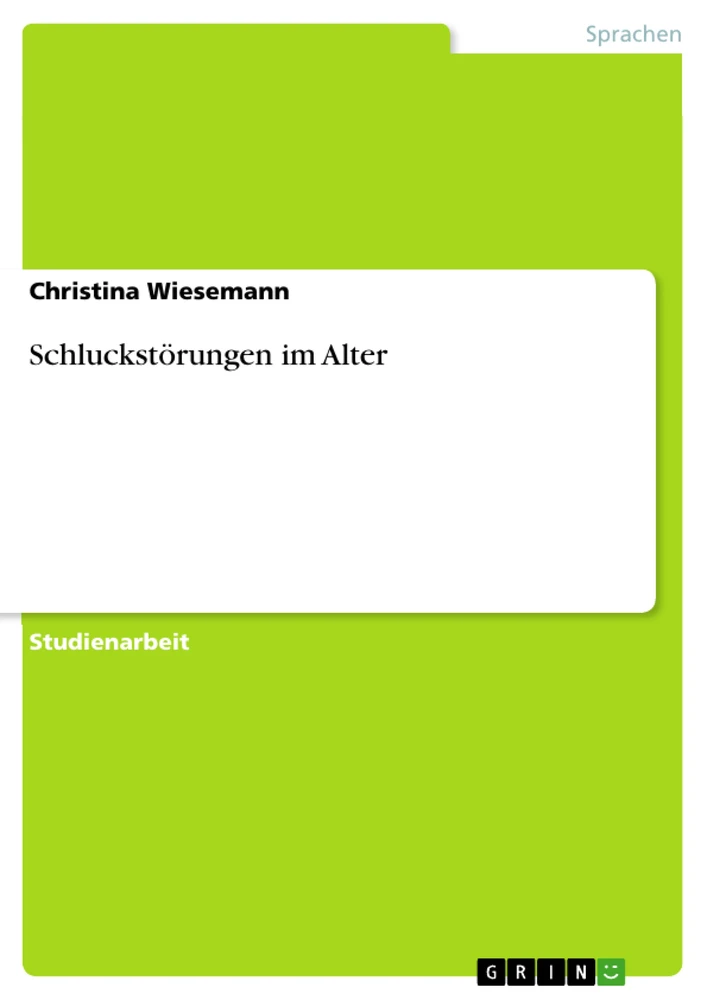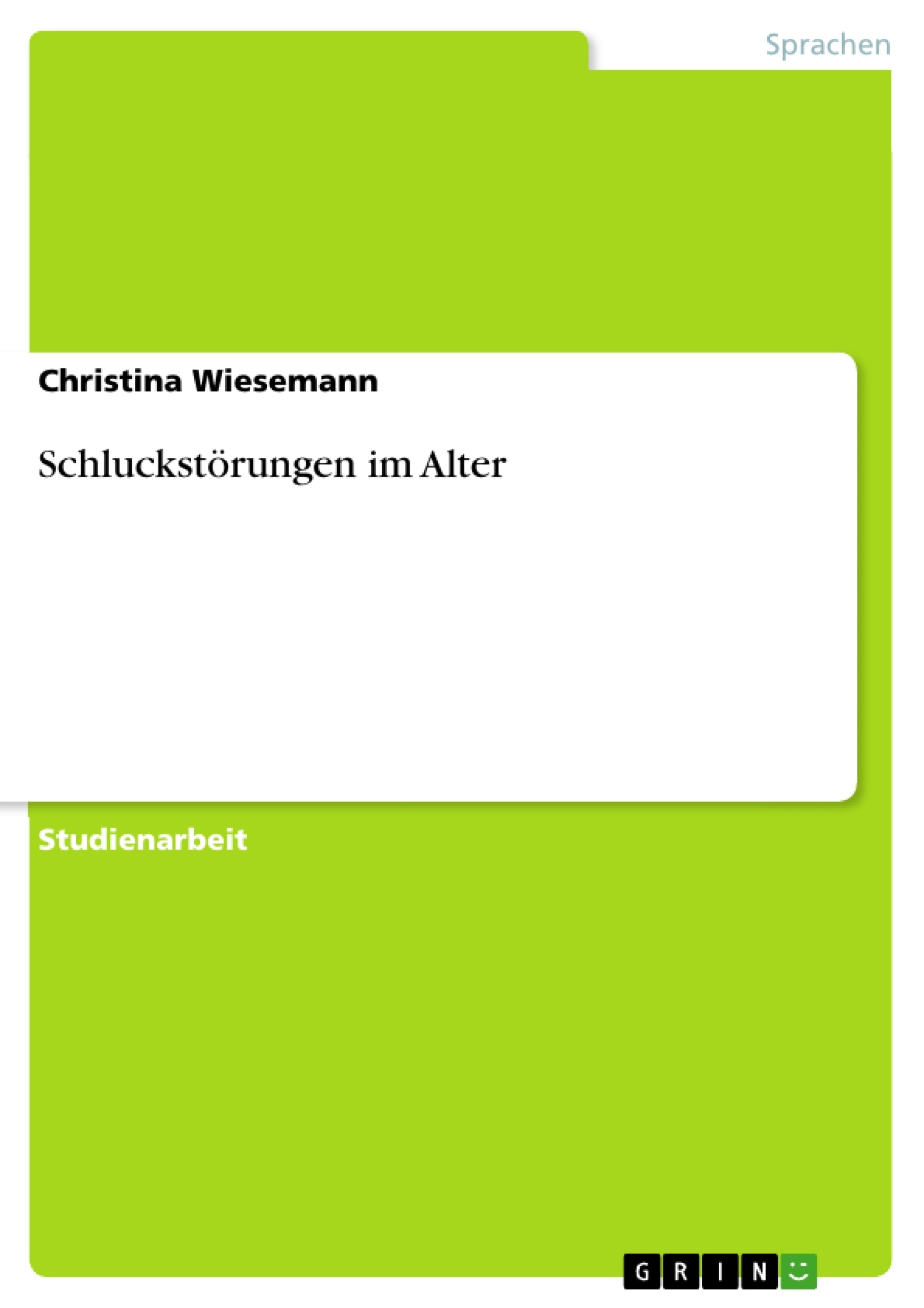Die vorliegende Arbeit, welche im Rahmen des Kompaktseminares „Dysphagie: Diagnostik und Behandlung schluckgestörter Menschen“ entstanden ist, trägt den Titel „Schluckstörungen im Alter“ und setzt sich mit elementaren Aspekten des angesprochenen Gegenstandsbereiches auseinander. Ich habe mich aus dem einfachen Grund für dieses Thema entschieden, dass ein großes persönliches Interesse hinsichtlich des Gegenstandsbereiches vorherrscht. In meinem bisherigen Studium wurden Schluckstörungen im Alter nur marginal thematisiert, so dass aus meiner Sicht noch einige Fragen und Informationen im Unklaren sind. Durch das Verfassen dieser Abhandlung möchte ich meinen Horizont in dieser Hinsicht erweitern. Im Allgemeinen ist der Themenpunkt der Schluckstörungen als äußerst vielschichtig zu bezeichnen. Der Schluckvorgang ist untrennbar mit dem alltäglichen Leben eines Menschen verbunden. Er dient beispielsweise der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme und hat somit Einfluss auf lebensnotwendige Faktoren. Am Tag schluckt ein erwachsener Mensch annährend bis zu 2000 Mal. In der Nacht schluckt man zwar nicht so häufig wie tagsüber, allerdings ist es dennoch erforderlich, dass der Speichel durch die Zunge und die Wangenmuskulatur erst in den Rachenbereich und anschließend in die Speiseröhre befördert wird. Ist der reguläre Schluckvorgang gestört, aus welchen Gründen auch immer, so bedeutet diese Tatsache gravierende Konsequenzen für jeden betroffenen Menschen. Schluckstörungen treten in sämtlichen denkbaren Altersklassen auf. Unabhängig davon, ob Dysphagien primär mit bestimmten Altersklassen einhergehen, sind sie doch als dominantes Krankheitsbild bei der älteren Generation vorherrschend. Mit zunehmendem Alter wandelt sich die Schluckphysiologie und in Wechselwirkung mit verschiedenen anderen Einflussfaktoren wie beispielsweise der körperlichen Konstitution eines alten Menschen treten spezifische Veränderungen auf. Sich mit dem Thema der Schluckstörungen im Alter zu beschäftigen, erachte ich als interessantes Unterfangen. Nachfolgend möchte ich darstellen, welche inhaltlichen Bezüge ich in meiner Ausarbeitung zu thematisieren gedenke. Zu Beginn der Abhandlung liegt es nahe, einen Fokus auf grundlegende Informationen den Schluckvorgang betreffend zu legen. Dies beinhaltet zunächst eine präzise Beschreibung des regulären Schluckvorgangs am Gegenstand der einzelnen Phasen des Schluckaktes. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegende Informationen
- Der reguläre Schluckvorgang
- Begriffsklärung – Was ist eine Dysphagie?
- Anzeichen für eine Schluckstörung
- Veränderungen der Schluckphysiologie im Alter
- Zusammenhang von Dysphagien und Alter
- Presbyphagie
- Konsequenzen der Presbyphagie in den einzelnen Phasen des Schluckaktes
- Erkrankungen neurodegnerativer Art im Kontext von Dysphagie im Alter
- Demenz
- Morbus Parkinson
- Amyotrophische Lateralsklerose
- Myasthenia gravis
- Erkrankungen (partiell-) reversibler Art
- Logopädische Therapie bei Altersschluckstörungen
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit, entstanden im Rahmen des Kompaktseminares „Dysphagie: Diagnostik und Behandlung schluckgestörter Menschen“, befasst sich mit Schluckstörungen im Alter. Die Arbeit zielt darauf ab, ein grundlegendes Verständnis für die Thematik zu schaffen, indem sie den regulären Schluckvorgang, die Definition von Dysphagie, Anzeichen für Schluckstörungen und die Auswirkungen von Alterungsprozessen auf die Schluckphysiologie beleuchtet.
- Der reguläre Schluckvorgang und seine Phasen
- Die Definition von Dysphagie und ihre Anzeichen
- Veränderungen der Schluckphysiologie im Alter
- Erkrankungen, die zu Schluckstörungen im Alter führen
- Möglichkeiten und Grenzen der logopädischen Therapie bei Dysphagien im Alter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt das Thema Schluckstörungen im Alter ein und erläutert die Motivation des Autors. Kapitel 2 beleuchtet grundlegende Informationen zum Schluckvorgang, einschließlich einer Definition von Dysphagie und der Identifizierung von Anzeichen für eine Schluckstörung. Kapitel 3 befasst sich mit den Veränderungen der Schluckphysiologie im Alter, insbesondere mit der Presbyphagie und deren Auswirkungen auf die einzelnen Phasen des Schluckaktes. Es werden außerdem Erkrankungen neurodegenerativer und (partiell-) reversibler Art im Kontext von Schluckstörungen im Alter beschrieben.
Schlüsselwörter
Dysphagie, Schluckstörung, Alter, Presbyphagie, neurodegenerative Erkrankungen, Demenz, Morbus Parkinson, Amyotrophische Lateralsklerose, Myasthenia gravis, logopädische Therapie, Lebensqualität
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Dysphagie?
Eine Dysphagie ist eine Störung des Schluckvorgangs. Sie kann die Aufnahme von Nahrung, Flüssigkeit oder Speichel beeinträchtigen und zu lebensbedrohlichen Komplikationen wie Aspiration führen.
Was versteht man unter Presbyphagie?
Presbyphagie bezeichnet die natürlichen, altersbedingten Veränderungen des Schluckvorgangs, die noch keinen Krankheitswert haben müssen, aber die Anfälligkeit für Schluckstörungen erhöhen.
Welche Anzeichen deuten auf eine Schluckstörung im Alter hin?
Häufiges Räuspern oder Husten während des Essens, das Gefühl, dass Nahrung im Hals stecken bleibt, eine belegte Stimme nach dem Schlucken oder ungewollter Gewichtsverlust sind Warnsignale.
Welche Krankheiten verursachen oft Schluckstörungen im Alter?
Neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz, Morbus Parkinson, ALS oder Myasthenia gravis sind häufige Ursachen für schwere Dysphagien bei älteren Menschen.
Wie kann Logopädie bei Altersschluckstörungen helfen?
Logopäden trainieren die am Schlucken beteiligte Muskulatur, vermitteln spezielle Schlucktechniken und beraten zur Anpassung der Nahrungskonsistenz, um die Sicherheit beim Essen zu erhöhen.
Wie oft schluckt ein Mensch pro Tag?
Ein gesunder erwachsener Mensch schluckt etwa 2000 Mal am Tag, um Nahrung, Flüssigkeit und den produzierten Speichel zu befördern.
- Citar trabajo
- Christina Wiesemann (Autor), 2006, Schluckstörungen im Alter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58898