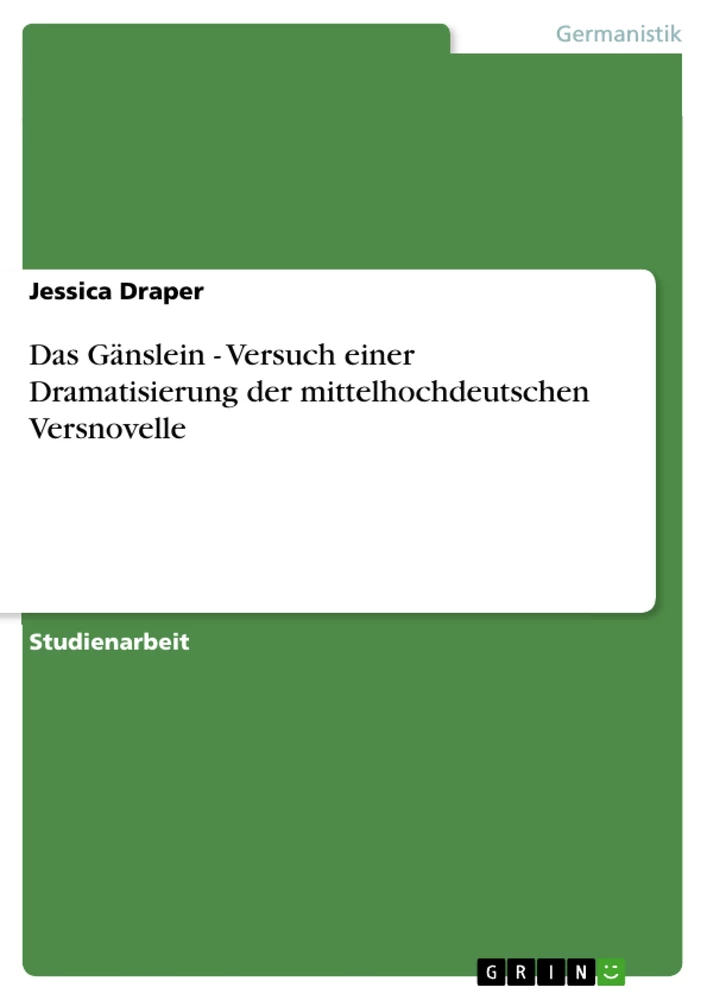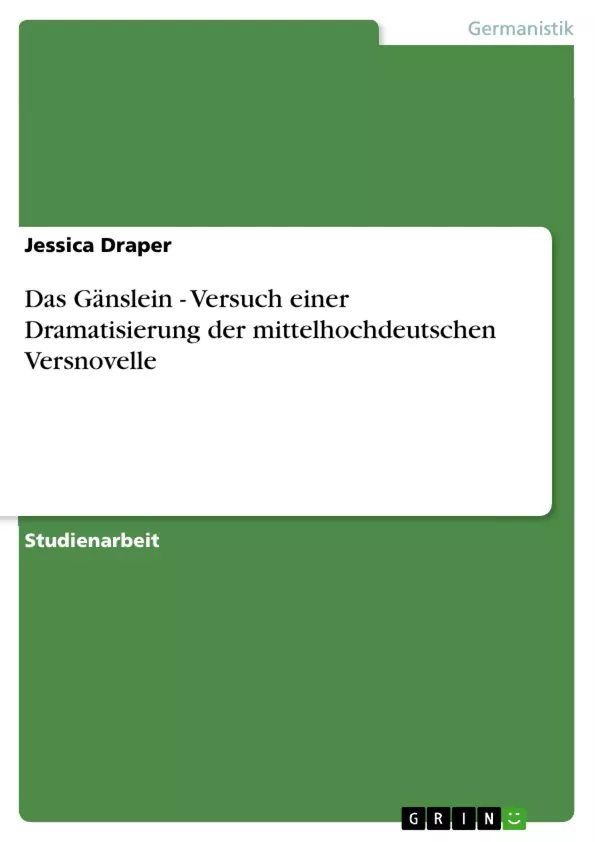Bei der Lektüre des Märe des „Gänslein“ und der vorausgegangenen Überlegung, dramatische Strukturen und dramatisierende Elemente dieser mittelalterlichen Versnovelle, mit dem Hintergrund einer dem Satz als solches immanenten Dramatik herauszuarbeiten, wurden zunächst dramentypische Züge erkennbar, indem eine szenische Unterteilung des Märe bereits in diesem angelegt waren. Durch die, einem jeden Märe eigene, Instanz des Erzählers und durch eine mehr oder weniger dichte Dialogizität der handelnden Personen, wäre eine weitere Grundlage der Theatralität geschaffen. In dieser Arbeit stelle ich mir die Aufgabe, das Märe des „Gänslein“ in eine dramatische Struktur, bis hin zu einem dramatischen Text mitsamt Regieanweisungen, Bühnengestaltung und Dialogen der Akteure zu überführen, wobei sich mir die Frage einer tatsächlichen Aufführbarkeit dieser Versnovelle stellt. Neben der Überlieferungsgeschichte, der literarhistorischen Einordnung des Märe und seiner Motivgeschichte, werde ich das Hauptaugenmerk auf die Theatralität dessen richten und vor allem auf eine dramatische Umsetzung, welche im Anhang dieser Arbeit ausgeführt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Überlieferung
- Literarhistorische Einordnung
- Motivgeschichte
- Zum Gänslein und dessen immanenter Motivik
- Dispositionsschema
- Dramenschema nach Gustav Freytag
- Überführung des Märe in eine dramatische Struktur
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der dramatischen Umsetzung des mittelalterlichen Märe „Das Gänslein“. Sie analysiert das Märe auf seine theatralischen Elemente und untersucht, wie es in eine dramatische Struktur überführt werden kann. Dabei werden Fragen der Überlieferung, der literarhistorischen Einordnung und der Motivgeschichte des Märe betrachtet.
- Theatralität des Märe „Das Gänslein“
- Dramatisierung mittelalterlicher Versnovelle
- Überlieferung und literarhistorische Einordnung
- Motivgeschichte und -struktur
- Dramenschema nach Gustav Freytag
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit behandelt die Überlieferung des Märe „Das Gänslein“. Es wird erläutert, dass der Autor des Märe anonym bleibt und die Versnovelle in verschiedenen Handschriften überliefert wurde. Die unterschiedlichen Versionen werden dabei näher betrachtet und ihre Beziehungen zueinander analysiert. Die Arbeit geht auf die literarhistorische Einordnung des Märe ein und zeigt, dass die mittelalterliche epische Kleindichtung im 13. Jahrhundert ihren Höhepunkt erlebte. Sie beschreibt die Verbreitung dieser Gattung im deutschen Sprachraum und ihren Einfluss auf die Schwankliteratur. Zudem werden die Vorbilder der Schwankliteratur und die Entwicklung der Gattung vom Mittelalter bis zum 13. Jahrhundert erläutert.
Im dritten Kapitel der Arbeit wird die Motivgeschichte des Märe „Das Gänslein“ beleuchtet. Es wird gezeigt, dass das Märe verschiedene Motivkomplexe aufweist, die für die mittelalterliche Literatur charakteristisch sind. Die Arbeit behandelt Themen wie Liebe, Sünde und menschliche Triebe und analysiert, wie diese in der Versnovelle dargestellt werden.
Das vierte Kapitel widmet sich dem Gänslein als Motiv und seiner Bedeutung innerhalb der Motivgeschichte des Märe. Es wird untersucht, wie das Gänslein als Symbol für menschliche Eigenschaften und Schwächen interpretiert werden kann. Die Arbeit beleuchtet zudem die dramatische Verwendung des Motivs im Märe.
Schlüsselwörter
Das Märe „Das Gänslein“ bietet ein breites Feld für die Analyse mittelalterlicher Versnovelle, Schwankliteratur, Dramatisierung, Theatralität, Überlieferung, literarhistorische Einordnung und Motivgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein „Märe“ in der mittelalterlichen Literatur?
Ein Märe ist eine kurz- bis mittellange Versnovelle in mittelhochdeutscher Sprache, die oft schwankhafte oder moralisierende Inhalte hat.
Worum geht es in dem Märe „Das Gänslein“?
Die Erzählung behandelt menschliche Triebe, Sünde und Liebe auf humorvolle Weise und nutzt das Motiv des Gänsleins als Symbol für menschliche Schwächen.
Wie kann man eine Versnovelle dramatisieren?
Durch die Überführung der Erzählerinstanz in Dialoge und Szenen sowie die Ergänzung von Regieanweisungen und Bühnengestaltung wird aus dem epischen Text ein Drama.
Was ist das Dramenschema nach Gustav Freytag?
Es ist ein klassisches Modell des Dramenaufbaus in fünf Akten: Exposition, steigende Handlung, Höhepunkt, fallende Handlung und Katastrophe/Lösung.
Welche Rolle spielt die Theatralität in mittelalterlichen Texten?
Viele Mären enthalten bereits immanente dramatische Strukturen wie dichte Dialoge und szenische Wechsel, die eine Aufführung oder Dramatisierung nahelegen.
- Quote paper
- Jessica Draper (Author), 2005, Das Gänslein - Versuch einer Dramatisierung der mittelhochdeutschen Versnovelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58927