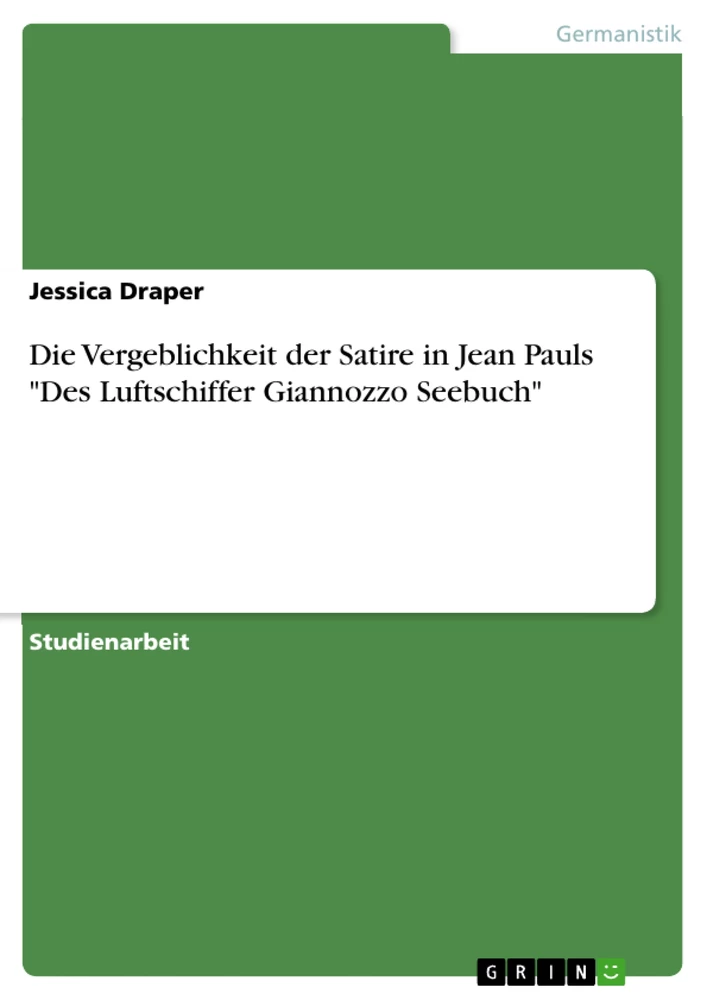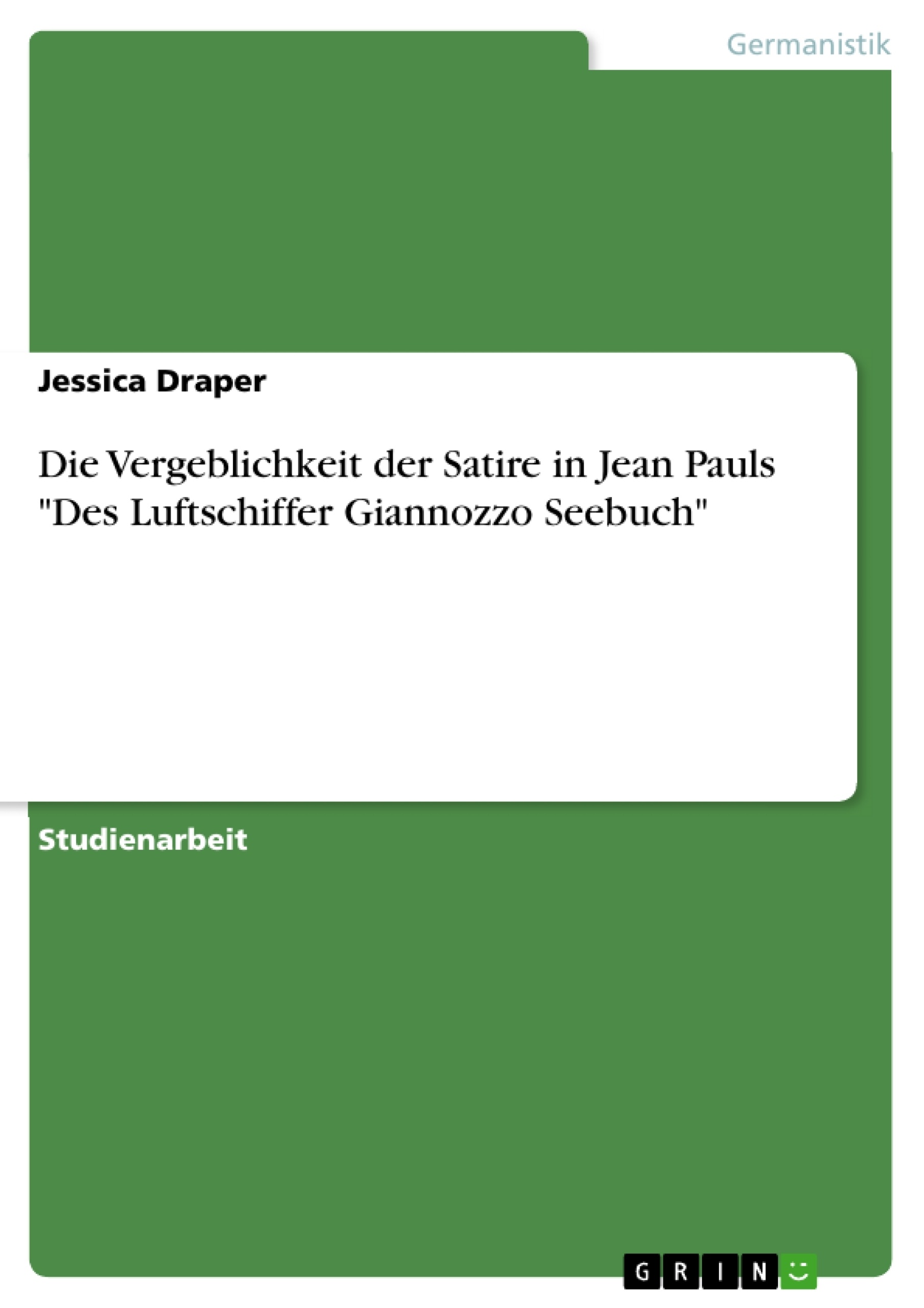Der Traum vom Fliegen mag so alt sein, wie die Menschheit selbst. Sich in die Lüfte zu erheben, die Freiheit zu empfinden, losgelöst zu sein vom Irdischen, wie ein Vogel die Welt aus einer erhabenen Perspektive zu überschauen, den Sternen näher und doch mit dem Unten, auf dem alles Leben existiert, verbunden zu sein. Unter anderem durch Blanchard rückte diese Vision in den Bereich des Möglichen. Er „hatte schon 1781 ein Flugschiff gebaut, das sich allerdings nicht vom Boden erheben konnte, und 1782 in Paris ausgestellt: nach seinem ersten Aufstieg am 2. März 1784 in Paris - mit einem Ballon, für dessen Gondel er die Schiffskonstruktion beibehielt“ bereiste er eine Anzahl deutscher Städte. Die Literatur reagierte auf „die Eroberung des Luftraumes“ nicht nur mit „feierlichen Gedichten“. „ Speziell der mehrfach angesagte, verschobene und schließlich ganz abgeblasene Aufstieg des Barons Lütgendorf - des ersten deutschen Luftschiffers - 1786 in Augsburg löste eine wahre Flut an ironisch-satirischen Kommentierungen aus.“ Es ist davon auszugehen, dass Jean Paul über den wachsenden Fortschritt der Luftschifffahrt unterrichtet war. So kritisierte „der von Jean Paul geschätzte ... Jonas Ludwig von Heß“ die Aeronauten, welchen es allgemein um des Wettbewerbs willen „nur auf die Höhe, nicht auf den Raum“ ankomme, ehrgeizig und um neue Rekorde heischend. Meiner Meinung nach möchte der Luftschiffer Giannozzo aus diesem Grunde sein Luftschiffsjournal unter dem Titel „Almanach für Matrosen, wie sie sein sollten“ herausgegeben wissen. In Jean Pauls Werk findet man tatsächlich keine technischen Angaben den Flug des Siechkobels betreffend, derartige Informationen scheinen wohlweißlich ausgelassen; der Matrose, wie er sein sollte, begnügt sich mit einer bildhaften Darstellung seiner Beobachtungen aus einer bisher fremden, erdentfernten Position. Auch der Name, den Giannozzo seinem Luftschiff verleiht, Siechkobel, soll, entgegengesetzt zu den prunkvoll Benannten jener Zeit, nicht die Freude ausdrücken, die ein Ballonreisender erfährt, wenn er sich über die Welt erhebt, sondern eher das Leid schildern, welches aus den erschütternden Beobachtungen der, im wahrsten Sinn des Wortes, menschlichen Abgründe erwächst. „Der Satiriker lässt sich auf die Beschwernisse dieser Welt ein und erhofft sich vom Leser ein Gleiches. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung zum Thema
- Vorrede
- Erste Fahrt
- Zweite Fahrt
- Dritte Fahrt
- Vierte Fahrt
- Fünfte Fahrt
- Sechste Fahrt
- Siebente Fahrt
- Achte Fahrt
- Neunte Fahrt
- Zehnte Fahrt
- Dreizehnte Fahrt
- Vierzehnte Fahrt
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Vergeblichkeit der Satire in Jean Pauls "Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch". Die Autorin analysiert, wie die satirischen Bemühungen des Protagonisten Giannozzo, die menschlichen Schwächen und Defizite anzuprangern, vergeblich bleiben. Sie untersucht, wie diese Vergeblichkeit in der Geschichte zum Ausdruck gebracht wird und welche Auswirkungen dies auf die Gesamtwirkung der Satire hat.
- Die Vergeblichkeit der Satire
- Der Einfluss des Protagonisten Giannozzo auf seine Zeit
- Die Kritik an Religion und Gesellschaft
- Die Rolle des komischen Anhangs in Jean Pauls Werk
- Die Beziehung zwischen Autor und Protagonist
Zusammenfassung der Kapitel
Vorrede
Die Vorrede verdeutlicht, dass Jean Paul mit seiner Satire zwei verschiedene Arten von Lesern anspricht: den „Leser von Verstand“, der die Kritik versteht, und den „andern“ Leser, der die Satire nicht als solche erkennt. Die Vorrede legt den Grundstein für die Analyse der Vergeblichkeit der Satire.
Erste Fahrt
Giannozzo, der sich selbst als „Schwarzkopf im grünen Mantel“ beschreibt, nutzt seinen Flug, um über die menschliche Welt und ihre Schwächen zu spotten. Religion, die Welt der Allermannsseelen und die menschliche Natur werden in diesem Kapitel satirisch beleuchtet. Die Reise im Luftschiff symbolisiert Giannozzos Distanz zur Erde, die jedoch nur oberflächlich ist, da er die Welt dennoch kritisch beobachtet und kommentiert.
Zweite Fahrt
Giannozzo begegnet in diesem Kapitel der „Ameisenkongresse der Menschen“, die er von oben aus betrachtet. Er befasst sich weiterhin mit der Kritik an Religion und Gesellschaft und stellt dabei die Vergeblichkeit seiner eigenen satirischen Bemühungen dar. Es wird deutlich, dass Giannozzo nur für sich selbst spöttelt und seine Kritik nicht ankommt.
Dritte Fahrt
Giannozzo erfährt eine neue Perspektive auf die menschliche Welt und ihre Probleme. Seine Kritik richtet sich gegen die menschliche Begrenztheit und die Unfähigkeit, sich von irdischen Belangen zu lösen. Die Vergeblichkeit der Satire wird in diesem Kapitel erneut deutlich.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie der Vergeblichkeit der Satire, der Rolle des komischen Anhangs in Jean Pauls Werk, der Kritik an Religion und Gesellschaft, dem Einfluss des Protagonisten Giannozzo auf seine Zeit und der Beziehung zwischen Autor und Protagonist.
- Quote paper
- Jessica Draper (Author), 2004, Die Vergeblichkeit der Satire in Jean Pauls "Des Luftschiffer Giannozzo Seebuch", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58928