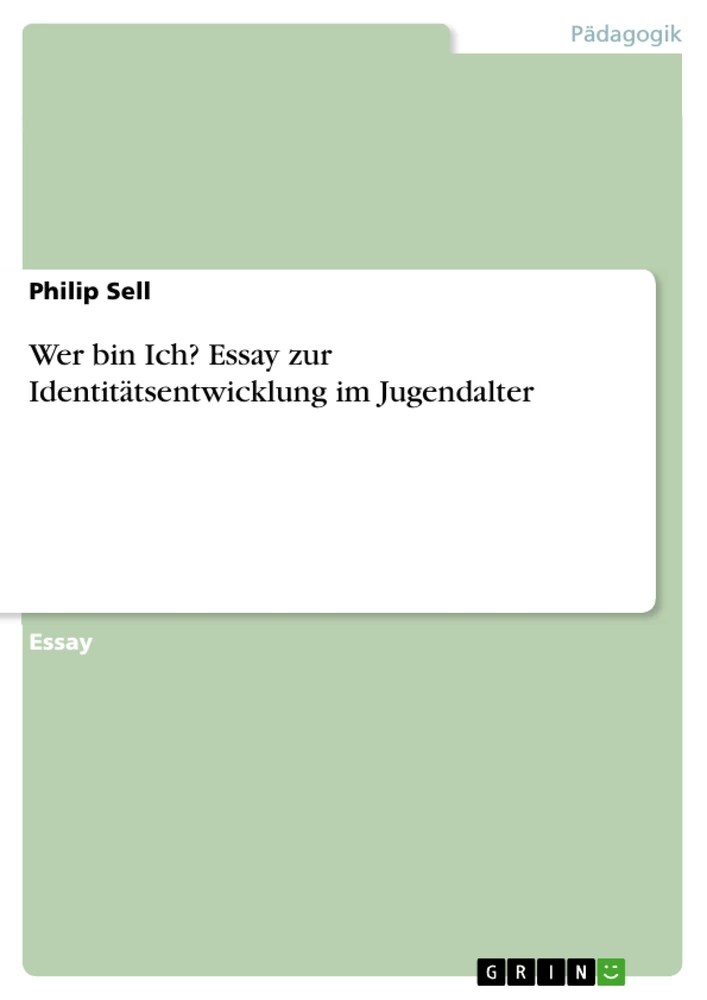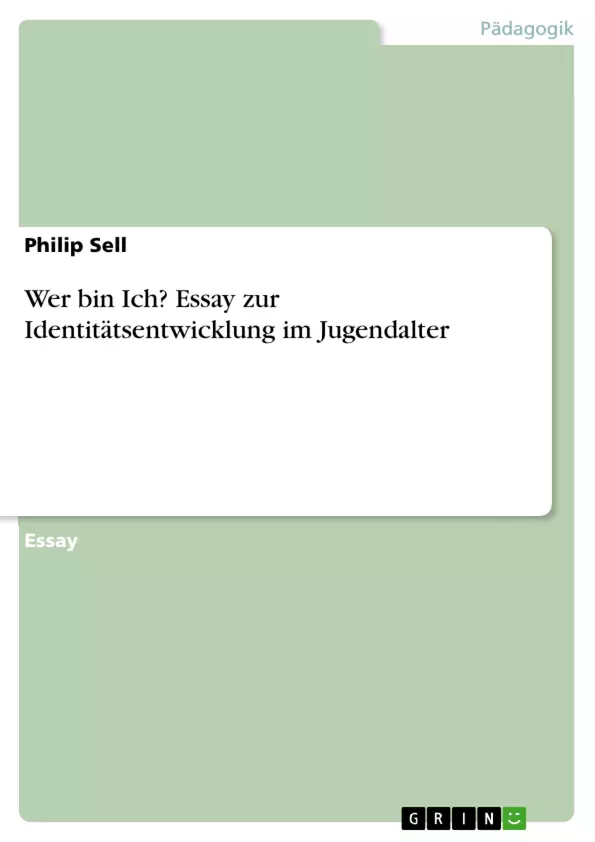Wer bin ich? Was will ich mit meinem Leben anfangen? Welche Werte sollen mein Leben bestimmen? Woran glaube ich? Auf diese und weitere Fragen versuchen die Heranwachsenden in ihrer Jugend möglichst viele Antworten zu finden, um eine individuelle Identität zu entwickeln. In der vorliegenden Abhandlung soll es im ersten Teil darum gehen, grundlegende Begriffe und Konzepte zu erläutern. Dabei wird neben den Begriffen Adoleszenz und Identität auch der Identitätsstatus nach Marcia thematisiert. Diese theoretischen Ausführungen bilden die Grundlage für den zweiten Teil des Essays. In diesem wird untersucht, inwiefern die Institution Schule zur Identitätssuche und Identitätsfindung beiträgt.
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 – Jugend und Identität: Einführung in die Begrifflichkeiten
- Teil 2 - Identitätsentwicklung in der Schule: Förderung oder Hemmung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abhandlung befasst sich mit der Frage, wie Jugendliche im Jugendalter eine individuelle Identität entwickeln. Dabei wird im ersten Teil auf grundlegende Begriffe und Konzepte eingegangen, die für die Identitätsentwicklung relevant sind, wie z.B. Adoleszenz, Identität und der Identitätsstatus nach Marcia. Der zweite Teil untersucht, inwiefern die Institution Schule zur Identitätssuche und Identitätsfindung beiträgt und welche Rolle Schule im Entwicklungs- und Selbstfindungsprozess eines Heranwachsenden spielt.
- Definition und Entwicklung der Adoleszenz
- Das Konzept der Identität und ihre Bedeutung im Jugendalter
- Der Identitätsstatus nach Marcia und seine vier Stadien
- Die Rolle der Schule bei der Identitätsentwicklung
- Schule als interaktiver Sozialraum und Ort kommunikativen Handelns
Zusammenfassung der Kapitel
Teil 1 – Jugend und Identität: Einführung in die Begrifflichkeiten
In diesem Teil werden die wichtigsten Begriffe und Konzepte im Zusammenhang mit Jugend und Identität erläutert. Es wird die Definition von Adoleszenz und Identität gegeben sowie die verschiedenen Phasen der Adoleszenz und der Identitätsstatus nach Marcia vorgestellt.
Teil 2 Identitätsentwicklung in der Schule: Förderung oder Hemmung
Dieser Teil betrachtet die Rolle der Institution Schule in der Identitätsentwicklung von Jugendlichen. Es wird untersucht, inwiefern Schule als interaktiver Sozialraum und Ort kommunikativen Handelns zur Identitätssuche und Identitätsfindung beitragen kann.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Abhandlung sind: Adoleszenz, Identität, Identitätsstatus, Schule, Sozialraum, kommunikatives Handeln, Identitätsentwicklung, Selbstfindung.
- Quote paper
- Philip Sell (Author), 2018, Wer bin Ich? Essay zur Identitätsentwicklung im Jugendalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/589350