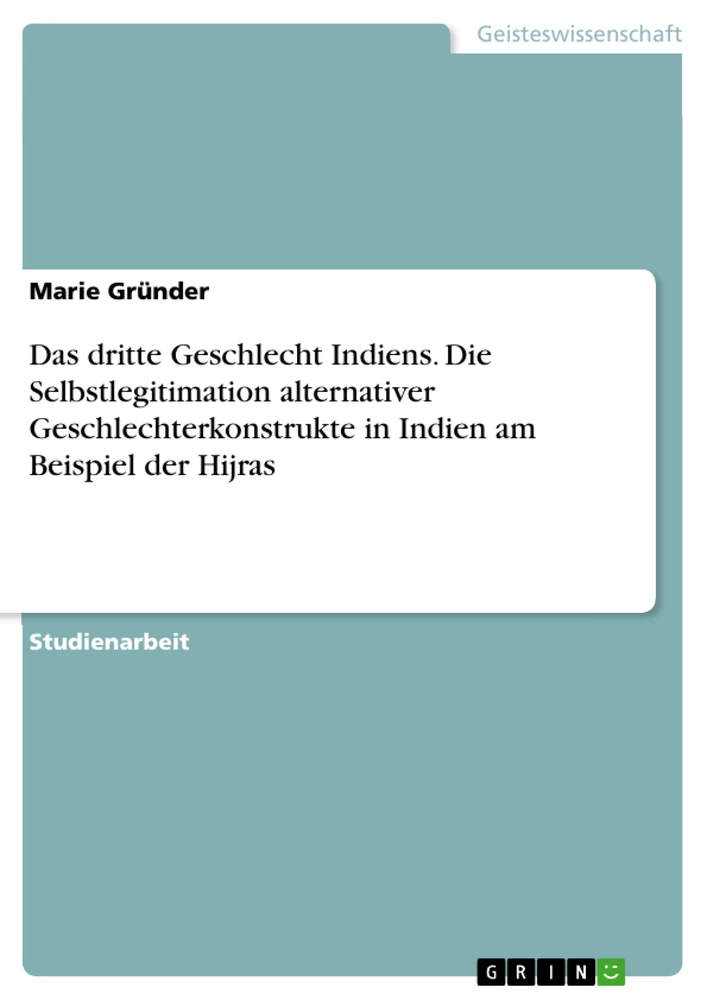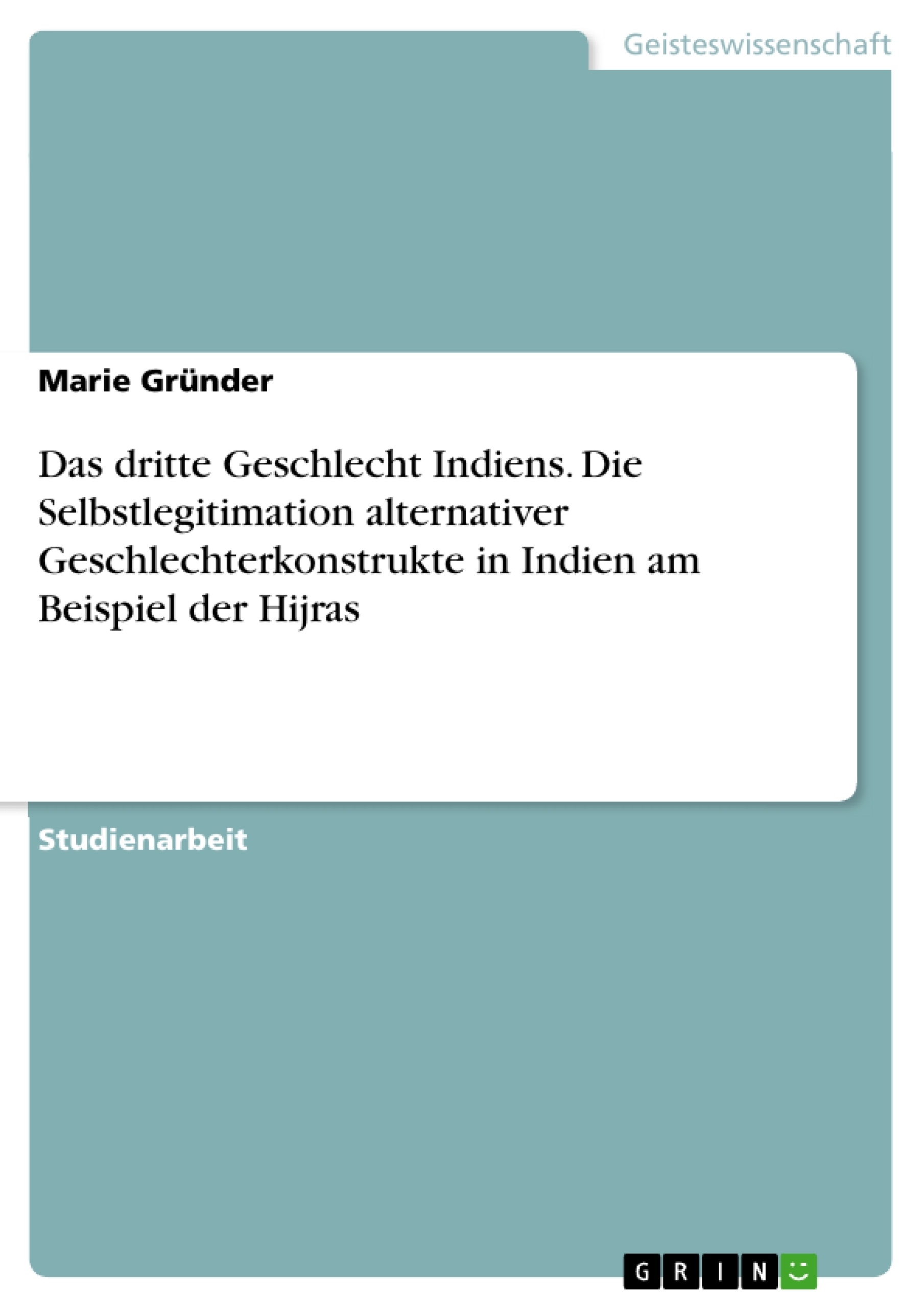Diese Arbeit untersucht die Selbstlegitimation und Identitätsbildung der Hijras, die in Indien als "drittes Geschlecht" anerkannt werden. Im Fokus stehen die Rolle von Ritualen, der Einfluss westlicher Werte sowie die Spannung zwischen traditioneller Religion und moderner Gesellschaft. Ziel ist es, die sozialen Strukturen und kulturellen Widersprüche der Hijras zu analysieren und die Neudefinition ihrer Rolle im Kontext sich wandelnder sozialer Dynamiken aufzuzeigen. Dabei wird die Arbeit sowohl auf ethnologische als auch auf moderne Gender- und Queer-Theorien Bezug nehmen, um den Diskurs über alternative Geschlechterkonstrukte zu erweitern.
Diese Arbeit richtet sich an Studierende und Fachleute der Ethnologie, Kulturwissenschaften, Gender- und Queer-Studies sowie an alle, die sich für gesellschaftliche Diversität und alternative Geschlechterkonstrukte interessieren. Sie bietet tiefgehende Einblicke in die sozialen, religiösen und kulturellen Dynamiken der Hijras und beleuchtet, wie traditionelle und moderne Einflüsse ihre Identität und gesellschaftliche Stellung prägen. Ein Muss für alle, die den Diskurs über Gender und gesellschaftliche Vielfalt besser verstehen möchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Der Diskurs von Sex und Gender
- 2. Das dritte Geschlecht Indiens
- 2.1 Eigen-/und Fremdbezeichnung……
- 2.2 Soziale Organisation und gesellschaftliche Akzeptanz
- 3. Religion, Ritual und Mythos.
- 3.1 Westlicher Einfluss in der Moderne
- 3.2 Widersprüche der Identitätsbildung
- 4. Fazit
- 5. Anhang
- 5.1 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Selbstlegitimation alternativer Geschlechterkonstrukte im gegenwärtigen Indien am Beispiel der Hijras. Sie analysiert, wie die Hijras ihre Identität aufbauen, durch Rituale festigen und moderne Widersprüche rechtfertigen.- Die Bedeutung des Diskurses von Sex und Gender für das Verständnis der Hijras
- Die soziale Organisation und gesellschaftliche Akzeptanz der Hijras in Indien
- Der Einfluss von Religion, Ritual und Mythos auf die Identitätsbildung der Hijras
- Der westliche Einfluss auf die indische Kultur und seine Auswirkungen auf die Hijras
- Die Widersprüche, denen die Hijras in der modernen Gesellschaft gegenüberstehen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt den Diskurs von Sex und Gender im Kontext der Hijras als „drittes Geschlecht“ in Indien vor und erläutert die Zielsetzung und den Aufbau der Hausarbeit.2. Das dritte Geschlecht Indiens
Dieses Kapitel beleuchtet die Eigen- und Fremdbezeichnung der Hijras sowie ihre soziale Organisation und gesellschaftliche Akzeptanz in Indien.3. Religion, Ritual und Mythos.
Das dritte Kapitel erörtert die Rolle von Religion, Ritual und Mythos in der Identitätsbildung der Hijras und untersucht den Einfluss des westlichen Einflusses in der Moderne auf ihre Lebensweise.Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Geschlechterkonstrukte, Hijras, drittes Geschlecht, Indien, Religion, Ritual, Mythos, westlicher Einfluss, soziale Organisation, gesellschaftliche Akzeptanz, Identitätsbildung, Widersprüche.- Quote paper
- Marie Gründer (Author), 2017, Das dritte Geschlecht Indiens. Die Selbstlegitimation alternativer Geschlechterkonstrukte in Indien am Beispiel der Hijras, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/589366