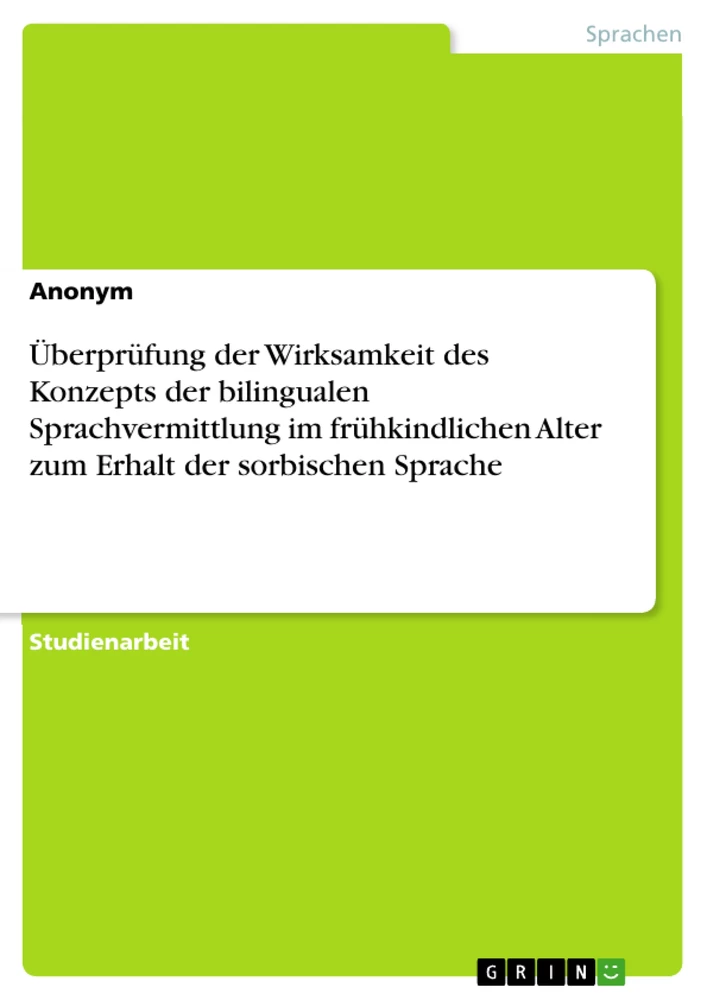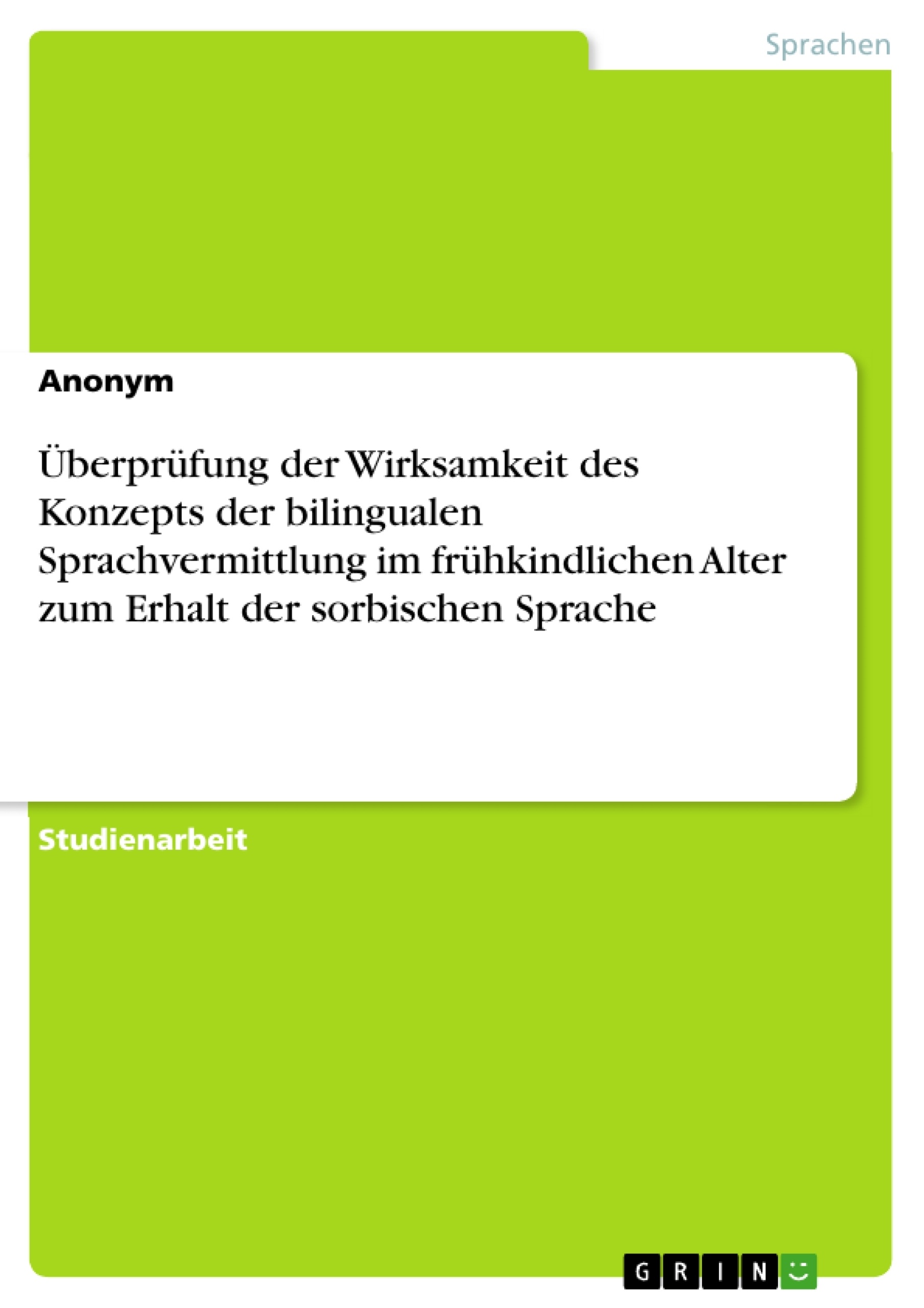Wer das Ortsschild von Bautzen passiert, kann dort folgendes lesen: „Wulke wokrjesne město Budyšin“. In der großen Kreisstadt wird man neben Deutsch auch in der Minderheitensprache Sorbisch willkommen geheißen. Ohne eigenes Autonomiegebiet ist das kleine westslawische Volk der Sorben in der Lausitz beheimatet. Bautzen ist eines seiner kulturellen Zentren. Die Beschriftung des Ortsschildes kann nach Schätzungen heute noch von 20000 Menschen, die des Sorbischen mächtig sind, problemlos verstanden werden. Laut einer Studie stirbt jede Sprache mit unter einer Million Sprecher allmählich aus, weshalb Sorbisch auf der Liste der bedrohten Sprachen steht.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern die bilinguale Sprachvermittlung durch Kindergärten zum Erhalt der sorbischen Sprache beitragen kann. Hierfür wird zunächst das Phänomen Sprachinsel dargestellt. Anschließend folgen Fakten über das sorbische Volk und seine Sprache. Des Weiteren wird sich genauer mit der Frage nach Mehrsprachigkeit im kindlichen Alter beschäftigt. Zuletzt wird das WITAJ-Projekt mit seinen Chancen und Problemen vorgestellt, bevor in einem Résumé auf die letztliche Wirksamkeit der bilingualen Erziehung in Kindergärten eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Sprachinsel
- 3. Die sorbische Sprache
- 4. Mehrsprachigkeit im kindlichen Alter
- 4.1. Einführung
- 4.2. Bilingualität als Konkurrenz der Sprachen
- 4.3. Die Immersionsmethode
- 4.4. Der Spracherwerb im Kleinkindalter
- 4.5 Zwischenfazit
- 5. Das WITAJ-Projekt
- 5.1. Daten und Fakten
- 5.2. Grundlagen des WITAJ-Projekts
- 5.3 Chancen des WITAJ-Projekts
- 5.4 Probleme des WITAJ-Projekts
- 6. Résumé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Wirksamkeit bilingualer Sprachvermittlung im frühkindlichen Alter zum Erhalt der sorbischen Sprache. Sie setzt sich mit dem Konzept der Sprachinsel auseinander, beleuchtet die Geschichte und den aktuellen Stand des Sorbischen und untersucht die Auswirkungen von Mehrsprachigkeit im Kindesalter. Der Fokus liegt auf dem WITAJ-Projekt, einem Programm zur bilingualen Förderung sorbischer Kinder in Kindergärten, wobei Chancen und Herausforderungen dieser Initiative beleuchtet werden.
- Das Konzept der Sprachinsel und die Gefahr des Sprachtodes
- Die sorbische Sprache als Sprachinsel-Sprache und ihre Geschichte
- Mehrsprachigkeit im kindlichen Alter und die Auswirkungen auf den Spracherwerb
- Das WITAJ-Projekt als Instrument zur bilingualen Förderung
- Die Wirksamkeit bilingualer Sprachvermittlung zum Erhalt des Sorbischen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit und die Forschungsfrage vor. Kapitel 2 beleuchtet das Konzept der Sprachinsel, einschließlich des Phänomens des Sprachtodes, der Rolle der Mehrsprachigkeit und des Code-Switchings. Kapitel 3 widmet sich der sorbischen Sprache als Sprachinsel-Sprache, einschließlich ihrer Geschichte und aktuellen Situation. Kapitel 4 befasst sich mit dem Thema der Mehrsprachigkeit im Kindesalter und geht dabei auf die Auswirkungen von Bilingualität und die Immersionsmethode ein. Kapitel 5 stellt das WITAJ-Projekt vor, einschließlich seiner Daten, Grundlagen, Chancen und Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Sprachinsel, Sprachtod, sorbische Sprache, Mehrsprachigkeit, Bilingualität, Spracherwerb, WITAJ-Projekt, Code-Switching, Immersionsmethode, Sprachverlust, Minderheitensprache, Sprachkontakt, ethnokulturelle Andersartigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt die sorbische Sprache als bedroht?
Mit nur etwa 20.000 Sprechern liegt Sorbisch weit unter der kritischen Marke von einer Million Sprechern, ab der eine Sprache statistisch als stabil gilt.
Was ist das WITAJ-Projekt?
WITAJ ist ein Projekt zur bilingualen Sprachförderung, bei dem Kinder in Kindergärten durch die Immersionsmethode spielerisch Sorbisch als zweite Muttersprache lernen.
Was versteht man unter der Immersionsmethode?
Immersion (Sprachbad) bedeutet, dass eine Sprache nicht wie ein Fach gelernt wird, sondern als Alltagssprache im Kindergarten oder in der Schule präsent ist.
Können Kinder durch Bilingualität überfordert werden?
Nein, die Forschung zeigt, dass Kinder im Kleinkindalter mühelos mehrere Sprachen gleichzeitig erwerben können, sofern sie regelmäßig damit in Kontakt kommen.
Was ist eine „Sprachinsel“?
Eine Sprachinsel ist ein kleines Sprachgebiet, das vollständig von einem größeren Gebiet mit einer anderen Sprache (hier Deutsch) umgeben ist.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Überprüfung der Wirksamkeit des Konzepts der bilingualen Sprachvermittlung im frühkindlichen Alter zum Erhalt der sorbischen Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/589420