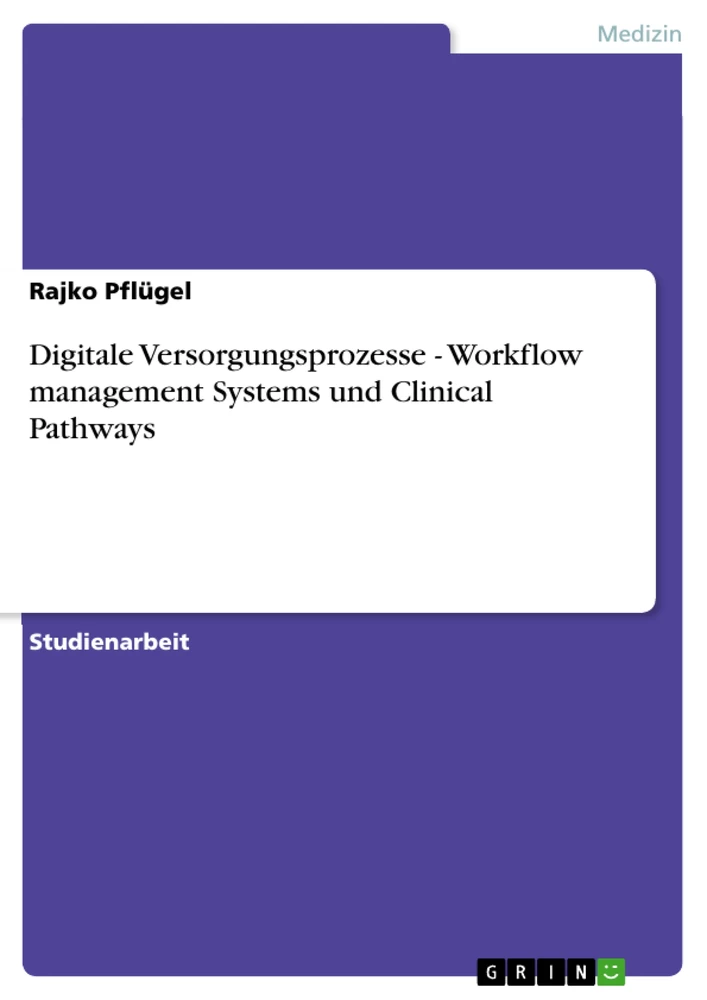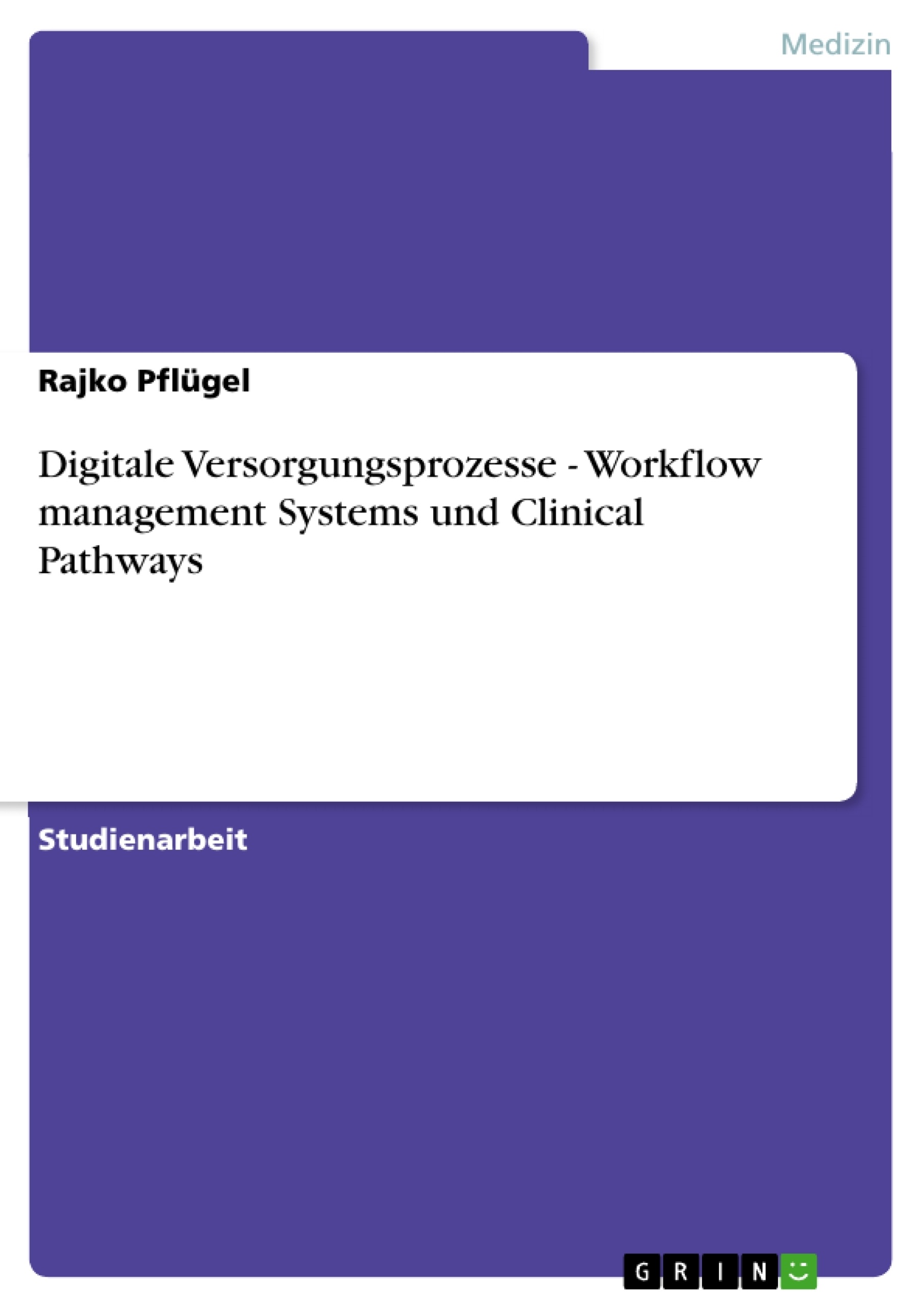„Das Gesundheitswesen ist zu teuer und nicht effizient genug. Seine Kosten belasten in der Krise zudem die Wirtschaft und zusätzlich den Staatshaushalt.“ Deutschland steht am Anfang seiner bedeutendsten und umfangreichsten sozialstaatlichen Reform. Die Geldströme, die die sozialen Sicherungssysteme speisen, versiegen. Die aktuelle Zahl von mehr als 5 Millionen Arbeitslosen ist nun, Realität. Unsere Bundesregierung versucht, mit der AGENDA 2010, für Deutschland Antworten auf diese Problemlagen zu finden. Harz IV und die aktuelle Gesundheitsreform (Gesetz zur Modernisierung der GKV) sind hier als die wichtigsten zu nennen. Das Gesundheitswesen unterliegt nun auch Veränderungsprozessen, denen sich andere Branchen (Industrie) schon längst anpassen „mussten“. Deren Leistungserbringer erkennen zunehmend die Notwendigkeit, sich den Mechanismen des wirtschaftenden Marktes zu nähern. Dieser Markt hat nach dem Statistischen Bundesamt (2002) einen Umsatz in Höhe von jährlich 235 Milliarden Euro. Allein 64 Milliarden Euro werden für die stationäre Versorgung in den Krankenhäusern ausgegeben. Das Gesundheitswesen stellt damit eine nicht zu unterschätzende wirtschaftliche Größe dar. Der demographische Wandel lässt das Marktpotenzial der Gesundheitsversorgung für die Zukunft erahnen. Man kann von einem realen Wirtschaftspotenzial sprechen. Das „Gesundheitswesen wird erneuert.“ Dies ist der Leitsatz der aktuellen Gesundheitsreform (1. Januar 2004). Die Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit in der medizinischen Versorgung, der Ausbau von Transparenz der Versorgungsprozesse, bessere Arbeitsbedingungen, Abbau von Bürokratie und letztendlich die Schaffung einer leistungs- und wettbewerbsfähigen Versorgungsstruktur sind deren wesentliche Inhalte. Die Bedeutsamkeit der Neugestaltung von Gesundheitsversorgung zeigt sich weiter in der Gründung der „Partner für Innovation“. Auf Drängen des Bundeskanzlers Gehard Schröder haben sich Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerkschaft und Politik gemeinsam einem Zukunftsthema genähert. Hierbei stehen Innovation und Technologie im Mittelpunkt. Im Rahmen der Gesundheitsversorgung wird die bessere Vernetzung der einzelnen Akteure durch die Informations- und Kommunikationstechnologie forciert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Vorgehensweise
- Digitale Versorgungsprozesse - Digitales Krankenhaus
- Workflow Management Systems (WfMS)
- WfMS in stationären Einrichtungen
- Der Nutzen von WfMS
- Probleme und Kritik an WfMS
- Clinical Pathways (CP)
- Anforderungen an CP
- Anwendung von CP am Beispiel des KH Klagenfurt
- Die Umsetzung von CP mithilfe von EDV und IuK
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Weiterentwicklung der integrierten Versorgung im Gesundheitswesen und untersucht den Einsatz von Workflow Management Systems (WfMS) und Clinical Pathways (CP) im digitalen Krankenhaus. Ziel ist es, die Bedeutung dieser digitalen Versorgungsprozesse für eine effiziente und qualitativ hochwertige Patientenversorgung zu beleuchten.
- Die Bedeutung von digitaler Versorgungsprozesse im Gesundheitswesen
- Die Funktionsweise von Workflow Management Systems (WfMS)
- Die Anwendung von Clinical Pathways (CP) in der Praxis
- Die Herausforderungen und Chancen der Integration von EDV und IuK in die Gesundheitsversorgung
- Die Rolle der Digitalisierung in der Verbesserung der Patientenversorgung und der Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Situation im deutschen Gesundheitswesen und die Notwendigkeit von Veränderungen, um die Kosten zu senken und die Qualität der Versorgung zu verbessern. Sie führt den Leser in die Thematik der digitalen Versorgungsprozesse ein und stellt die Bedeutung von Workflow Management Systems (WfMS) und Clinical Pathways (CP) im digitalen Krankenhaus dar.
Das zweite Kapitel befasst sich mit digitalen Versorgungsprozessen im digitalen Krankenhaus. Es behandelt die Funktionsweise von Workflow Management Systems (WfMS), deren Nutzen für die stationäre Versorgung sowie Probleme und Kritik an WfMS. Anschließend werden Clinical Pathways (CP) vorgestellt, ihre Anforderungen beleuchtet und ihre Anwendung anhand des Beispiels des KH Klagenfurt erläutert. Das Kapitel schließt mit der Erläuterung der Umsetzung von CP mithilfe von EDV und IuK.
Schlüsselwörter
Digitale Versorgungsprozesse, Workflow Management Systems, Clinical Pathways, digitales Krankenhaus, EDV, IuK, Integrierte Versorgung, Patientenversorgung, Gesundheitswesen, Wirtschaftlichkeit, Qualität.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Workflow Management Systems (WfMS) im Krankenhaus?
WfMS sind IT-Systeme, die klinische Arbeitsprozesse digital steuern und koordinieren, um die Effizienz und Transparenz in stationären Einrichtungen zu erhöhen.
Was versteht man unter "Clinical Pathways" (CP)?
Klinische Behandlungspfade sind standardisierte Behandlungsabläufe für spezifische Diagnosen, die eine hohe medizinische Qualität bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit sichern sollen.
Warum muss sich das Gesundheitswesen modernisieren?
Steigende Kosten, demographischer Wandel und sinkende Einnahmen in den Sozialkassen zwingen Leistungserbringer dazu, effizienter zu wirtschaften und Prozesse zu optimieren.
Welchen Nutzen bietet das "digitale Krankenhaus"?
Nutzen sind verbesserte Arbeitsbedingungen, weniger Bürokratie, höhere Patientensicherheit durch bessere Vernetzung und eine transparentere Versorgung.
Welches Praxisbeispiel für Clinical Pathways wird genannt?
Die Arbeit erläutert die Anwendung von Clinical Pathways am konkreten Beispiel des Krankenhauses Klagenfurt.
Was sind die Probleme bei der Einführung von WfMS?
Herausforderungen liegen in der Akzeptanz durch das Personal, hohen Investitionskosten und der Komplexität der Abbildung medizinischer Individualität in starren IT-Prozessen.
- Quote paper
- Rajko Pflügel (Author), 2005, Digitale Versorgungsprozesse - Workflow management Systems und Clinical Pathways, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58952