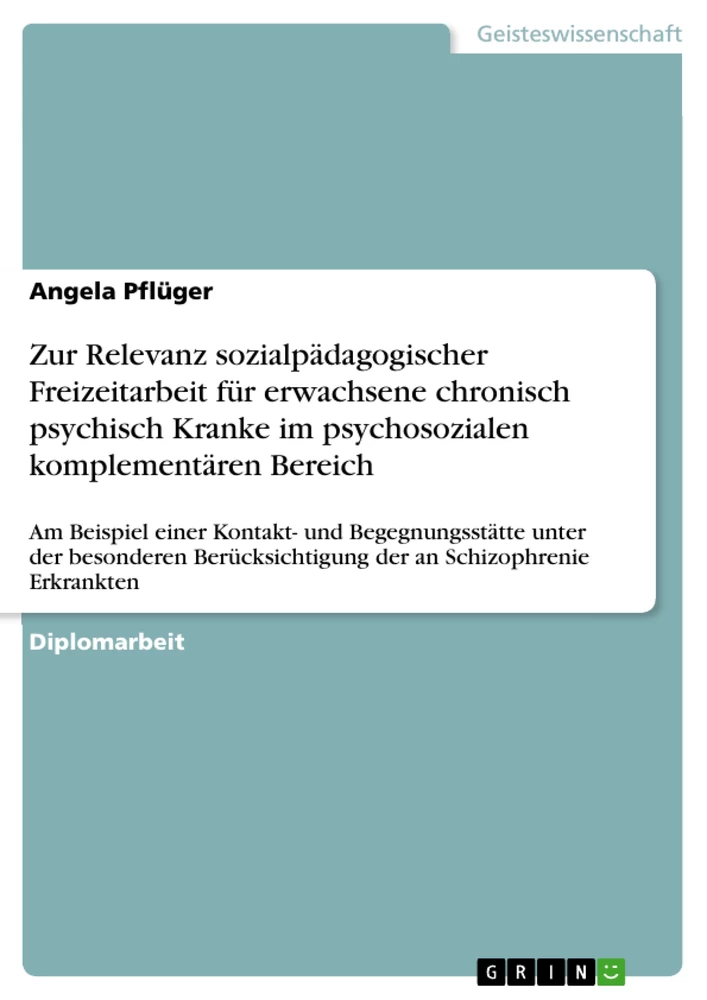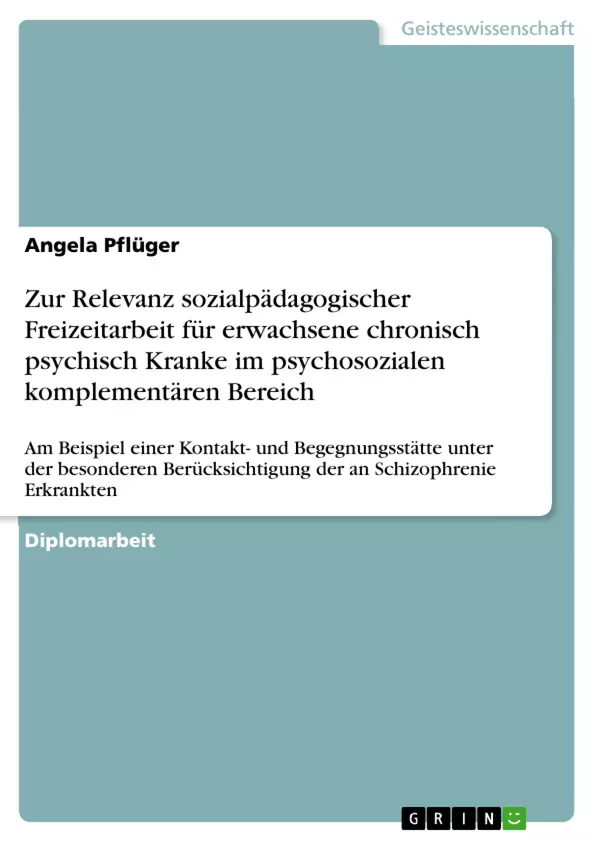Ziel der vorliegenden Diplomarbeit ist es, die Relevanz sozialpädagogischer Freizeitarbeit für chronisch psychisch Kranke aufzuzeigen. Den Anstoß für dieses Thema erhielt ich während meines halbjährigen Praktikums in der BRÜCKE in Stade, eine Kontakt- und Begegnungsstätte für psychisch kranke und behinderte Erwachsene. Durch das tägliche Zusammensein mit den überwiegend chronisch psychisch kranken Besuchern bekam ich erste Einblicke in ihre vielfältigen Probleme, die sich oftmals als Folgen ihrer Erkrankung einstellten: sei es die Auseinandersetzung mit der Erkrankung selbst, die soziale Ausgrenzung, die Schwierigkeiten bei den alltäglichen notwendigen Aufgaben oder im Umgang mit der Freizeit. Wie viele andere chronisch psychisch Kranke auch, haben die meisten Besucher der BRÜCKE viel freie Zeit, denn sie sind größtenteils erwerbsunfähig, arbeitslos oder leben im (Vor-) Ruhestand. „Das ist doch schön für sie,“ könnte ein Außenstehender sagen, „dann sind sie befreit von den Strapazen des Erwerbslebens. Die Freizeit wird ihnen gut tun. Denn Freizeit dient, wie man allgemein weiß, der psychischen und körperlichen Regeneration.“ Doch wer so denkt, macht es sich zu einfach. Erstens bedeutet freie Zeit nicht gleich Freizeit, zweitens dient Freizeit heute nicht mehr allein der Regeneration und drittens stellt Freizeit an den Menschen vielfältige Anforderungen. Wie in dieser Arbeit gezeigt werden wird, gilt Freizeit heute als Raum zur Selbstverwirklichung, des persönlichen Wachstums und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, je nach persönlichen Präferenzen und Interessen, Bedürfnissen und Möglichkeiten. Während meiner Tätigkeit in der BRÜCKE sah ich, dass viele der Besucher Probleme mit ihrer Freizeit hatten. Oft mangelte es an Eigeninitiative, Interessen oder Antrieb, um die Zeit aktiv zu gestalten. Ebenso war die Motivation oder das Interesse, sich an den institutionellen Freizeitangeboten zu beteiligen, bei vielen gering, während sie sich gleichzeitig über Langeweile und die Nutzlosigkeit der vielen freien Zeit beklagten. So fragte ich mich nach den Ursachen dieser Freizeitschwierigkeiten. Waren bzw. sind sie ein Ausdruck der chronischen Erkrankung? Oder haben psychisch Gesunde ähnliche Probleme? [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG.
- 2 DIE BEDEUTUNG VON FREIZEIT
- 2.1 Zur Entwicklung des Verhältnisses von Arbeit und Freizeit
- 2.2 Begriffsklärung und Funktion von Arbeit
- 2.3 Freizeit........
- 2.3.1 Negativ-Definitionen..
- 2.3.2 Positiv-Definitionen
- 2.3.3 Funktionen der Freizeit
- 2.3.4 Bedürfnisse....
- 2.3.5 Freizeitverhalten..
- 2.4 Probleme im Umgang mit der Freizeit.
- 2.4.1 Zeitmangel...
- 2.4.2 Zeitüberfluss durch Arbeitslosigkeit.
- 2.4.2.1 Freizeiterschwernisse auf Grund fehlender materieller Ressourcen.
- 2.4.2.2 Freizeiterschwernisse auf Grund defizitärer sozialer Netze.
- 2.4.2.3 Freizeiterschwernisse auf Grund somatischer Beeinträchtigungen ..
- 2.5 Freizeit als Chance.
- 2.6 Resümee
- 3 KLINISCHER TEIL
- 3.1 Der Krankheitsbegriff in der Psychiatrie
- 3.2 Psychiatrische Krankheitsbilder.
- 3.3 Chronisch psychisch Kranksein...
- 3.4 Psychopharmaka.
- 3.4.1 Neuroleptika..
- 3.4.2 Antidepressiva...
- 3.5 Schizophrenie...
- 3.5.1 Symptomatik und Verlauf der Schizophrenie
- 3.5.1.1 Die Prodromalphase
- 3.5.1.2 Die akute Phase.
- 3.5.1.3 Die Residualphase bzw. der chronische Verlauf.
- 3.5.2 Das Vulnerabilitäts-Stress-Bewältigungs-Modell.
- 3.5.2.1 Vulnerabilität.
- 3.5.2.2 Stress
- 3.5.2.3 Coping-Strategien.
- 3.5.3 Soziale Verlaufsfaktoren.
- 3.6 Resümee
- Die Bedeutung von Freizeit im Kontext von Arbeit und Lebensgestaltung
- Die Auswirkungen chronischer psychischer Erkrankungen auf die Freizeitgestaltung
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten sozialpädagogischer Freizeitarbeit für chronisch psychisch Kranke
- Die Bedeutung von Empowerment in der sozialpädagogischen Arbeit mit chronisch psychisch Kranken
- Das Beispiel der Kontakt- und Begegnungsstätte „Die BRÜCKE“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit erforscht die Bedeutung sozialpädagogischer Freizeitarbeit für chronisch psychisch Kranke. Das Ziel ist es, die Relevanz dieser Arbeit im psychosozialen Bereich aufzuzeigen, insbesondere am Beispiel einer Kontakt- und Begegnungsstätte für Menschen mit Schizophrenie. Die Arbeit beleuchtet die besonderen Herausforderungen, denen chronisch psychisch Kranke im Kontext ihrer Freizeitgestaltung gegenüberstehen, und untersucht, wie sozialpädagogische Freizeitarbeit zu ihrer Bewältigung beitragen kann.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen für die Arbeit fest und beleuchtet den Begriff der Freizeit im Kontext von Arbeit und Lebensgestaltung. Dabei werden Funktionen, Bedürfnisse und Probleme im Umgang mit der Freizeit analysiert, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Situation von Erwerbslosen gerichtet wird, deren soziale Lage mit der von chronisch psychisch Kranken vergleichbar ist. Kapitel 3 widmet sich dem Krankheitsbegriff in der Psychiatrie, insbesondere der Schizophrenie. Es werden die Symptomatik und Verlaufsformen der Krankheit sowie die Rolle von Psychopharmaka und sozialen Einflussfaktoren auf die Krankheitsentwicklung und den Umgang mit der Erkrankung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Sozialpädagogische Freizeitarbeit, chronisch psychisch Krank, Schizophrenie, Freizeitgestaltung, Psychosozialer Bereich, Kontakt- und Begegnungsstätte, Empowerment, BRÜCKE
Häufig gestellte Fragen
Warum haben chronisch psychisch Kranke oft Probleme mit ihrer Freizeit?
Oft mangelt es aufgrund der Erkrankung an Eigeninitiative, Antrieb oder Motivation. Zudem führt Erwerbsunfähigkeit zu einem Zeitüberfluss, der ohne Struktur als belastend empfunden wird.
Was ist der Unterschied zwischen "freier Zeit" und "Freizeit"?
Freie Zeit ist lediglich die Abwesenheit von Arbeit, während Freizeit als Raum zur Selbstverwirklichung, Regeneration und gesellschaftlichen Teilhabe definiert wird.
Welche Rolle spielt die Einrichtung „Die BRÜCKE“ in dieser Arbeit?
Sie dient als Praxisbeispiel für eine Kontakt- und Begegnungsstätte, in der sozialpädagogische Freizeitarbeit zur Unterstützung psychisch kranker Menschen geleistet wird.
Was bedeutet Empowerment im Kontext der Sozialpädagogik?
Empowerment zielt darauf ab, die Klienten zu befähigen, ihre eigenen Interessen zu vertreten und ihre Freizeit sowie ihr Leben wieder selbstbestimmt zu gestalten.
Wie beeinflusst Schizophrenie die Freizeitgestaltung?
Symptome wie sozialer Rückzug, Antriebslosigkeit oder die Nebenwirkungen von Psychopharmaka können die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und die Freizeitnutzung erschweren.
- Quote paper
- Diplom Sozialpaedagogin Angela Pflüger (Author), 2001, Zur Relevanz sozialpädagogischer Freizeitarbeit für erwachsene chronisch psychisch Kranke im psychosozialen komplementären Bereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59013