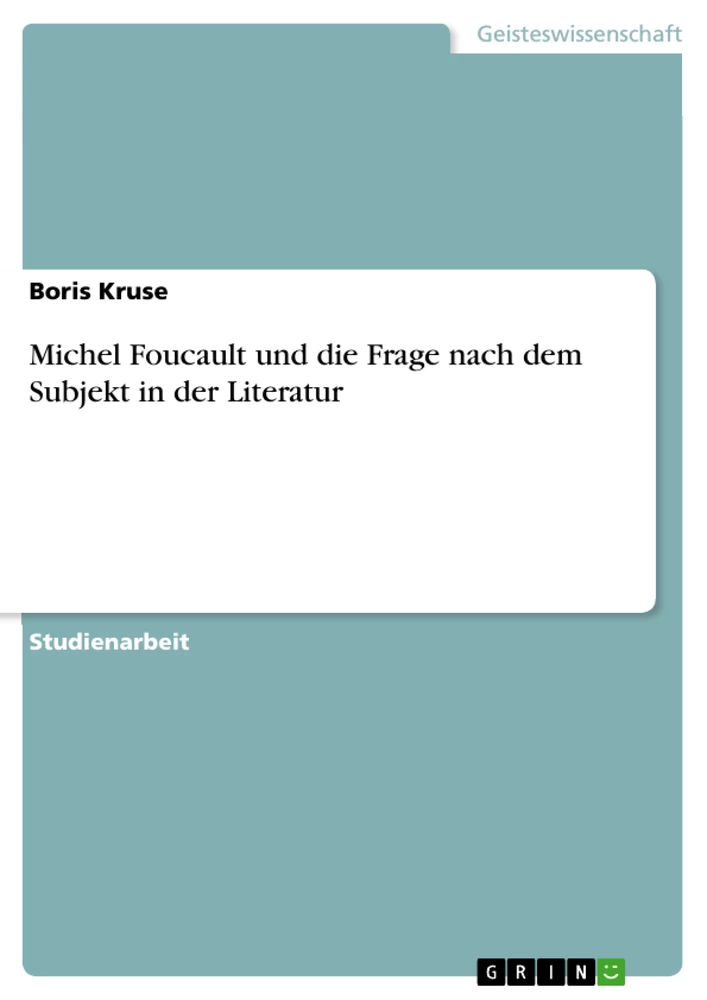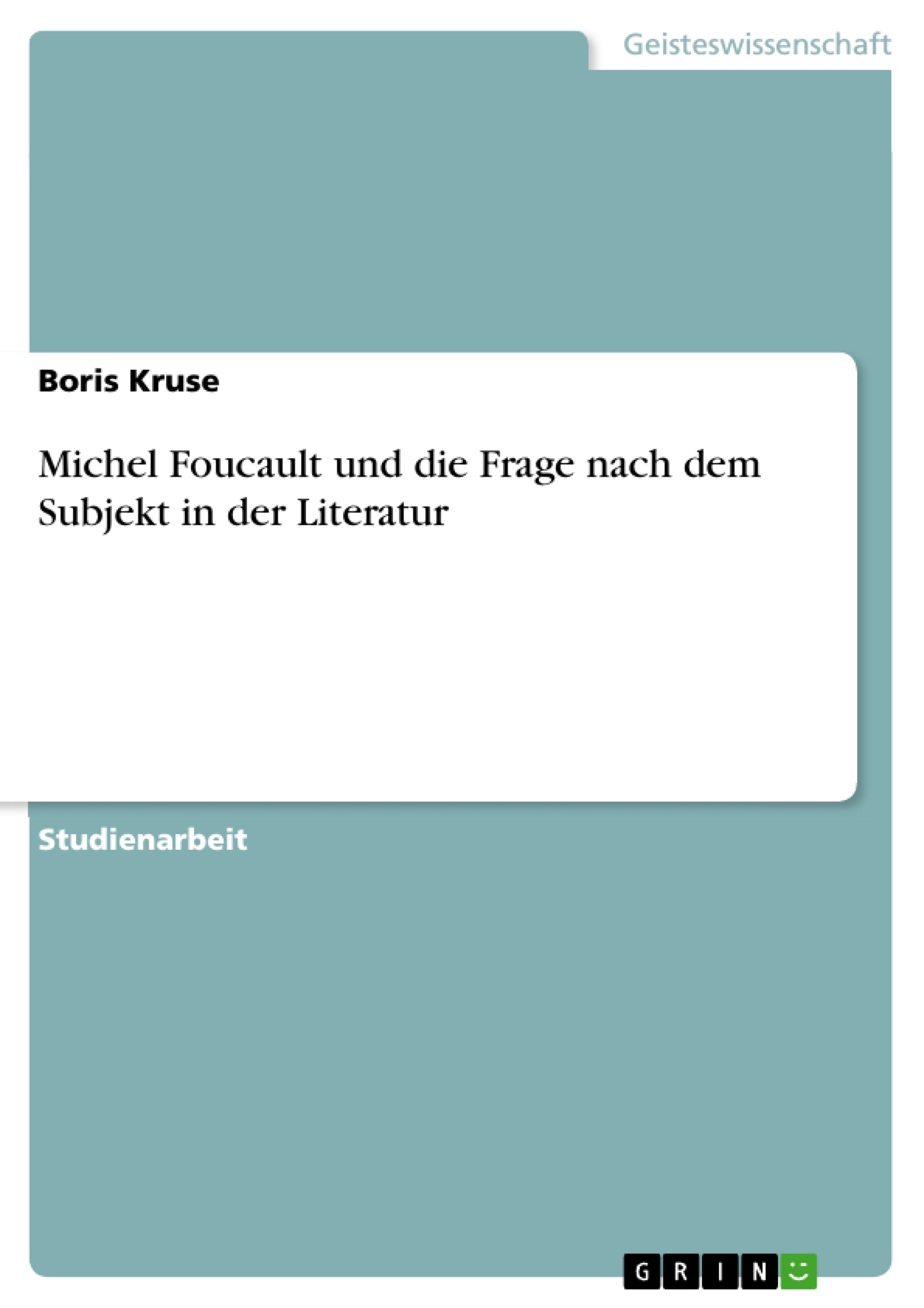Michel Foucaults Ausführungen zur Literaturwissenschaft sind widersprüchlich aufgefaßt worden. Sei es, daß ihm mangelhafte theoretische Ausarbeitung attestiert wurde, sei es, daß geäußert wurde, seine Ausführungen seien wenig spektakulär oder er widerspreche sich gar selbst- immer wieder ist scharfe Kritik zu vernehmen. Dennoch sind Foucaults diesbezügliche Schriften mit größtem Interesse und bis heute noch nicht abzuschätzenden Auswirkungen rezipiert worden. Foucaults diskursanalytischer Ansatz nimmt in der Theoriedebatte der Literaturwissenschaften nach wie vor einen breiten Raum ein. Daher erscheint die Fragestellung interessant, inwiefern seine theoretischen Entwürfe als konkrete Arbeitsgrundlage für die Beschäftigung mit der Literatur dienen können. Wer zum Kern der Ausführungen Foucaults vordringen will, sieht sich schnell mit einem strittigen Punkt konfrontiert: Welchen Stellenwert schreibt Foucault dem Subjekt in literarischen Diskursen zu? Diesem Problemkomplex soll auch hier nachgegangen werden, und zwar unter der besonderen Prämisse, zum einen das Subjekt als Erschaffer von Literatur, als Autor, zu fokussieren, um dann im zweiten Schritt zu einer Auslegung der Thesen Foucaults zur Person im literarischen Text zu gelangen, sprich zu narratologischen Implikationen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit kann es nicht sein, eine umfassende Darstellung des Subjektbegriffes nach Foucault zu erarbeiten. Vielmehr sollen zwei Äußerungen Foucaults, in denen die Problematik essayistisch zugespitzt formuliert wird, als Reverenz seines Standpunktes herbeigezogen werden: zum einen ist dies die Rede „Was ist ein Autor?“ (im folgenden bei Zitaten mit WA abgekürzt), die Foucault im Jahr 1969 gehalten hat, zum anderen der Essay „Die Fabel hinter der Fabel“ (FF) aus dem Jahr 1966. Auch sollen diese beiden Texte nicht en Detail referiert werden. Eine textnahe Betrachtung wird aber immer dann einsetzen, wenn eine besondere Relevanz für die Fragestellungen dieser Arbeit vorliegt. Um den Blickwinkel zu weiten, soll darüber hinaus noch Bezug auf andere Aussagen Foucaults zu Thema genommen werden. Noch eine Bemerkung zur Methode: diese Arbeit hat zwar Foucaults diskursanalytischen Ansatz zum Thema- das heißt aber nicht, daß hier auch mit dieser Methode gearbeitet werden soll. Es darf daher nicht verwundern, wenn, entgegen der nachdrücklichen Forderungen Michel Foucaults, immer wieder danach gefragt wird, was der Autor in seinen Texten zum Ausdruck bringen wolle.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Diskurs und Autorschaft
- Das Problemfeld der Autorschaft
- Zuordnungskriterien
- Autorschaft als Schutz vor dem Rauschen der Diskurse
- Strukturalistische Einwände
- Foucaults Analysen als literaturwissenschaftliches Programm
- Das diskursive Schattentheater
- Unklarheiten und Kritikpunkte
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle des Subjekts in literarischen Diskursen im Hinblick auf Michel Foucaults diskursanalytischen Ansatz. Sie konzentriert sich insbesondere auf die Frage nach der Autorschaft und der Person im literarischen Text, wobei die Reden „Was ist ein Autor?“ und der Essay „Die Fabel hinter der Fabel“ als zentrale Bezugspunkte dienen.
- Michel Foucaults Theorie der Autorschaft und ihre Relevanz für die Literaturwissenschaft
- Der Stellenwert des Subjekts in literarischen Diskursen bei Foucault
- Die Rolle des Autors als Erschaffer von Literatur
- Die Bedeutung des Subjekts in der literarischen Narration
- Die Beziehung zwischen Text und Autor in der poststrukturalistischen Diskursanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik des Subjektbegriffs in der Literaturwissenschaft vor, insbesondere im Kontext von Foucaults Diskursanalyse. Sie erläutert den Fokus der Arbeit auf Autorschaft und Person im literarischen Text und benennt die zentralen Texte Foucaults, die untersucht werden.
- Diskurs und Autorschaft: Dieses Kapitel analysiert Foucaults Kritik an der Vorstellung des Autors als „ingeniösen Schöpfersubjekts“ im Kontext des „Todes des Autors“. Es beleuchtet die Rolle des Schreibens als Zeichenspiel und seine Verbindung zum Tod, sowie die inkonsequenten Schlüsse, die aus der Debatte um den „Tod des Autors“ gezogen werden.
- Foucaults Analysen als literaturwissenschaftliches Programm: Dieses Kapitel untersucht die Anwendungsmöglichkeiten von Foucaults diskursanalytischem Ansatz in der Literaturwissenschaft. Es befasst sich mit der Frage, inwiefern Foucaults Theorien als konkrete Arbeitsgrundlage für die Analyse literarischer Texte dienen können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themenbereichen Diskursanalyse, Autorschaft, Subjekt, Literaturwissenschaft, Michel Foucault, „Was ist ein Autor?“, „Die Fabel hinter der Fabel“, Zeichenspiel, Tod des Autors, Schreibakt, Narration.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Michel Foucault unter dem „Tod des Autors“?
Es ist die Abkehr von der Vorstellung des Autors als alleinigem Schöpfer und Ursprung eines Textes, zugunsten einer Analyse der diskursiven Strukturen.
Was ist die „Autor-Funktion“ nach Foucault?
Der Autor wird nicht als Person, sondern als Funktion innerhalb eines Diskurses gesehen, die dazu dient, Texte zu klassifizieren und ihre Bedeutung einzugrenzen.
Welche Bedeutung hat das Subjekt in Foucaults Diskursanalyse?
Das Subjekt wird bei Foucault eher als eine Position innerhalb eines diskursiven Feldes betrachtet denn als ein autonomes, freies Individuum.
Was analysiert Foucault in „Was ist ein Autor?“?
Er untersucht, wie der Name eines Autors den Umgang mit Texten steuert und welche rechtlichen und institutionellen Bedingungen die Autorschaft prägen.
Wie lässt sich Foucaults Theorie literaturwissenschaftlich anwenden?
Sein Ansatz ermöglicht es, Texte nicht als biografische Zeugnisse, sondern als Teil größerer gesellschaftlicher Macht- und Wissenssysteme zu untersuchen.
- Quote paper
- Boris Kruse (Author), 2002, Michel Foucault und die Frage nach dem Subjekt in der Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59030