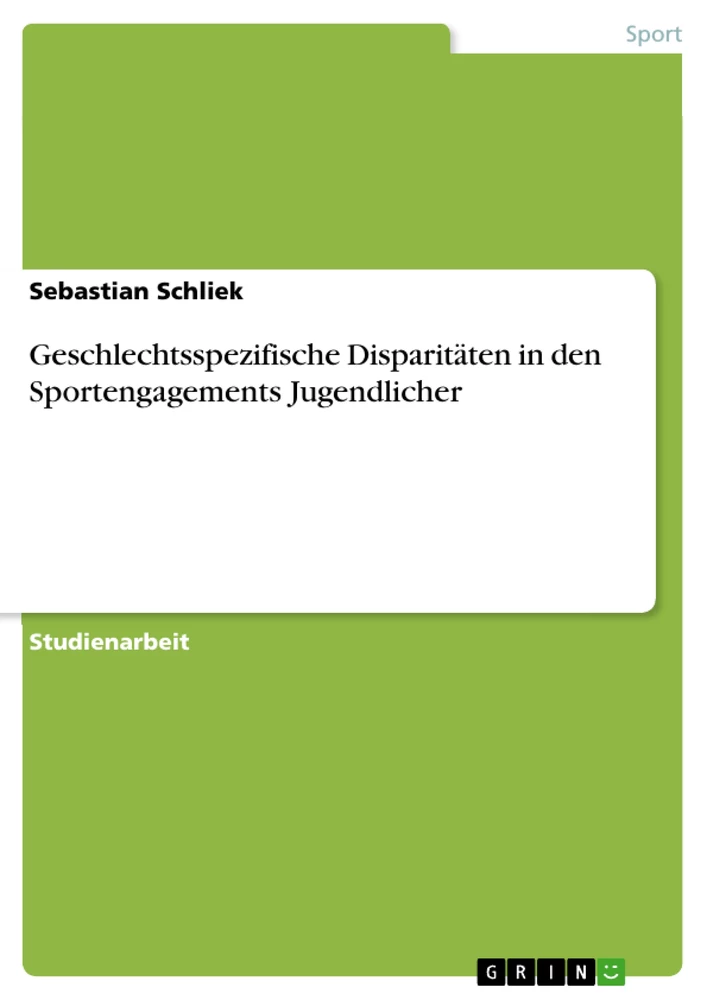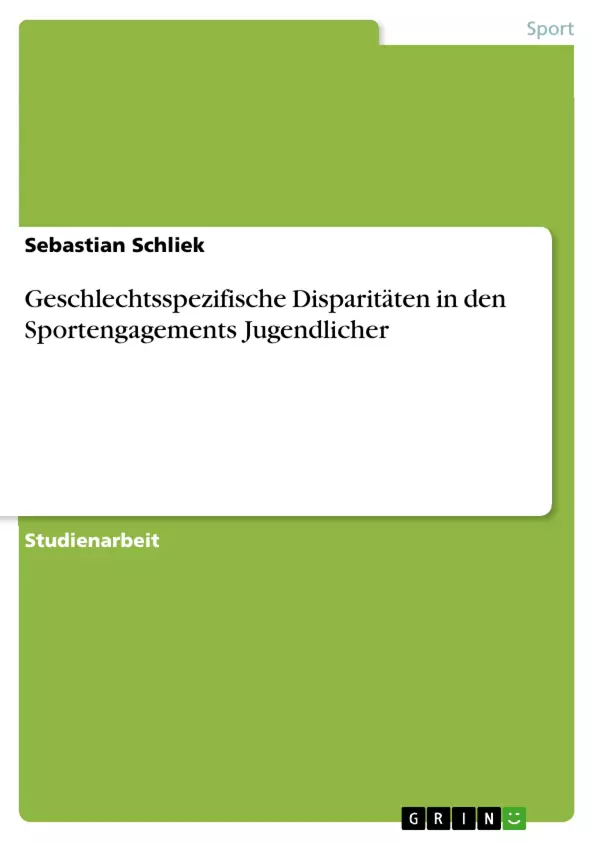"Frauensport ist ein sinnloser Aufstand gegen die eigene Anatomie!" Wenngleich dieses Zitat einer bekannten Comedyserie („Eine Schrecklich nette Familie“) entstammt, ist auch heute die dahinterstehende Gedankenwelt leider noch nicht aus allen Köpfen verschwunden. Dies ist ein eindeutiger Indiz dafür, dass sportliche Aktivität geschlechterdifferenziert betrachtet, angeregt und gewertet wird. Könnte daher ein geschlechtertypisches Sportengagement angenommen werden, dessen Unterschiede primär auf soziologische und nicht auf biologische Prozesse zurückzuführen ist? Um dieser These nachzugehen, sollen im Folgenden verschiedene Entwicklungskonzeptionen, geschlechtsspezifische Sozialisationsprozesse und deren Auswirkungen auf die Sportaktivität von Jungen und Mädchen erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Körper und Sozialisation
- Entwicklungskonzeptionen
- Biogenetische Entwicklungskonzeption
- Umweltdeterministische Konzeption
- Strukturgenetische Konzeption
- Interaktionistische Konzeption
- Hintergründe und Auswirkungen geschlechtsspezifischer Sozialisation
- Rollenerwartungen und Geschlechterstereotype
- Illustration differenter Sozialisationsprozesse
- Elterlicher Einfluss
- Außerfamiliäre Handlungsräume
- Schönheitsideale
- Leistungserwartungen
- Auswirkungen differenter Sozialisationseinflüsse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die geschlechtsspezifischen Disparitäten im Sportengagement von Jugendlichen. Sie beleuchtet die Entstehung dieser Unterschiede anhand von soziologischen und biologischen Faktoren sowie den Einfluss von Entwicklungskonzeptionen und Sozialisationsprozessen.
- Entwicklungskonzeptionen im Kontext von Sport und Sozialisation
- Einfluss der Umwelt auf die motorische Entwicklung
- Geschlechtsspezifische Sozialisationsprozesse und deren Auswirkungen auf das Sportengagement
- Rollenerwartungen und Geschlechterstereotype im Sport
- Die Bedeutung von familiären und außerfamiliären Handlungsräumen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die These auf, dass Unterschiede im Sportengagement von Jungen und Mädchen primär auf soziale Faktoren zurückzuführen sind. Kapitel 2 beleuchtet den Zusammenhang zwischen Körper und Sozialisation und diskutiert die Rolle der Umwelt in der motorischen Entwicklung. Kapitel 3 verdeutlicht den Wandel der soziologischen Betrachtungsweise durch die Vorstellung verschiedener Entwicklungskonzeptionen. In Kapitel 4 werden Hintergründe und Auswirkungen geschlechtsspezifischer Sozialisationsprozesse auf das Sportengagement analysiert. Hierbei werden Rollenerwartungen, Geschlechterstereotype und der Einfluss familiärer und außerfamiliärer Handlungsräume beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themenbereichen Sportengagement, geschlechtsspezifische Disparitäten, Sozialisation, Entwicklungskonzeptionen, Rollenerwartungen, Geschlechterstereotype, familiäre und außerfamiliäre Handlungsräume sowie die Auswirkungen von Sozialisationsprozessen auf das Sportengagement von Jugendlichen.
Häufig gestellte Fragen
Warum gibt es Unterschiede im Sportengagement von Jungen und Mädchen?
Unterschiede sind primär auf soziologische Prozesse und geschlechtsspezifische Sozialisation zurückzuführen, weniger auf rein biologische Faktoren.
Welchen Einfluss haben Eltern auf das Sportverhalten?
Eltern vermitteln oft unbewusst Rollenerwartungen und Geschlechterstereotype, die beeinflussen, welche Sportarten für Kinder als "angemessen" gelten.
Was sind Geschlechterstereotype im Sport?
Dazu gehören Vorstellungen wie "Fußball ist Männersache" oder die Betonung von Ästhetik und Grazie bei Mädchen gegenüber Kraft und Leistung bei Jungen.
Welche Rolle spielen Schönheitsideale?
Besonders bei Mädchen können gesellschaftliche Schönheitsideale die Wahl der Sportart beeinflussen oder sogar zu einer Abkehr vom leistungsorientierten Sport führen.
Was bedeutet "interaktionistische Konzeption" in der Entwicklung?
Sie besagt, dass Entwicklung ein wechselseitiger Prozess zwischen dem Individuum und seiner Umwelt ist, was auch die sportliche Identität prägt.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Schliek (Autor:in), 2005, Geschlechtsspezifische Disparitäten in den Sportengagements Jugendlicher, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59052