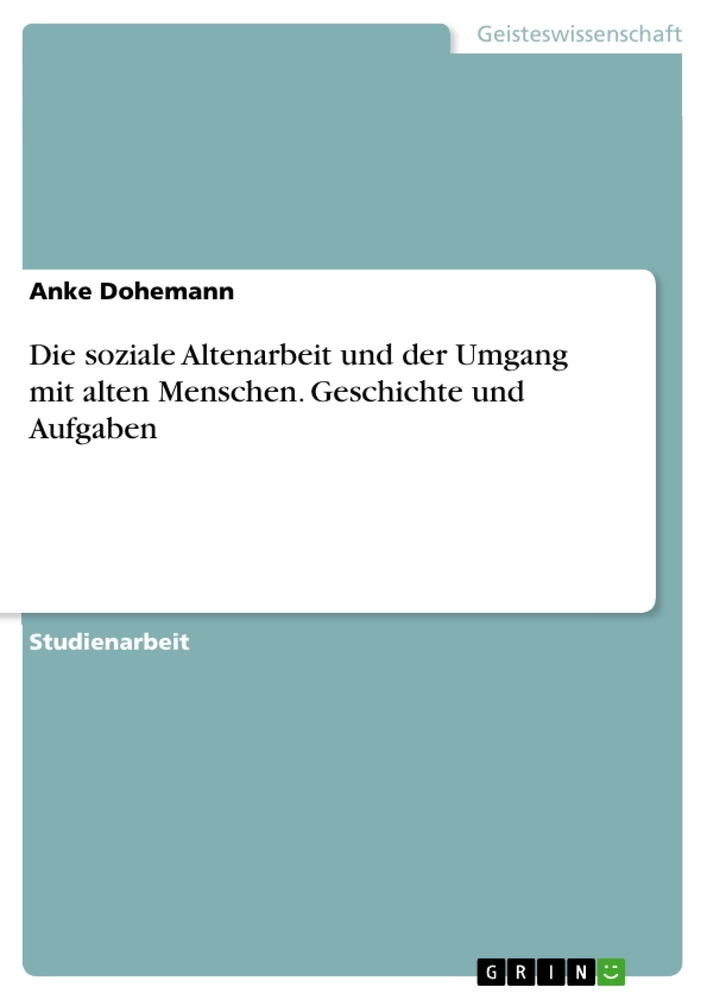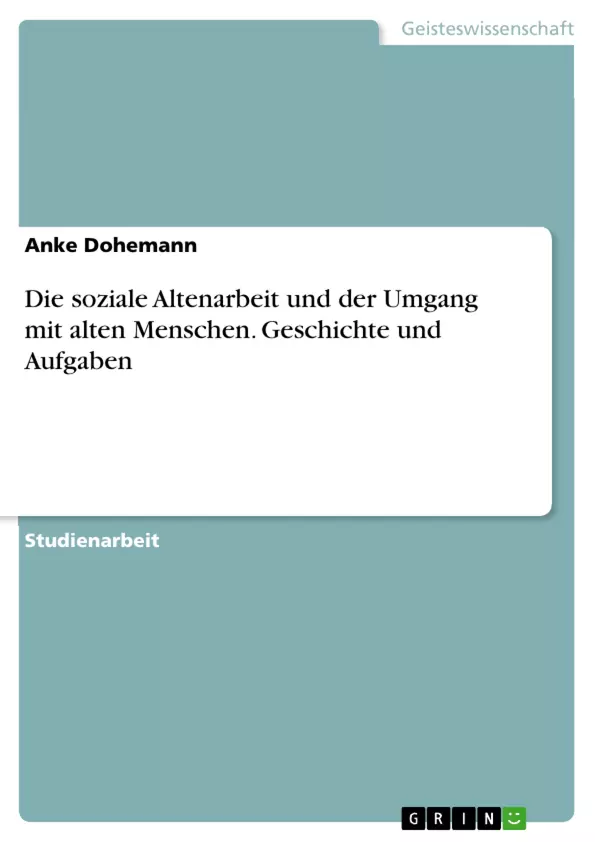Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Sozialen Arbeit und ihrer Disziplin „Soziale Altenarbeit“. Was genau die soziale Altenarbeit ist, wie sie sich in den Grundzügen entwickelte und weitere grundlegende Aspekte werden nachfolgend detailliert erläutert. Das ganze Leben hat man sich um die Arbeit, das Haus und die Familie gekümmert - doch wer kümmert sich im Alter um einen? Wer beschäftigt sich mit Menschen, die niemanden haben, deren Angehörige zu sehr beschäftigt sind oder mit den vorhandenen gesundheitlichen Bedingungen nicht zu Recht kommen? Wer steht mit Rat und Tat zur Seite? Genau dieses Alleinsein konnte im benachbarten Seniorenheim beobachtet werden. Abgesehen von den besuchslosen Wochenenden, steigt die Besucherrate auch an Ehrentagen wie Mutter- oder Vatertag, ebenso an Feiertagen wie Weihnachten nicht nennenswert an.
Hammerschmidt hat sein Buch "Gelingendes Alter(n) und Soziale Arbeit" mit einem passenden Spruch begonnen: "Wie müsste eine Gesellschaft beschaffen sein, damit ein Mensch auch im Alter ein Mensch bleibt? Die Antwort ist einfach: Es muss schon immer als Mensch behandelt worden sein." Auch wenn häufig ein Pflegedienst oder stationäres Personal die gesundheitlichen und pflegerischen Tätigkeiten übernimmt, bleiben die sozialen, zwischenmenschlichen und kommunikativen Aspekte allzu oft auf der Strecke. Zwischen getakteten Pflegeeinheiten lässt der Arbeitsalltag, nicht nur in der ambulanten, sondern auch in der stationären Pflege kaum persönliche, zeitlose Aktivität mit einzelnen oder mehreren alten Menschen zu. Diese Situation ist keineswegs ein anzustrebender Zustand im eigenen Alter.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Begriffsbestimmung
- Altenarbeit
- Alte Menschen und ihre Lebenssituation
- Gesundheit und gesundes Altern
- Beschreibung des Arbeitsfeldes „Soziale Altenarbeit“
- Geschichte
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Arbeitsfeld der Sozialen Altenarbeit und zielt darauf ab, die Bedeutung, Entwicklung und aktuelle Herausforderungen dieser Disziplin zu beleuchten. Dabei wird sowohl auf die historische Entwicklung als auch auf die aktuellen Herausforderungen der Altenarbeit eingegangen.
- Begriffsbestimmung der Altenarbeit und ihre Abgrenzung zu anderen Arbeitsfeldern
- Die Lebenssituation und Bedürfnisse alter Menschen im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen
- Die Bedeutung von Gesundheit und gesundem Altern im Alter
- Die Geschichte der Sozialen Altenarbeit und ihre Entwicklung
- Die Bedeutung von sozialen, zwischenmenschlichen und kommunikativen Aspekten in der Altenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Die Arbeit stellt die Relevanz des Arbeitsfeldes „Soziale Altenarbeit“ vor dem Hintergrund des demografischen Wandels dar. Das Problem des Alleinsein im Alter und die Bedeutung sozialer und kommunikativer Aspekte in der Pflege werden beleuchtet.
Begriffsbestimmung
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Altenarbeit und grenzt ihn von anderen Arbeitsfeldern ab. Es werden unterschiedliche Definitionen aus verschiedenen Quellen vorgestellt und die Lebenssituation alter Menschen im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen analysiert. Das Kapitel behandelt zudem das Thema Gesundheit und gesundes Altern und die Bedeutung von Prävention und Lebensqualität im Alter.
Beschreibung des Arbeitsfeldes „Soziale Altenarbeit“
Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Sozialen Altenarbeit und ihre Entwicklung im Kontext des demografischen Wandels. Es werden die Herausforderungen und Chancen der Altenarbeit in der Vergangenheit und Gegenwart diskutiert.
Schlüsselwörter
Soziale Altenarbeit, Altersbilder, demografischer Wandel, Gesundheit, gesundes Altern, Lebensqualität, soziale Isolation, Lebensbedürfnisse, Bedürfnisse älterer Menschen, Altenhilfe, Seniorenarbeit, gesellschaftliche Teilhabe, Pflegebedürftigkeit, Prävention, Lebensgestaltung.
- Quote paper
- Anke Dohemann (Author), 2019, Die soziale Altenarbeit und der Umgang mit alten Menschen. Geschichte und Aufgaben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/590572