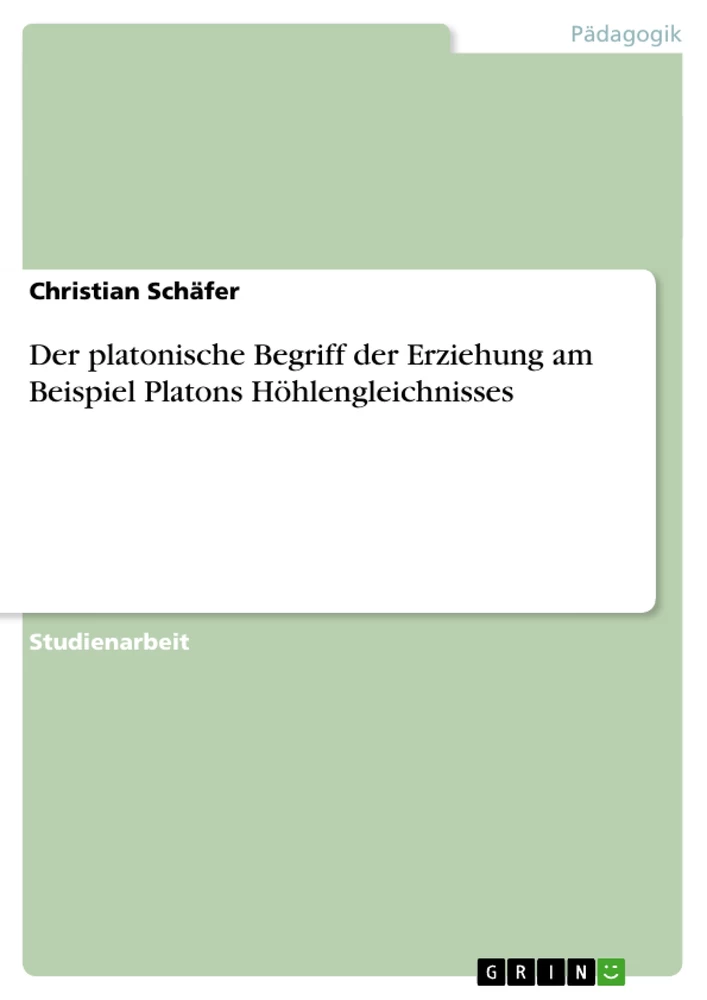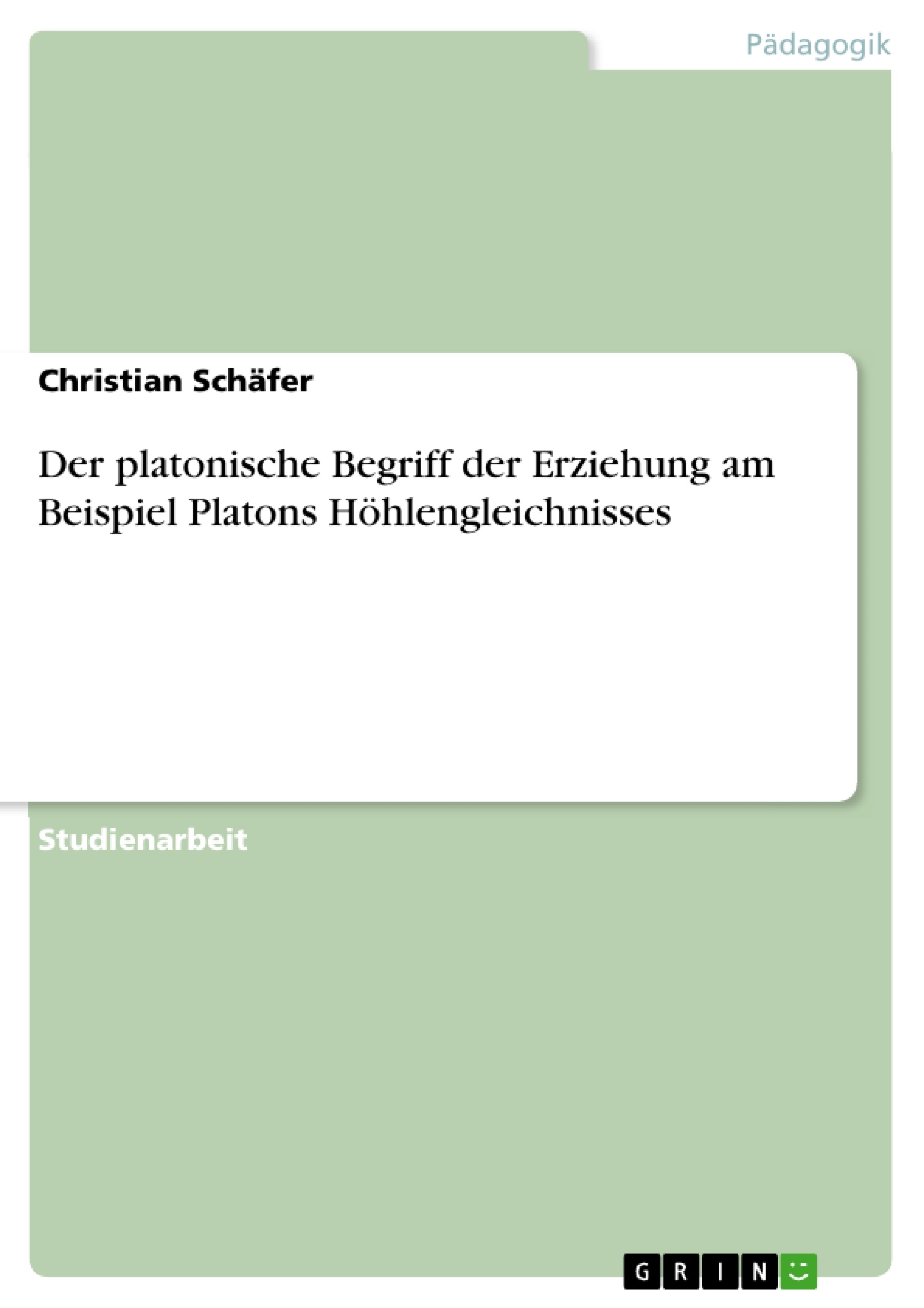Einleitung
Das Werk „Politeia“ wurde von Platon im Jahre 370 v. Chr. verfasst. Er entwirft darin einen Staat, der als idealtypisch gelten soll. Es stellt einen Neuanfang zur Verbesserung der politischen Institutionen und des Menschen dar, die Rettung vor dem Zerfall von Staat und Mensch. (vgl. Kersting 1999, S. 4) Diese Rettung kann nur durch die Lehre der Philosophie fruchten. Sie allein ist in der Lage zu erkennen was gerecht, gut und schön ist. Das Elend der Menschen kann nur durch Symbiose von politischer Macht und philosophischer Einsicht gelindert werden. Die Erziehung zum wahren Philosophen ist somit erste und wichtigste Aufgabe eines idealen Staates. Nur der wahre Philosoph vermag es die Menschen aus der politischen und moralischen Krise zu führen. Demzufolge müssen entweder die Philosophen zu Herrschern werden oder die Herrscher zu Philosophen (vgl. Kersting, 1999, S. 5). Das Bemühen um Gerechtigkeit, Charakter und Güte liegen als unerlässlich sämtlichen Bemühungen zu Grunde.
Im Verlauf der Hausarbeit wird auf die Thematik der Erziehungskonzeption in Platons Idealstaat eingegangen werden. Hierbei soll schwerpunktmäßig auf die Erziehung der zukünftigen Regenten seines Staates Bezug genommen werden. Grundlegende Frage in diesem Zusammenhang soll sein:
- Wie äußert sich der platonische Begriff der Erziehung in der Konzeption der Lehrvermittlung, der Auswahl der Edukanten, ihrem Ausbildungsweg und dem übergeordneten Erziehungsziel, dem Philosophenherrscher?
Die Hausarbeit soll auch explizit auf die Vorrausetzungen der Zulassung zur Platonischen Akademie eingehen. Um ein Gesamtbild der Erziehung der Herrscher von Kind auf zu erlangen, werden die Inhalte des siebten Buches der „Politeia“ beleuchtet. Ebenso soll herausgestellt werden welche Lehrfächer Platon als wichtig erachtet um einen wahren Philosophenherrscher zu formen. Das Höhlengleichnis dient als Anleitung zur Regentenausbildung und soll daher Grundlage der Argumentationen sein.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Höhlengleichnis
- Die Übertragung des Gleichnisses auf das Lernen
- Platons „Staat“
- Der Ausbildungsgang der Regenten - Die Lehrfächer
- Die Dialektik
- Der Regent
- Der Ausbildungsweg der Regenten in Platons „Staat“
- Die Erziehungsmacht
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem platonischen Begriff der Erziehung am Beispiel des Höhlengleichnisses aus Platons „Politeia“. Ziel ist es, die Erziehungskonzeption in Platons Idealstaat zu untersuchen, insbesondere die Erziehung der zukünftigen Regenten.
- Der platonische Begriff der Erziehung in der Lehrvermittlung
- Die Auswahl und Ausbildung der Edukanten
- Der Ausbildungsweg der Regenten
- Das übergeordnete Erziehungsziel - der Philosophenherrscher
- Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Platonischen Akademie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beschreibt die Bedeutung der Erziehung in Platons Idealstaat, der „Politeia“.
Das Höhlengleichnis: Dieses Kapitel erläutert das berühmte Höhlengleichnis aus Platons „Politeia“ und seine Bedeutung für die Platonische Philosophie. Das Gleichnis dient als Metapher für den Weg zur Erkenntnis und zur Erlangung von Herrschaft im Idealstaat.
Die Übertragung des Gleichnisses auf das Lernen: Dieses Kapitel beleuchtet, wie das Höhlengleichnis auf den Prozess des Lernens übertragen werden kann.
Platons „Staat“: Dieses Kapitel befasst sich mit Platons Idealstaat, dem „Politeia“, und der darin beschriebenen Erziehung der Regenten. Es werden die Lehrfächer, die Dialektik und der Ausbildungsweg der Regenten im Detail betrachtet.
Die Erziehungsmacht: Dieses Kapitel untersucht die Macht der Erziehung in Platons „Staat“ und ihre Bedeutung für die Ausbildung von Philosophenherrschern.
Schlüsselwörter
Platonische Philosophie, Politeia, Höhlengleichnis, Erziehung, Idealstaat, Philosophenherrscher, Dialektik, Regenten, Ausbildungsweg, Lehrfächer, Erziehungsmacht.
- Arbeit zitieren
- Christian Schäfer (Autor:in), 2002, Der platonische Begriff der Erziehung am Beispiel Platons Höhlengleichnisses, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5906