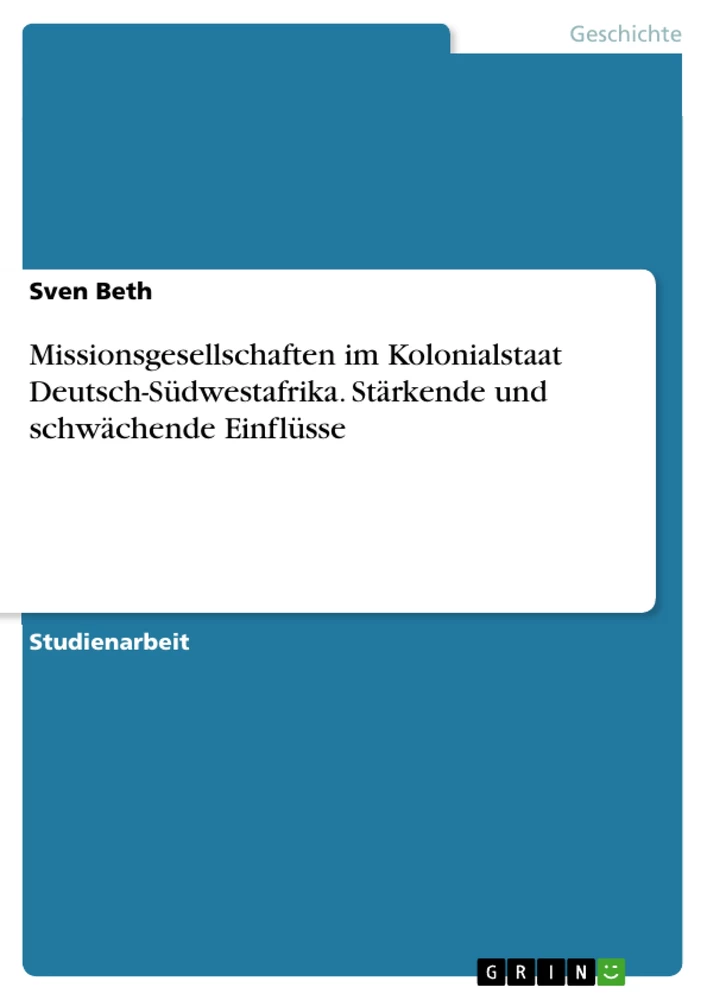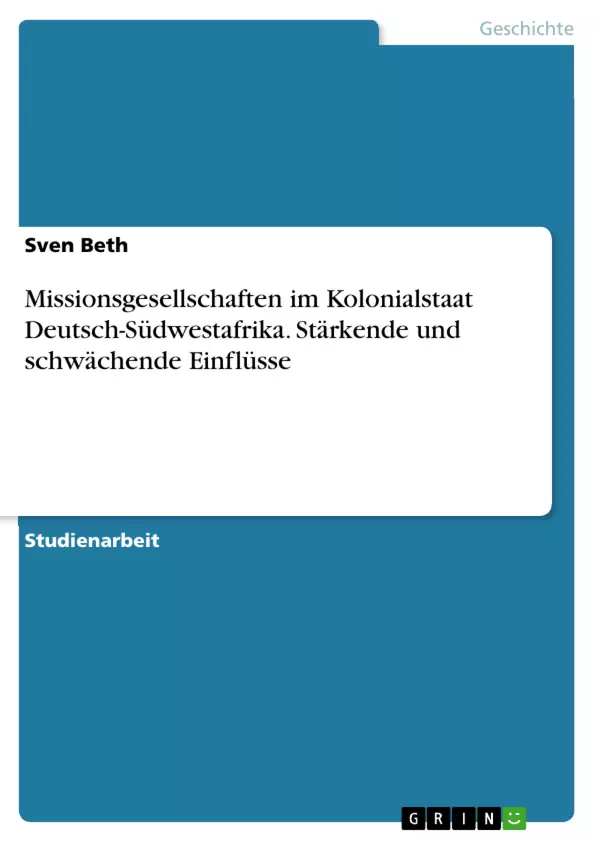Diese Arbeit behandelt das Thema der Missionsgesellschaften in Deutsch-Südwestafrika und versucht herauszufinden, welche positiven und negativen Einflüssen diese auf das Land hatten. Deutsch-Südwestafrika stellt ein zwar forschungsliterarisch weniger rezensiertes, dafür umso kontroverser zu diskutierendes Kapitel der deutschen Geschichte dar. Bedingt durch die Besonderheiten in der Geografie und den Umgang der Kolonialverwaltung mit der Kolonie nimmt dieses eine spezielle Position in der deutschen Geschichtsschreibung ein und erscheint schwer zu bewerten. Viele Gruppen aus Kolonialverwaltung, Siedlern, Unternehmer, indigenen Bevölkerungsgruppen, Militär und Missionen trafen aufeinander. Es wurden hochgradig fragwürdige Entscheidungen getroffen, die es schwierig machen, eine klare Aussage über den Erfolg oder Misserfolg der kolonialen Verwaltung zu treffen.
Die Missionsgemeinschaft stellt einen sehr frühzeitig agierenden und prinzipiell unabhängigen, de facto aber kooperativen Partner der Kolonialverwaltung dar. Während viele andere der beteiligten Gruppen wirtschaftliche oder politische Ziele verfolgten, war das deklarierte Engagement der Missionsgesellschaften auf die indigenen Bevölkerungsgruppen und deren Missionierung ausgerichtet. Interessant ist nun zu untersuchen, in welchem Ausmaß an diesem Ziel festgehalten wurde, sobald das Wohl dieser Menschen durch die Kolonialverwaltung gefährdet wird und welche Konsequenzen daraus entstehen. Gegenstand der Untersuchung sind die Jahresberichte der Rheinischen Missionsgesellschaft. Hierbei handelt es sich zwar um Eigendarstellungen, welche aus bestimmten Perspektiven und Weltanschauungen heraus verfasst wurden, allerdings sind die Quellen umfassend und in der Regel von Zeitzeugen verfasst, weshalb die Interpretation selbiger unter Berücksichtigung einiger Einschränkungen zielführend ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Missionsgesellschaften
- Stärkende Einflüsse
- Schwächende Einflüsse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, ob und inwiefern Missionsgesellschaften in Deutsch-Südwestafrika zur Stärkung oder Schwächung der deutschen Kolonialherrschaft beigetragen haben. Die Analyse fokussiert auf die Rheinische Missionsgesellschaft und deren Jahresberichte als Quellenmaterial.
- Die Rolle der Missionsgesellschaften in der Kolonialgeschichte Deutsch-Südwestafrikas
- Der Einfluss der Missionsgesellschaften auf die indigene Bevölkerung
- Die Beziehungen zwischen Missionsgesellschaften und Kolonialverwaltung
- Die ambivalenten Wirkungen der Missionsarbeit auf die Stabilität der Kolonie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Einleitung führt in das Forschungsfeld der deutschen Kolonialgeschichte in Deutsch-Südwestafrika ein. Sie beleuchtet die Ambivalenz der deutschen Kolonialverwaltung und die Herausforderungen bei der Bewertung des Erfolgs oder Misserfolgs der Kolonie. Die Arbeit fokussiert auf die Missionsgesellschaften als einen wichtigen Akteur, der die koloniale Herrschaft beeinflusst hat.
Die Missionsgesellschaften
Dieses Kapitel stellt die Rheinische Missionsgesellschaft als eine der ersten deutschen Missionen in Deutsch-Südwestafrika vor. Es beschreibt die Anfänge der Missionstätigkeit, die Entwicklung der Missionen und die Bedeutung ihrer Aktivitäten in der indigenen Bevölkerung.
Stärkende Einflüsse
Dieses Kapitel befasst sich mit den unterstützenden Einflüssen der Rheinischen Missionsgesellschaft auf die deutsche Kolonialherrschaft. Es beleuchtet die enge Kooperation zwischen Mission und Kolonialverwaltung, die Rolle der Missionare als lokale Experten und die Bedeutung ihrer Arbeit bei der Bevölkerungszählung und -kontrolle.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: Deutsch-Südwestafrika, Kolonialgeschichte, Missionsgesellschaften, Rheinische Missionsgesellschaft, indigene Bevölkerung, Kolonialverwaltung, Einfluss, Stärkung, Schwächung, Kooperation, Konflikte.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten die Missionen in Deutsch-Südwestafrika?
Missionsgesellschaften wie die Rheinische Missionsgesellschaft waren oft vor der Kolonialverwaltung im Land. Sie fungierten als Vermittler, betrieben Schulen und Krankenhäuser und unterstützten de facto die koloniale Struktur, auch wenn ihr Hauptziel die religiöse Bekehrung war.
Wie stärkten Missionen die Kolonialherrschaft?
Missionare dienten der Kolonialverwaltung oft als lokale Experten mit Sprachkenntnissen, halfen bei der Kontrolle der Bevölkerung und trugen durch die Vermittlung europäischer Werte zur Disziplinierung der Indigenen bei.
Gab es Konflikte zwischen Missionaren und der Kolonialverwaltung?
Ja, Konflikte entstanden besonders dann, wenn die brutale Behandlung der indigenen Bevölkerung durch die Verwaltung oder Siedler die Missionsarbeit gefährdete oder dem christlichen Ethos widersprach.
Was sind die Quellen für diese Untersuchung?
Die Arbeit stützt sich primär auf die Jahresberichte der Rheinischen Missionsgesellschaft, die detaillierte Zeitzeugenberichte aus der damaligen Zeit enthalten.
Wie wird der Erfolg der Missionen heute bewertet?
Die Bewertung ist ambivalent: Einerseits leisteten sie Bildungsarbeit, andererseits waren sie Teil eines Systems, das die indigene Kultur unterdrückte und die koloniale Landnahme legitimierte.
- Quote paper
- Sven Beth (Author), 2019, Missionsgesellschaften im Kolonialstaat Deutsch-Südwestafrika. Stärkende und schwächende Einflüsse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/591922