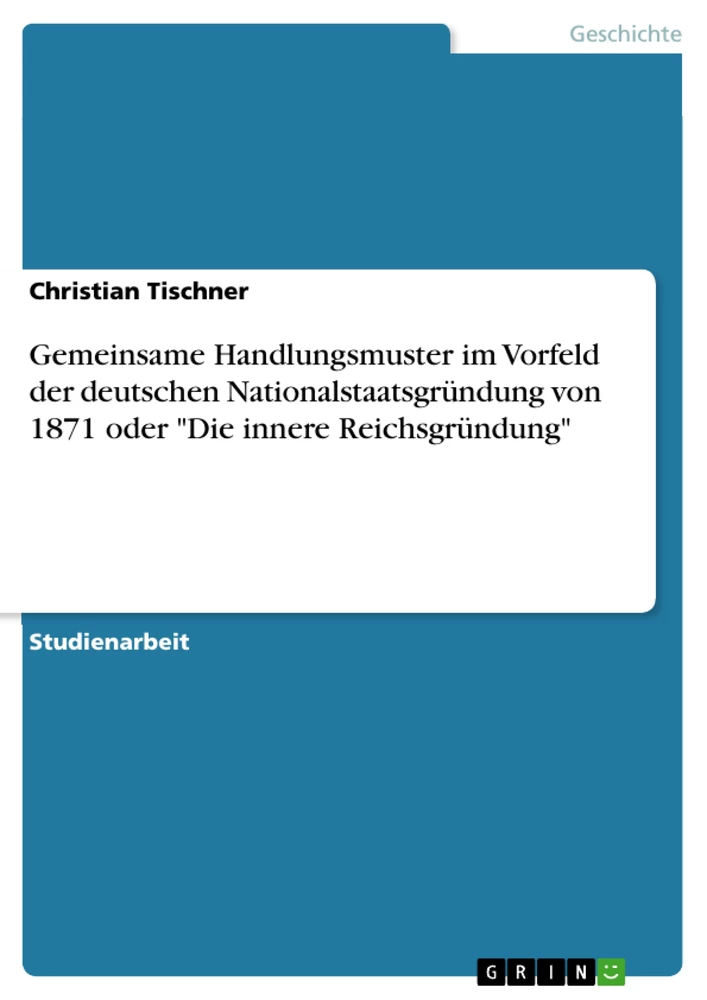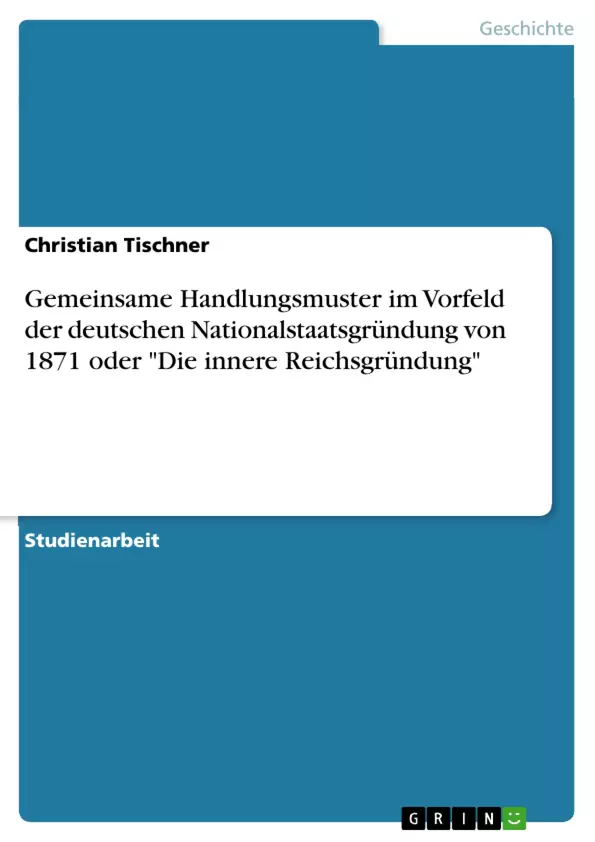In der vorliegenden Arbeit soll sich mit den Voraussetzungen der deutschen Nationalstaatsgründung von 1871 auseinandergesetzt werden. Es ist unbestritten, dass der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck die Reichsgründung im Zuge einer ‘Revolution von oben’ vollzog. Hieraus ergibt sich aber die untersuchungsleitende Frage, was das Fundament bzw. die Voraussetzungen dafür waren, dass so viele Menschen damals bereit waren, die in Kriegen geschaffenen Tatsachen zu akzeptieren und so den Nationalstaat ermöglichten?
Daraus folgt die These, dass die ’Revolution von oben’ von einem vielschichtigen Prozess der Nationsbildung bekleidet wurde, in der gleiche Handlungsmuster auf verschiedenen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Ebenen entstanden, welche die Akzeptanz der preußisch kleindeutschen Reichsgründung erhöhten. Allerdings kann es nicht Anspruch dieser Arbeit sein, ein vollständiges Bild über das innerdeutsche wirtschaftliche, soziale, kulturelle und politische Beziehungsgeflecht zu geben. Vielmehr sollen besonders markante und bedeutende Phänomene vorgestellt und nach ihrer Bedeutung am Einigungsprozesses hinterfragt werden. Die Ausgangsbasis dieser Arbeit sollen kurze einleitende Betrachtungen bezüglich der Reichseinigungskriege und dem Nationenbegriff bilden. Davon ausgehend wird als erstes auf die wirtschaftlichen Verklammerungen eingegangen. Diesbezüglich gilt es herauszuarbeiten, in wieweit die wirtschaftliche Integration den Nationalbildungsprozess begünstigte und möglicherweise die staatliche Einheit förderte.
Den zweiten Schwerpunkt der Arbeit sollen das soziokulturelle Fundament der Reichsgründung bilden. Es wird danach zu fragen sein, welche Entwicklungen die Vertiefung der sozialen und kulturellen Beziehungen begünstigten und so eine Entlokalisierung von Lebenswelten und Lebenserfahrungen bewirkten. Dabei kommt, so eine weitere These, dem überregionalen Vereinswesen und der sich verdichtenden Kommunikation über die Grenzen hinweg besondere Bedeutung zu.
Im letzten Teil der Arbeit wird sich mit dem politischen Verklammerungen, die vor 1871 bestanden, auseinander gesetzt werden. Dabei soll die politische Nationalbewegung eine zentrale Rolle einnehmen, war sie es doch, welche die Idee der Nation von einem kleinen Kreis Gebildeter zu einer breiten Massenbewegung werden ließ, die darin neue herrschaftliche und gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen erkannte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1866/1871 weit mehr als eine ‘Revolution von oben'
- Die wirtschaftlichen Verklammerungen als Fundament der Reichsgründung von 1871
- Die Bedeutung des deutschen Zollvereins
- Die Bedeutung der Fortschritte im Verkehrs- und Nachrichtenwesen
- Die soziokulturellen Verklammerungen als Fundament der Reichsgründung von 1871
- Die Zunahme der sozialen Mobilität und deren Folgen
- Die Bedeutung der Vereins-, Verbands- und Parteienbildung
- Die Bedeutung von Religion und Wissenschaft
- Die politischen Verklammerungen als Fundament der Reichsgründung von 1871
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Voraussetzungen der deutschen Nationalstaatsgründung von 1871. Sie stellt die These auf, dass die scheinbare „Revolution von oben“ durch Bismarck durch einen vielschichtigen Prozess der Nationsbildung begünstigt wurde, der sich auf verschiedenen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Ebenen vollzog. Die Arbeit analysiert die Rolle der wirtschaftlichen Integration, der soziokulturellen Vernetzung und der politischen Verklammerungen in diesem Prozess.
- Die wirtschaftliche Integration Deutschlands, insbesondere der Zollverein, als Motor für die Nationalstaatsgründung.
- Die Bedeutung des soziokulturellen Wandels, insbesondere der sozialen Mobilität, der Vereinsbildung und der Kommunikation über Grenzen hinweg für den Einigungsprozess.
- Die Rolle der politischen Nationalbewegung in der Entstehung der Idee von einer deutschen Nation.
- Die Analyse der deutschen Nationalstaatsgründung im Kontext der „Revolution von oben“ und der Entstehung von Nation als eine „Zumutung von spezifischer Solidarität“ (Max Weber).
- Die Bedeutung von gemeinsamen Handlungsmustern und Kulturgütern für die Bildung eines Nationalbewusstseins.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt den Fokus auf die Frage nach den Voraussetzungen der deutschen Nationalstaatsgründung und die These, dass die „Revolution von oben“ durch einen komplexen Prozess der Nationsbildung begleitet wurde. Kapitel 2 analysiert die Reichseinigungskriege von 1866 und 1871 und stellt die Bedeutung der preußischen Hegemonie in diesem Kontext heraus. Kapitel 3 befasst sich mit der wirtschaftlichen Integration Deutschlands, wobei der deutsche Zollverein als ein entscheidender Faktor für die Entstehung eines gemeinsamen Wirtschaftsraums und damit für die Nationalstaatsgründung dargestellt wird.
Kapitel 4 untersucht die soziokulturellen Veränderungen im 19. Jahrhundert, die den Prozess der Nationsbildung förderten. Dazu gehören die zunehmende soziale Mobilität, die Bildung von Vereinen und Verbänden sowie der Einfluss von Religion und Wissenschaft.
Schlüsselwörter
Deutsche Nationalstaatsgründung, Revolution von oben, Otto von Bismarck, Zollverein, Wirtschaftsintegration, soziokultureller Wandel, soziale Mobilität, Vereinsbildung, politische Nationalbewegung, Nationsbildung, Max Weber, gemeinsames Handlungsmuster, Kulturgüter.
Häufig gestellte Fragen
War die Reichsgründung 1871 nur eine „Revolution von oben“?
Nein, obwohl Bismarck die Einigung politisch-militärisch vollzog, basierte sie auf einem tiefgreifenden soziokulturellen und wirtschaftlichen Integrationsprozess der Bevölkerung.
Welche Bedeutung hatte der Deutsche Zollverein für die Einigung?
Der Zollverein schuf einen gemeinsamen Wirtschaftsraum, der die wirtschaftlichen Verklammerungen zwischen den deutschen Staaten stärkte und die politische Einheit vorbereitete.
Wie förderte das Vereinswesen das Nationalbewusstsein?
Überregionale Vereine und Verbände ermöglichten eine Kommunikation über Grenzen hinweg und schufen gemeinsame Identifikationsmerkmale für die deutsche Nation.
Was versteht Max Weber unter Nation als „Zumutung von Solidarität“?
Weber beschreibt damit das Konzept, dass ein Nationalstaat von seinen Bürgern eine spezifische Solidarität verlangt, die über lokale Bindungen hinausgeht.
Welchen Einfluss hatte der technische Fortschritt auf die Reichsgründung?
Fortschritte im Verkehrs- (Eisenbahn) und Nachrichtenwesen (Telegrafie) führten zu einer Entlokalisierung von Lebenswelten und förderten die überregionale Vernetzung.
- Arbeit zitieren
- Christian Tischner (Autor:in), 2005, Gemeinsame Handlungsmuster im Vorfeld der deutschen Nationalstaatsgründung von 1871 oder "Die innere Reichsgründung", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59248