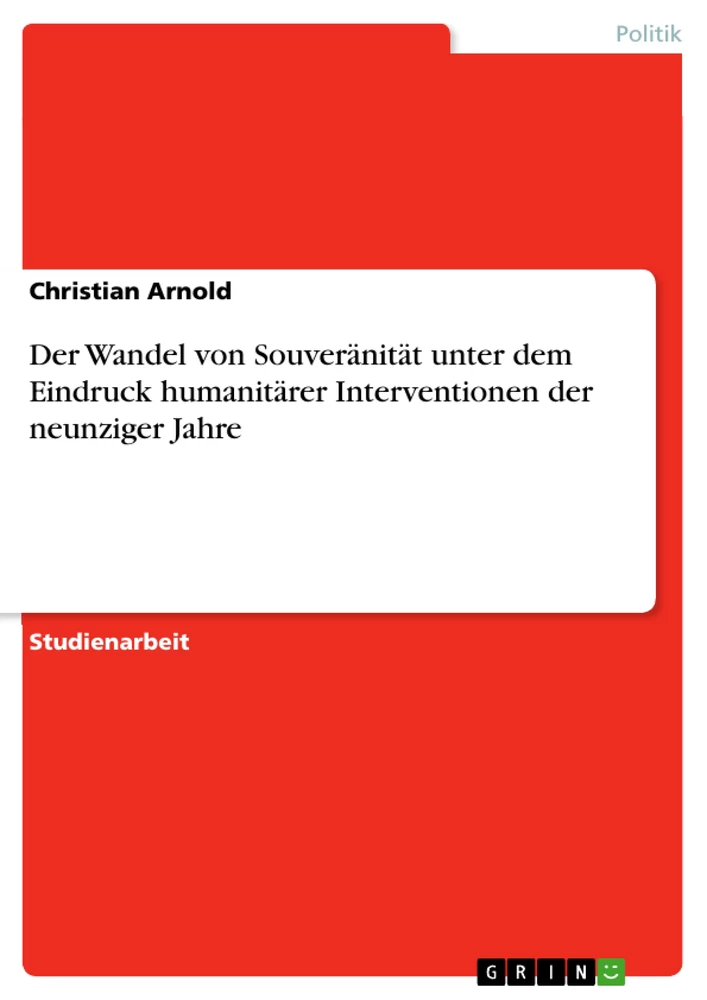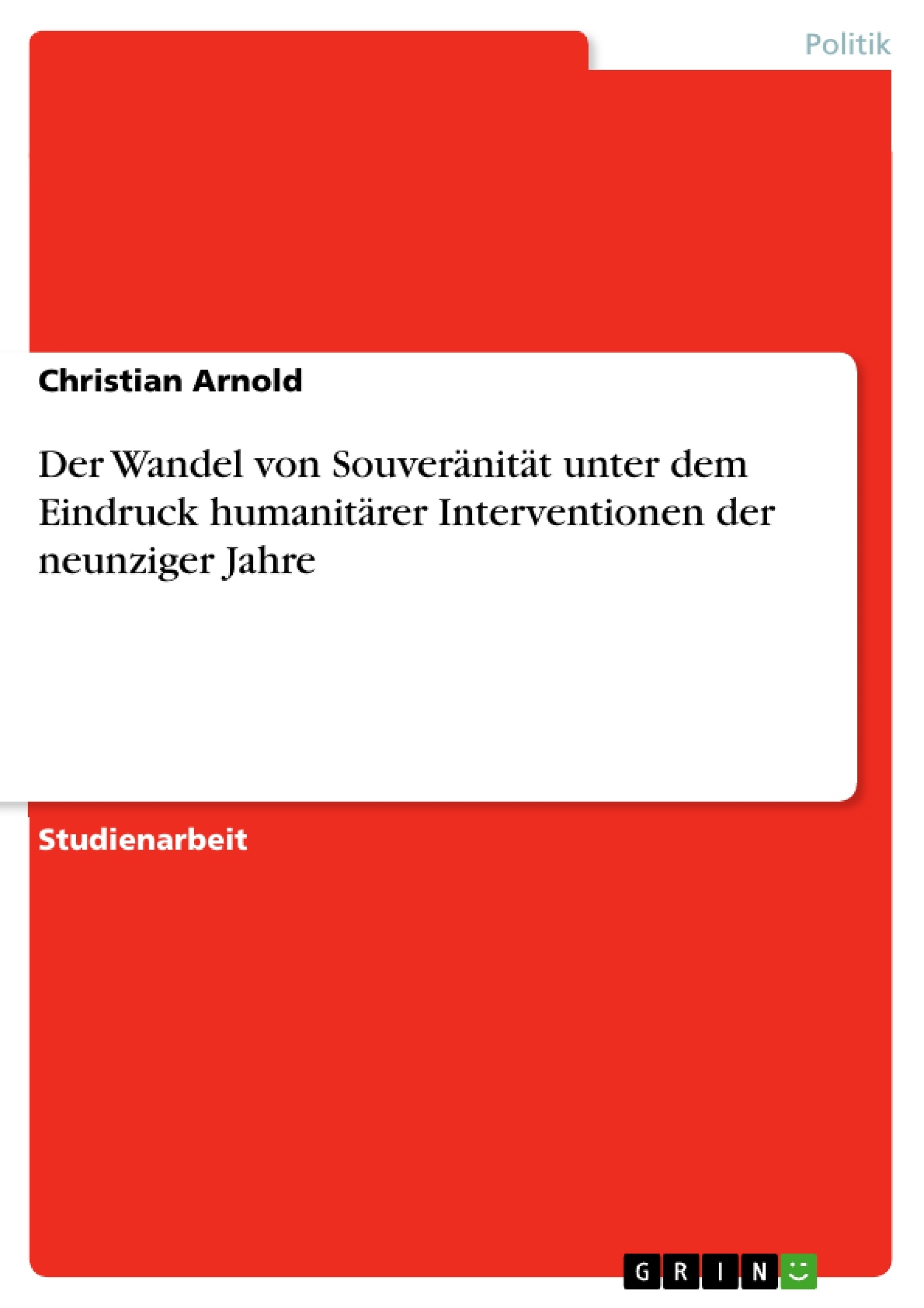In den Theorien der internationalen Beziehungen spielen Staaten eine entscheidende Rolle, unabhängig davon, durch welche theoretische Brille man das internationale System betrachtet. Im Versuch, den Staat auf konzeptioneller Ebene zu beschreiben und zu definieren, gibt es dabei eine Vielzahl möglicher Herangehensweisen, die dabei zu mindestens so ebenso vielen Begriffsverständnissen führen (Schultze 2001: 476). Ein Element, das untrennbar mit moderner Staatlichkeit einher zu gehen scheint, ist die Souveränität. Als Grundlage von Staatlichkeit gibt es traditionell verschiedene Definitionen und Meinungen darüber, wie genau sich Souveränität gestaltet. Konsens scheint die grundsätzliche Unterteilung von Souveränität in einen Herrschaftsanspruch mit Innen- und Außendimension zu finden. (Seidelmann 2001: 449) “Internallyit means that the government of a State is considered the ultimate authority within its borders and jurisdiction.[…]External sovereignty means, that a state is not subject to the legal power of any other State or of any other higher authority”(Schrijver 1999: 70f.). Sinn scheint diese Unterscheidung in Außen- und Innendimension nicht zuletzt auch deshalb zu machen, weil sie sich auf die historische Entstehung des Souveränitätsbegriffs zurückführen lässt. Mittelalterliche Könige erwehrten sich der Einmischung in die Regierungsgeschäfte zum einen von außen durch Papst und Kaiser. Zum anderen galt es sich nach innen gegenüber untergebenen Adligen des feudalen Systems und deren Herrschaftsanspruch durchzusetzen. (Nay 2004: 154ff.) Seit dem zweiten Weltkrieg gab keine grundsätzliche Debatte mehr über Souveränität. Souveränität galt als „astatic, fixed concept: a set of ideas that underlies international relations, but is not changed along with them.“(Barkin/Cronin 1994: 107) Erst mit Beginn der 1990er Jahre fand das Thema in der Literatur wieder mehr Aufmerksamkeit. Unter dem Eindruck der verschiedenen tiefgreifenden Veränderungen des internationalen Systems wie dem Ende des Ost-West Gegensatzes, der zunehmenden Globalisierung, Interdependenz etc. setzte eine Diskussion über Souveränität ein, die bis zum heutigen Tag andauert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Herausforderungen des Konzeptes der Souveränität am Beispiel des Souveränitätsverständnisses von Morgenthau
- Die Konzeption der Souveränität bei Morgenthau
- Die Herausforderung des Konzeptes in den 90ern
- Staatliche Souveränität unter neuem Blickwinkel
- Changing Sovereignty
- Das komplementäre Zusammenspiel von Intervention und Souveränität - Ein sozialkonstruktivistischer Ansatz
- Die Konstruktion von Souveränität durch humanitäre Interventionen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Veränderlichkeit des Souveränitätsbegriffs im Kontext humanitärer Interventionen. Sie analysiert die traditionelle Vorstellung von Souveränität im Realismus und stellt diese der Herausforderung durch humanitäre Interventionen gegenüber. Ziel ist es, die Auswirkungen dieser Interventionen auf das Verständnis von Souveränität im internationalen System zu beleuchten und ein konstruktivistisches Erklärungsmodell für den Wandel von Souveränität zu entwickeln.
- Die statische Auffassung von Souveränität im Realismus und ihre Grenzen
- Humanitäre Interventionen als Herausforderung des realistischen Souveränitätsbegriffs
- Die Konstruktion von Souveränität durch Interventionen
- Die Auswirkungen humanitärer Interventionen auf Staatlichkeit und das internationale System
- Die Debatte über Souveränität und ihre möglichen Folgen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Bedeutung des Souveränitätsbegriffs in den Theorien der internationalen Beziehungen. Sie stellt die Notwendigkeit eines neuen Blickwinkels auf Souveränität angesichts der Veränderungen im internationalen System dar.
Der erste Abschnitt der Arbeit beschäftigt sich mit dem Souveränitätsverständnis von Hans J. Morgenthau, einem der Begründer des Realismus. Es wird argumentiert, dass Morgenthaus statische Auffassung von Souveränität in Anbetracht der Veränderungen des internationalen Systems, insbesondere in den 1990er Jahren, nicht mehr haltbar ist.
Der zweite Abschnitt der Arbeit analysiert das Konzept von „Changing Sovereignty“. Es wird ein sozialkonstruktivistischer Ansatz vorgestellt, der die Wechselwirkungen zwischen Interventionen und Souveränität beleuchtet. Dieser Ansatz zeigt auf, wie humanitäre Interventionen das Verständnis von Souveränität beeinflussen und einen Wandel in der Wahrnehmung von Staatlichkeit bewirken können.
Schlüsselwörter
Souveränität, humanitäre Interventionen, Realismus, sozialer Konstruktivismus, internationales System, Staatlichkeit, Wandel, Macht, Interessen, Interventionismus, Politik, Internationales Recht, Morgenthau, Politik among Nations.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert sich staatliche Souveränität traditionell?
Traditionell wird zwischen einer Innendimension (höchste Autorität innerhalb der Grenzen) und einer Außendimension (Unabhängigkeit von fremder Gewalt) unterschieden.
Warum änderte sich das Verständnis von Souveränität in den 1990er Jahren?
Durch das Ende des Ost-West-Gegensatzes, Globalisierung und zunehmende humanitäre Interventionen wurde das statische Konzept der Souveränität in Frage gestellt.
Welche Rolle spielen humanitäre Interventionen beim Wandel der Souveränität?
Interventionen zum Schutz von Menschenrechten zeigen, dass Souveränität kein absolutes Schutzschild mehr ist, wenn ein Staat seine Bürger nicht schützt.
Was besagt der sozialkonstruktivistische Ansatz in dieser Arbeit?
Er geht davon aus, dass Souveränität kein feststehendes Faktum ist, sondern durch das Handeln und die Normen der internationalen Gemeinschaft ständig neu konstruiert wird.
Wer war Hans J. Morgenthau?
Morgenthau war ein Begründer des Realismus, dessen statisches Souveränitätsverständnis in der Arbeit als Vergleichspunkt für moderne Entwicklungen dient.
- Citation du texte
- Christian Arnold (Auteur), 2006, Der Wandel von Souveränität unter dem Eindruck humanitärer Interventionen der neunziger Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59362