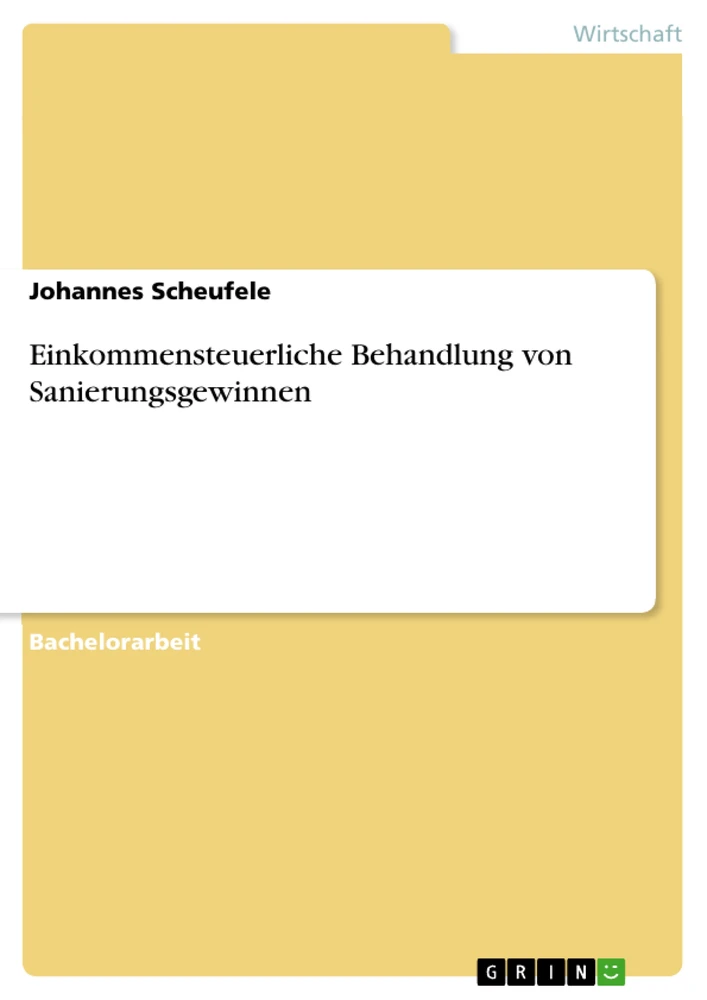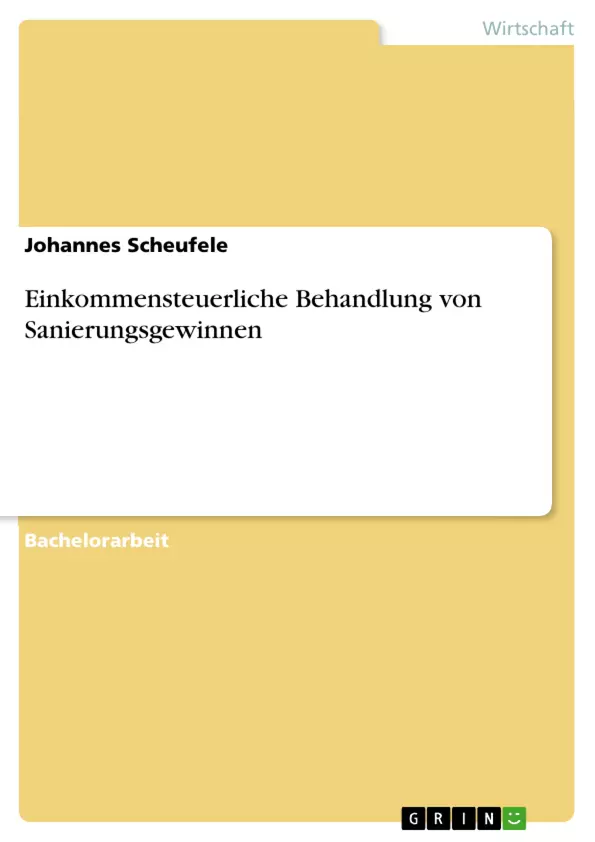Um die Insolvenz eines geschwächten Unternehmens abwenden und um dessen finanzielle Solidität und dessen Ertragsfähigkeit wiederherstellen zu können, gibt es unterschiedliche Sanierungsmöglichkeiten. Eine dieser Sanierungsmaßnahmen, die Gegenstand dieser Arbeit ist, sind Schuldenerlasse durch Gläubiger eines geschwächten Unternehmens, die zur Vermehrung des Betriebsvermögens führen.
Der einkommensteuerliche Umgang der damit einhergehender Sanierungserträge weist eine über 90 Jahre alte Tradition auf. Im Juni 2017 antwortete der Gesetzgeber mit der Einführung des § 3a EStG und kodifizierte durch diese Neuregelung eine erneute Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen.
Die damit realisierte Steuerbefreiung knüpft im Grundgedanken an § 3 Nr. 66 EStG a.F. an, beinhaltet allerdings auch komplexe Weisungen, die neben einer verpflichtenden Wahlrechtausübung auch den Untergang diverser Steuerminderungspositionen nach sich zieht. Hiermit verfolgt der Gesetzgeber den Willen, eine Doppelbegünstigung zu vermeiden und die Steuerbefreiung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Ob diese gesetzgeberische Ausgestaltung unverhältnismäßige Ausmaße angenommen hat, was der überwiegenden Beurteilung in der Literatur entsprechen würde, oder aber willkommene Richtigstellungen mit sich bringt und dem Steuerpflichtigen damit mehr Planungssicherheit einräumt, ist wesentliche Frage, die in dieser Arbeit gestellt, diskutiert und geklärt werden soll.
Nach der einführenden Definition des Sanierungsbegriffs und dessen Abgrenzung von verwandten Begriffen, werden die Anwendungsbereiche der Sanierungsgewinnbesteuerung abgesteckt. Im Anschluss wird auf die tatbestandlichen Voraussetzungen der aktuellen Gesetzeskodifizierung als erstes Kernelement eingegangen und werden insbesondere die kritischen Standpunkte im Rahmen der unternehmensbezogenen Sanierung gegenübergestellt und bewertet. Im zweiten Kernelement der Arbeit werden die kodifizierten Rechtsfolgen mit den unterschiedlichen aktuellen Standpunkten der Wissenschaft konfrontiert und noch ausführlicher als die Tatbestandsmerkmale diskutiert und beurteilt. Eine Zusammenfassung der Problembereiche und ein Ausblick bzgl. der zukünftigen Behandlung dieser Themen soll die Arbeit am Schluss thematisch abrunden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der Sanierungsgewinnbesteuerung
- Sanierung: Begriffsbestimmung und -abgrenzung
- Geltungsbereiche
- Systematische Einordnung
- Zeitlicher Geltungsbereich
- Sachlicher Geltungsbereich
- Persönlicher Geltungsbereich
- Tatbestandsvoraussetzungen der Steuerbefreiung
- Sanierungsertrag durch Schuldenerlass gem. § 3a Abs. 1 EStG
- Unternehmensbezogene Sanierung gem. § 3a Abs. 2 EStG
- Sanierungsbedürftigkeit des Unternehmens
- Sanierungsfähigkeit des Unternehmens
- Sanierungseignung des Schuldenerlasses
- Sanierungsabsicht der Gläubiger
- Betrieblich veranlasster Schuldenerlass
- Nachweis der Sanierungsvoraussetzungen
- Rechtsfolgen
- Ausübung steuerlicher Wahlrechte (§ 3a Abs. 1 S. 2 u. 3 EStG)
- Abzugsverbot für Sanierungskosten gem. § 3c Abs. 4 EStG
- Verrechnung der Verlustpotentiale (§ 3a Abs. 3 EStG)
- Grundsätze der Verrechnungsregeln
- Reihenfolge des Verlustuntergangs gem. § 3a Abs. 3 S. 2 EStG
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der einkommensteuerlichen Behandlung von Sanierungsgewinnen, die durch Schuldenerlasse in Unternehmen entstehen. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen und die Tatbestandsvoraussetzungen für die Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen gemäß § 3a EStG. Die Arbeit beleuchtet auch die verschiedenen Rechtsfolgen der Sanierungsgewinnbesteuerung, wie die Ausübung steuerlicher Wahlrechte, das Abzugsverbot für Sanierungskosten und die Verrechnung der Verlustpotentiale.
- Rechtliche Grundlagen der Sanierungsgewinnbesteuerung
- Tatbestandsvoraussetzungen für die Steuerbefreiung
- Rechtsfolgen der Sanierungsgewinnbesteuerung
- Sanierungserträge durch Schuldenerlasse
- Verrechnung von Verlustpotenzialen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas Sanierungsgewinne im Kontext von Unternehmenskrisen beleuchtet. Kapitel 2 behandelt die Grundlagen der Sanierungsgewinnbesteuerung, einschließlich einer Definition des Begriffs "Sanierung" und der Abgrenzung zu anderen Begriffen. Kapitel 3 untersucht die Tatbestandsvoraussetzungen für die Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen, sowohl bei Schuldenerlassen gemäß § 3a Abs. 1 EStG als auch bei unternehmensbezogenen Sanierungen gemäß § 3a Abs. 2 EStG. In Kapitel 4 werden die Rechtsfolgen der Sanierungsgewinnbesteuerung erörtert, wie die Ausübung steuerlicher Wahlrechte, das Abzugsverbot für Sanierungskosten und die Verrechnung der Verlustpotentiale. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der Sanierungsgewinnbesteuerung, darunter Schuldenerlass, Sanierungsertrag, Steuerbefreiung, § 3a EStG, Unternehmensbezogene Sanierung, Sanierungsbedürftigkeit, Sanierungsfähigkeit, Sanierungseignung, Sanierungsabsicht, Verlustpotentiale, Verrechnung und Abzugsverbot. Die Arbeit analysiert die einschlägige Rechtsprechung und die Literatur zum Thema Sanierungsgewinne, um ein umfassendes Bild der steuerlichen Behandlung dieser Erträge zu zeichnen.
- Quote paper
- Johannes Scheufele (Author), 2019, Einkommensteuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/593625