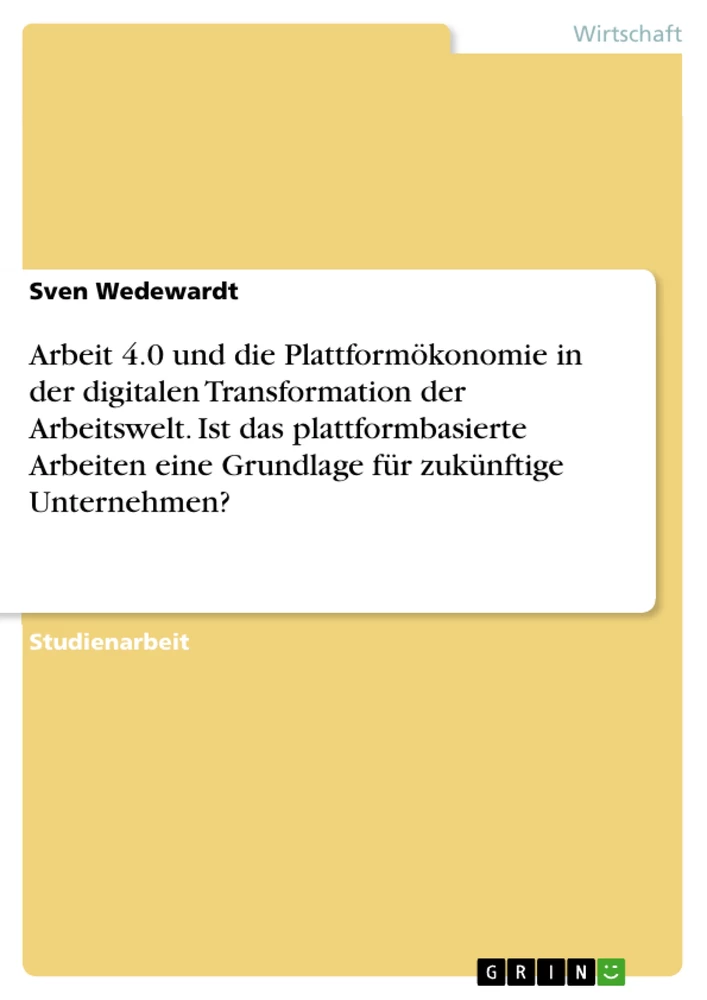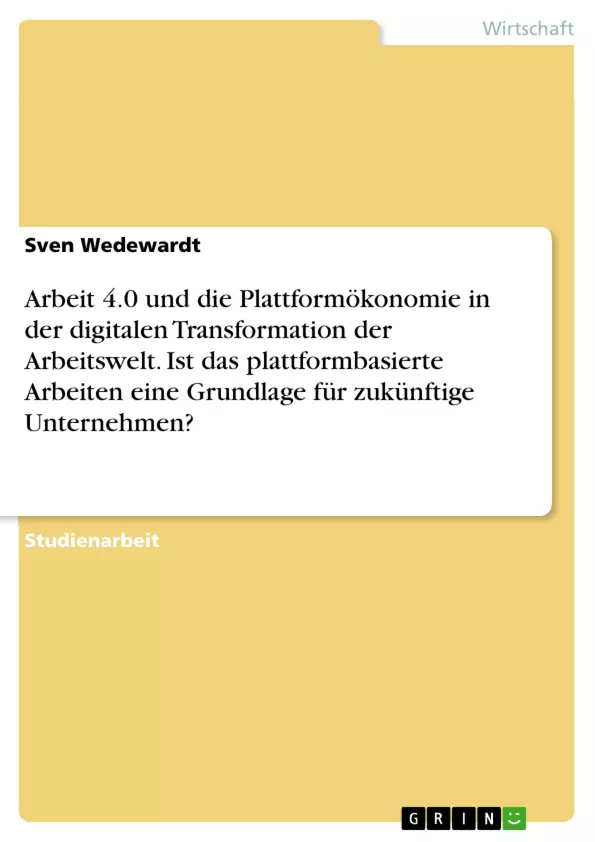Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob plattformbasiertes Arbeiten eine Grundlage für zukünftige Unternehmen ist. Um der zuvor gestellten Forschungsfrage auf den Grund zu gehen, wird folgender Forschungsgang verfolgt: Nach einführenden Worten zum Thema im ersten Kapitel werden im zweiten Kapitel zunächst die grundlegenden Begrifflichkeiten der Plattformökonomie erläutert. Beginnend wird das Geschäftsmodell der Plattformökonomie dargestellt. Weiter wird darauf aufbauend auf die disruptiven Eigenschaften von Plattformen eingegangen.
Das dritte Kapitel handelt von dem Thema Arbeit 4 Punkt 0. Dann wird zunächst die digitale Transformation der Arbeitswelt beschrieben. Dieses Kapitel dient als Basis für die Forschungen im darauffolgenden Kapitel. Weiterhin werden kurz die Auswirkungen neuer Gestaltungsformen von Arbeit 4 Punkt 0 in Unternehmen diskutiert. Im weiteren Kapitel werden die Funktion, Eigenschaften und Potenziale von Crowdworking-Plattformen ausführlich beschrieben. Auf der Basis dieser Erkenntnisse wird im nächsten Kapitel die Funktion eines plattformbasierten Unternehmens skizziert. Abschließend werden die Resultate dieser Arbeit im Fazit kurz zusammengefasst und ein Ausblick auf aufbauende Themen wird gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführende Worte
- Struktur der Arbeit
- Plattformökonomie
- Grundlagen einer Plattform
- Power of Platform
- Arbeit 4.0
- Digitale Transformation der Arbeitswelt
- Gestaltung von Arbeit 4.0
- Das plattformbasierte Unternehmen
- Crowdworking
- Plattformbasiertes Arbeiten als Zukunft digitaler Unternehmen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob das plattformbasierte Arbeiten eine Grundlage für zukünftige Unternehmen darstellt. Sie untersucht die Auswirkungen der Plattformökonomie auf die Arbeitswelt und analysiert die Chancen und Herausforderungen, die sich aus dieser Entwicklung ergeben.
- Plattformökonomie als Geschäftsmodell und ihre Auswirkungen auf Unternehmen
- Digitale Transformation der Arbeitswelt und die Entstehung von Arbeit 4.0
- Crowdworking als Beispiel für plattformbasiertes Arbeiten
- Potenzial und Herausforderungen des plattformbasierten Arbeitens für Unternehmen
- Zukünftige Entwicklungen der Plattformökonomie und ihrer Auswirkungen auf die Arbeitswelt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Plattformökonomie und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt ein. Sie stellt die Forschungsfrage der Arbeit und skizziert die Struktur der Arbeit.
Plattformökonomie
Dieses Kapitel beleuchtet die Grundlagen einer Plattform und die Bedeutung von Netzwerkeffekten für den Erfolg von Plattformmodellen. Es wird insbesondere auf den Aspekt der "Power of Platform" eingegangen.
Arbeit 4.0
In diesem Kapitel wird die digitale Transformation der Arbeitswelt und die Entstehung von Arbeit 4.0 analysiert. Es werden die Chancen und Herausforderungen dieser Entwicklung dargestellt.
Das plattformbasierte Unternehmen
Dieses Kapitel fokussiert auf das Konzept des Crowdworkings als Beispiel für plattformbasiertes Arbeiten. Es werden die Vor- und Nachteile dieser Arbeitsform sowie die Chancen und Herausforderungen für Unternehmen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Plattformökonomie, Arbeit 4.0, digitale Transformation, Crowdworking, Plattformbasiertes Arbeiten, Zukunft der Arbeit, Unternehmen, Geschäftsmodell, Netzwerkeffekte, Power of Platform, Chancen, Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Plattformökonomie?
Die Plattformökonomie ist ein Geschäftsmodell, das auf digitalen Plattformen basiert, die Anbieter und Nachfrager direkt vernetzen (z. B. Uber, Airbnb oder Crowdworking-Portale).
Was versteht man unter "Arbeit 4.0"?
Arbeit 4.0 beschreibt die Gestaltung der Arbeitswelt im Zeitalter der Digitalisierung, geprägt durch Flexibilität, Vernetzung und neue Formen der Zusammenarbeit.
Was ist Crowdworking?
Crowdworking ist eine Form des plattformbasierten Arbeitens, bei der Aufgaben über das Internet an eine Vielzahl von Personen (die "Crowd") ausgelagert werden.
Welche disruptiven Eigenschaften haben Plattformen?
Plattformen können traditionelle Branchen und Arbeitsverhältnisse radikal verändern, indem sie Mittelsmänner ausschalten und durch Netzwerkeffekte schnell Marktdominanz erreichen.
Ist plattformbasiertes Arbeiten die Zukunft der Unternehmen?
Die Arbeit untersucht, ob Unternehmen künftig verstärkt auf externe Plattformstrukturen setzen, um agiler und effizienter auf Marktanforderungen zu reagieren.
- Citar trabajo
- Sven Wedewardt (Autor), 2019, Arbeit 4.0 und die Plattformökonomie in der digitalen Transformation der Arbeitswelt. Ist das plattformbasierte Arbeiten eine Grundlage für zukünftige Unternehmen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/593782