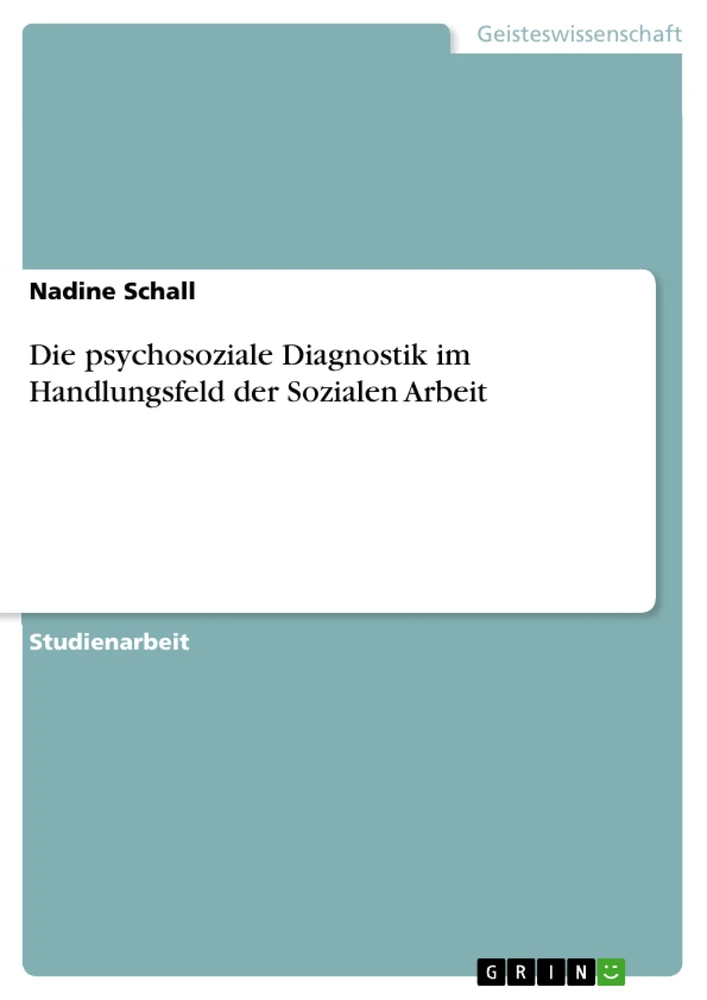Im Folgenden sollen sowohl der Ablauf, der Nutzen aber auch Schwierigkeiten von psychosozialer Diagnostik für das Klientel und das Handlungsfeld der Sozialen Arbeit aufgeführt werden. Des Weiteren wird noch exemplarisch ein diagnostisches Verfahren vorgestellt.
Schon seit einigen Jahren wird die Frage diskutiert, ob Soziale Arbeit eine Profession ist oder nicht. Viele Kritiker sind der Meinung, dass es an einer wissenschaftlichen Grundlage mangele und somit die Kriterien einer Profession nicht erfüllt seien. Sozialarbeiter werden wie alle Menschen von ihren Erfahrungen und dem somit erworbenen Alltagswissen beeinflusst. Um dem zu entgehen brauchen sie eine wissenschaftliche Vorgehensweise, die den Einfluss von Alltagstheorien kontrolliert. Hier spielt Soziale Diagnostik eine entscheidende Rolle, denn sie ist ein Schritt hin zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit.
Nun stellt sich die Frage, was unter Sozialer Diagnostik zu verstehen ist. Mit dem Begriff Diagnose verbindet die Mehrheit der Menschen die Medizin oder die Psychologie. Dies sind auch die Handlungsfelder, in denen Diagnosen am bekanntesten sind. Sinngemäß heißt Diagnostizieren "im Hinblick auf ein angestrebtes Ziel regelgeleitet Informationen zu gewinnen". Im Handlungsfeld der Sozialen Arbeit spricht man von (psycho-)sozialer Diagnose. Die Aufmerksamkeit wird hier auf die Persönlichkeit und das soziale Umfeld eines Menschen gelegt. Mit einem Blick in die Geschichte der Sozialen Arbeit wird der Zusammenhang von Professionalisierung und psychosozialer Diagnostik deutlich.
Eingeführt wurde der Begriff 1917 in den USA durch die Pionierin Mary Richmond (Mitglied der Charity Organisation Society) und der Veröffentlichung ihres Buches "Social Diagnosis". Dies wurde zur wissenschaftlichen Grundlage für die Methode der Einzelfallhilfe (Case-Work). Das heißt, die Sozialarbeiter sollten die individuellen Probleme jedes Hilfsbedürftigen herausfinden und auf deren Basis eine bedarfsgerechte Hilfe anbieten. Durch Mary Richmond inspiriert, führte die Pionierin Alice Solomon den Begriff der sozialen Diagnostik 1926 in Deutschland ein. Beide erkannten die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Grundlage Sozialer Arbeit und begründeten damit die Anfänge deren Professionalisierung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Psychosoziale Diagnostik
- Prozess
- Funktionen
- Diagnostische Verfahren
- Probleme
- Auswirkungen auf das Klientel
- Anforderungen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Bedeutung der psychosozialen Diagnostik für die Professionalisierung der Sozialen Arbeit. Sie argumentiert, dass wissenschaftlich fundierte Praxis essenziell ist, um die Herausforderungen der Sozialen Arbeit zu bewältigen und die Bedürfnisse von Klienten effektiv zu adressieren.
- Die Rolle des Beobachtungs- und Beschreibungswissens in der Sozialen Arbeit
- Die Bedeutung der psychosozialen Diagnostik als Instrument der Professionalisierung
- Der Prozess der psychosozialen Diagnostik, einschließlich der verschiedenen Strategien und Phasen
- Die Funktionen und Vorteile der psychosozialen Diagnostik für Klienten und Sozialarbeiter
- Die Herausforderungen und Probleme, die mit der Anwendung der psychosozialen Diagnostik verbunden sind
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Einleitung führt in die Thematik der Professionalisierung der Sozialen Arbeit ein und argumentiert für die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Grundlage, die durch die psychosoziale Diagnostik gewährleistet werden kann. Der Begriff der Diagnostik wird in Bezug auf die Soziale Arbeit erklärt und die historische Entwicklung des Konzepts wird beleuchtet.
Psychosoziale Diagnostik
Dieses Kapitel beschreibt den Prozess der psychosozialen Diagnostik, einschließlich der verschiedenen Strategien und Phasen. Es werden die Funktionen und Vorteile der Diagnostik beleuchtet und die Herausforderungen und Probleme, die mit ihrer Anwendung verbunden sind, diskutiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Soziale Arbeit, Professionalisierung, psychosoziale Diagnostik, Beobachtungs- und Beschreibungswissen, Diagnostische Verfahren, Klienten, Intervention, Wissenschaftlichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter psychosozialer Diagnostik?
Es ist das regelgeleitete Gewinnen von Informationen über die Persönlichkeit und das soziale Umfeld eines Menschen, um bedarfsgerechte Hilfe in der Sozialen Arbeit anzubieten.
Warum ist Diagnostik für die Professionalisierung der Sozialen Arbeit wichtig?
Sie bietet eine wissenschaftliche Grundlage, die den Einfluss von bloßem Alltagswissen kontrolliert und die Soziale Arbeit als anerkannte Profession stärkt.
Wer waren die Pionierinnen der Sozialen Diagnostik?
Mary Richmond führte den Begriff 1917 in den USA ein; Alice Salomon brachte das Konzept 1926 nach Deutschland.
Welche Funktionen erfüllt die psychosoziale Diagnostik?
Sie dient der Klärung von Problemlagen, der Interventionsplanung und der Evaluation der Hilfeleistungen für das Klientel.
Welche Schwierigkeiten gibt es bei diesem Verfahren?
Probleme können in der Subjektivität der Beobachtung, ethischen Bedenken oder der Komplexität der sozialen Verhältnisse liegen.
- Quote paper
- Nadine Schall (Author), 2009, Die psychosoziale Diagnostik im Handlungsfeld der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/594039