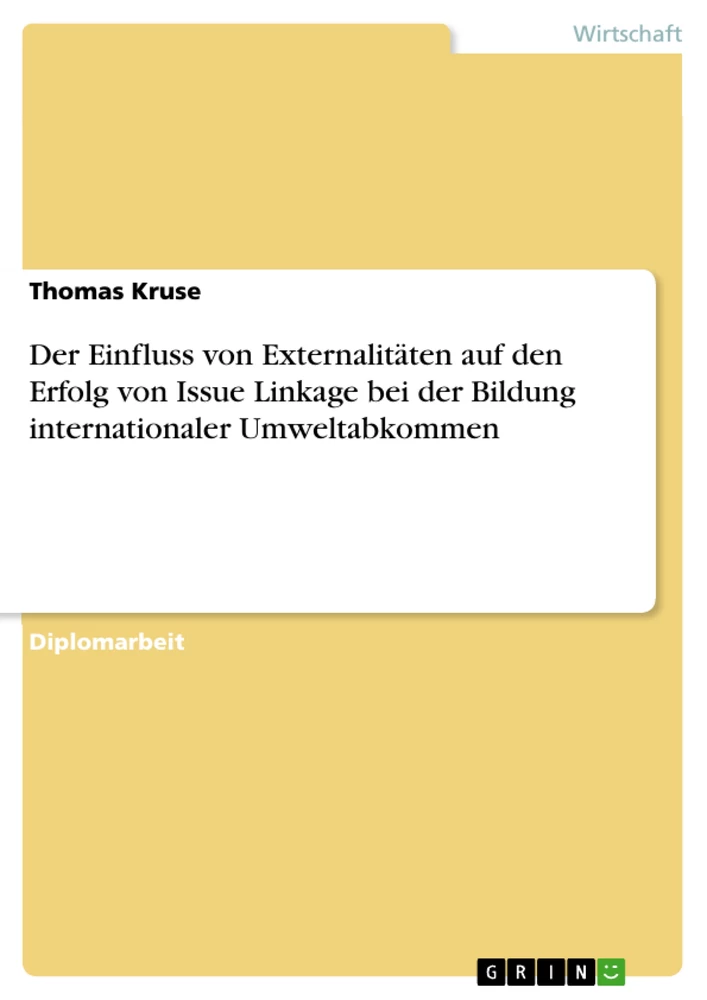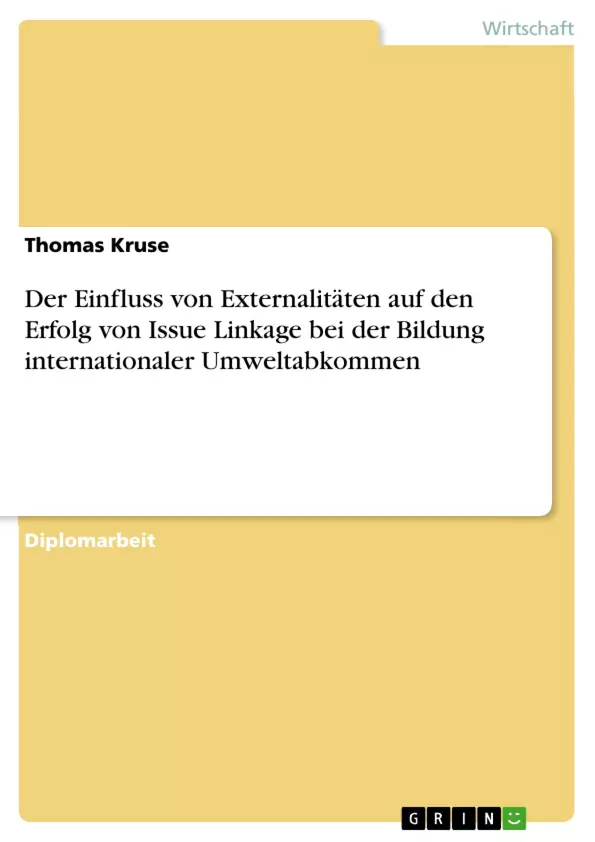Aufgrund der in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer offener zu Tage tretenden globalen Umweltschäden, verursacht durch die zunehmende Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden durch eine immer weiter wachsende Weltwirtschaft und zunehmende Industrialisierung auch in Entwicklungsländern, nimmt die Bedeutung erfolgreicher internationaler Umweltabkommen, die zu einer deutlichen Entlastung der Umwelt führen, immer weiter zu. Der Verursacherstaat einer global umweltbelastenden Aktivität verursacht nicht nur in seinem Land Schäden, sondern auch in anderen Staaten, die er aber bei der Entscheidung über sein Emissionsniveau nicht berücksichtigt. Wegen dieser Externalitäten führen die Emissionsentscheidungen der einzelnen Staaten nicht zu einem globalen Optimum im Spannungsfeld zwischen den Kosten der Umweltschäden einerseits und den Vorteilen umweltbelastender Aktivitäten andererseits, sondern zu einer übermäßigen Belastung und Zerstörung der Ressource Umwelt. Durch internationale Umweltkooperation kann eine Internalisierung der externen Effekte erreicht werden, die zu einer Emissionsreduktion und damit zu einer Erhöhung der globalen Wohlfahrt führt. Die Umsetzung der internationalen Umweltzusammenarbeit sieht sich jedoch mit erheblichen Problemen konfrontiert, die durch Abbildung der Realität in einem abstrahierenden Modell einer wirtschaftstheoretischen Analyse zugänglich gemacht werden können. Zwei dieser Probleme seien hier näher betrachtet: Erstens muss die Beteiligung an einem Umweltabkommen für alle Staaten profitabel sein, d. h. ihre individuelle Wohlfahrt muss sich durch die Beteiligung an dem Abkommen erhöhen. Zweitens muss ein internationales Umweltabkommen selbstdurchsetzend sein, d. h. die betroffenen Länder müssen bereit sein, die in dem Umweltabkommen enthaltenen Verpflichtungen umzusetzen und einzuhalten. Zur Überwindung der dargestellten Probleme der Umweltkooperation sind in der umweltökonomischen Literatur verschiedene Vertragsgestaltungselemente entwickelt und diskutiert worden. Ein mögliches Element wird als Issue Linkage bezeichnet. Im Rahmen dieser Arbeit wird analysiert, welche Faktoren für den Erfolg von Issue Linkage maßgeblich sind und insbesondere der Einfluss von Externalitäten auf den Erfolg von Issue Linkage bei der Bildung internationaler Umweltabkommen diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Die Grundidee von Issue Linkage
- 3. Das Modell von Carraro und Siniscalco (1997)
- 3.1 Die Modellannahmen
- 3.2 Einordnug des Modells innerhalb der Koalitionstheorie
- 3.3 Die Entscheidungsfolge des Modells
- 3.3.1 Die Höhe der Produktion und der R&D-Ausgaben
- 3.3.2 Die optimal Emissionsreduktion
- 3.3.3 Stabile Koalitionen
- 4. Beurteilung von Issue Linkage
- 4.1 Auswirkungen auf die globale Wohlfahrt
- 4.2 Die Welt ohne Issue Linkage
- 4.3 Die Welt mit Issue Linkage
- 5. Der Einfluss von Externalitäten auf den Erfolg von Issue Linkage
- 5.1 Positive und negative Externalitäten bei der Koalitionsbildung
- 5.2 Die positive Externalität im reinen Umweltabkommen
- 5.3 Die Externalitäten im reinen R&D-Abkommen
- 5.4 Externalitäten und Issue Linkage
- 6. Bewertung des Modells
- 7. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht den Einfluss von Externalitäten auf den Erfolg von Issue Linkage bei der Bildung internationaler Umweltabkommen. Sie analysiert das Modell von Carraro und Siniscalco (1997) und bewertet dessen Aussagekraft in Bezug auf die Auswirkungen von Issue Linkage auf die globale Wohlfahrt.
- Analyse des Modells von Carraro und Siniscalco (1997) zur Modellierung von Issue Linkage
- Bewertung des Einflusses von Externalitäten auf die Bildung stabiler Koalitionen
- Untersuchung der Auswirkungen von Issue Linkage auf die globale Wohlfahrt
- Diskussion der Grenzen und Schwächen des Modells
- Beurteilung des Potenzials von Issue Linkage für die erfolgreiche Gestaltung internationaler Umweltabkommen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einführung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Diplomarbeit ein und erläutert die Relevanz von Issue Linkage für die internationale Umweltpolitik.
Kapitel 2: Die Grundidee von Issue Linkage: In diesem Kapitel wird das Konzept von Issue Linkage definiert und seine Funktionsweise erläutert. Es werden verschiedene Ansätze zur Anwendung von Issue Linkage in der internationalen Umweltpolitik vorgestellt.
Kapitel 3: Das Modell von Carraro und Siniscalco (1997): Dieses Kapitel beschreibt das Modell von Carraro und Siniscalco (1997), welches zur Analyse des Einflusses von Issue Linkage auf die Bildung stabiler Koalitionen verwendet wird. Es werden die Modellannahmen, die Entscheidungsfolge und die Bedeutung von Externalitäten im Modell dargestellt.
Kapitel 4: Beurteilung von Issue Linkage: In diesem Kapitel wird die Aussagekraft des Modells von Carraro und Siniscalco (1997) in Bezug auf die Auswirkungen von Issue Linkage auf die globale Wohlfahrt bewertet. Es werden die Unterschiede zwischen einer Welt ohne Issue Linkage und einer Welt mit Issue Linkage herausgestellt.
Kapitel 5: Der Einfluss von Externalitäten auf den Erfolg von Issue Linkage: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Externalitäten auf die Bildung stabiler Koalitionen und die Effizienz von Issue Linkage. Es wird die Rolle positiver und negativer Externalitäten im Kontext des Modells von Carraro und Siniscalco (1997) analysiert.
Schlüsselwörter
Issue Linkage, internationale Umweltabkommen, Koalitionstheorie, Externalitäten, globale Wohlfahrt, Modell von Carraro und Siniscalco (1997), Emissionsreduktion, Forschung und Entwicklung, Stabile Koalitionen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Issue Linkage“ bei Umweltabkommen?
Issue Linkage bezeichnet die Verknüpfung von zwei verschiedenen Verhandlungsthemen (z. B. Umweltschutz und technologische Zusammenarbeit), um die Kooperationsbereitschaft von Staaten zu erhöhen.
Warum sind internationale Umweltabkommen oft schwer durchzusetzen?
Hauptprobleme sind Externalitäten: Staaten berücksichtigen oft nur die eigenen Kosten, nicht aber die globalen Schäden. Zudem müssen Abkommen selbstdurchsetzend sein, da es keine Weltregierung gibt.
Welche Rolle spielt das Modell von Carraro und Siniscalco (1997)?
Dieses Modell analysiert, wie Issue Linkage (insbesondere die Verknüpfung von Emissionsreduktion mit Forschung und Entwicklung) zur Bildung stabiler internationaler Koalitionen beitragen kann.
Wie beeinflussen Externalitäten den Erfolg von Abkommen?
Positive Externalitäten (Trittbrettfahrer-Effekte) führen oft dazu, dass Staaten nicht kooperieren. Issue Linkage versucht, diese Effekte durch exklusive Vorteile für Club-Mitglieder zu internalisieren.
Was ist eine „stabile Koalition“ in der Umweltökonomie?
Eine Koalition ist stabil, wenn kein Mitglied einen Anreiz hat auszutreten (interne Stabilität) und kein Nicht-Mitglied einen Anreiz hat beizutreten (externe Stabilität).
Führt Issue Linkage immer zu einer höheren globalen Wohlfahrt?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und zeigt auf, unter welchen Bedingungen die Verknüpfung von Themen tatsächlich zu einer Emissionsreduktion und Wohlfahrtssteigerung führt.
- Quote paper
- Diplom Kaufmann Thomas Kruse (Author), 2006, Der Einfluss von Externalitäten auf den Erfolg von Issue Linkage bei der Bildung internationaler Umweltabkommen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59416