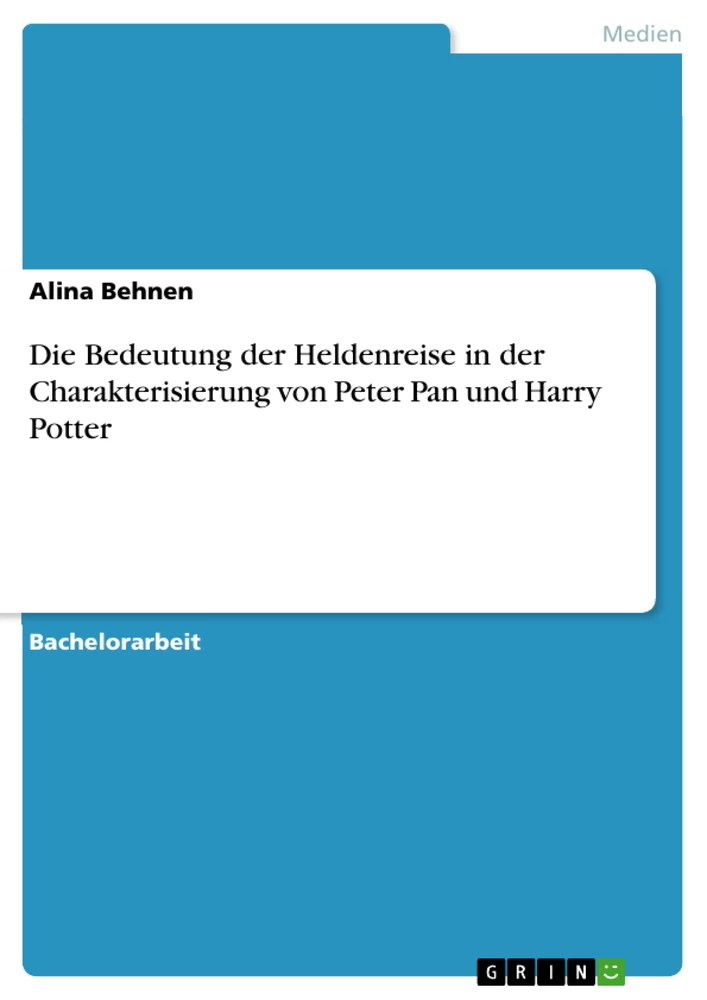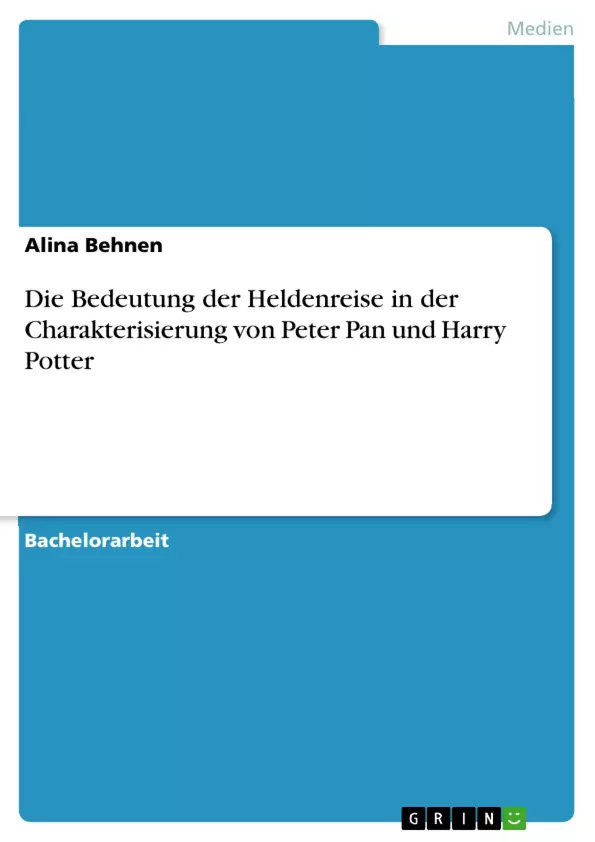In jeder Geschichte muss der Held bestimmte Phasen erreichen, um seine (Helden-)Reise zu bestehen und als Held anerkannt zu werden. Erst wenn ein bestimmter Punkt erreicht ist, kann sich die Figur als Held bezeichnen. Diesbezüglich existieren mehrere Anmerkungen, die sowohl das Aussehen, als auch die Leistungen, die ein Held erfüllen muss, beschreiben.
Durch die Heranziehung zweier bekannter und sich ähnelnder Heldenfilme können die einzelnen Stufen der Heldenreise und die Qualität des heroischen Charakters analysiert werden. Vor diesem Hintergrund gilt es zunächst die Forschungsfrage für diese Bachelorarbeit zu bestimmen, inwiefern die ausgewählten Filmfiguren mit dem Muster der Heldenreise korrespondieren. Es soll herausgearbeitet werden, welchen Status die jeweilige Figur trägt. Dies erfolgt mittels einer Analyse der Abläufe der Heldenreise, wobei untersucht wird, ob einzelne Phasen und Stadien befolgt, übersprungen oder gar ausgelassen werden. Die These, dass nicht alle Stadien der Reise erfüllt werden müssen, um als Held bezeichnet zu werden, soll hiermit aufgestellt und anhand dieser Arbeit bewiesen werden.
Diese Bachelorarbeit wird zur Klärung der Forschungsfrage in vier Kapitel gegliedert. Das erste Kapitel beginnt mit der Einleitung und der Erläuterung zu der methodischen Vorgehensweise der Arbeit. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Definitionen des Mythos und des Helden. Anschließend folgt eine genaue Betrachtung der Modelle der Heldenreise und eine detaillierte Beschreibung zu den Archetypen. Im Hauptteil der Arbeit werden dann zwei Heldenfiguren mit gleichen Merkmalen analysiert und gegenübergestellt. Dabei wird ein genauer Fokus auf die einzelnen Stadien und die Archetypen der Heldenreise gesetzt.
Der Schwerpunkt der Analyse des Helden liegt unterdessen auf den dramaturgischen und visuellen Aspekten. Zum besseren Verständnis wird außerdem die heroische Qualität von Nebencharakteren beschrieben. Im vierten Kapitel werden letztlich alle Resultate der Arbeit zusammengefasst und die Forschungsfrage beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Methode
- 2. Der Mythos der Heldenreise
- 2.1 Der moderne Mythos
- 2.2 Definition Held
- 2.3 Entwicklungsstadien des Helden nach Joseph Campbell
- 2.4 Modelle von Christopher Vogler und Michaela Krützen
- 2.4.1 Archetypen
- 2.4.2 Heldenreise
- 2.4.2.1 Trennung
- 2.4.2.2 Prüfungen
- 2.4.2.3 Ankunft
- 3. Die Helden Analyse
- 3.1 Peter Pan
- 3.1.1 Film Zusammenfassung
- 3.1.2 Dramaturgische Heldenreise
- 3.1.3 Nebenfiguren mit heroischer Qualität
- 3.2 Harry Potter
- 3.2.1 Film Zusammenfassung
- 3.2.2 Dramaturgische Heldenreise
- 3.2.3 Nebenfiguren mit heroischer Qualität
- 3.3 Gegenüberstellung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht, inwieweit die Filmfiguren Peter Pan und Harry Potter dem Muster der Heldenreise nach Joseph Campbell entsprechen. Die Arbeit analysiert die dramaturgischen und visuellen Aspekte der jeweiligen Heldenreise und beleuchtet die Rolle von Nebenfiguren mit heroischen Qualitäten. Das Hauptziel besteht darin, die These zu überprüfen, dass nicht alle Stadien der Heldenreise zwingend erfüllt sein müssen, um eine Figur als Helden zu bezeichnen.
- Der Mythos der Heldenreise und seine Anwendung im Film
- Analyse der Heldenreise bei Peter Pan und Harry Potter
- Vergleich der beiden Heldenfiguren und ihrer jeweiligen Archetypen
- Die Bedeutung von Nebenfiguren mit heroischen Eigenschaften
- Die Frage nach der Notwendigkeit aller Stadien der Heldenreise für die Heldenidentität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Heldenreise ein und stellt die Forschungsfrage nach der Korrespondenz der ausgewählten Filmfiguren mit dem Modell der Heldenreise. Sie skizziert die methodische Vorgehensweise der Arbeit, die auf der Theorie der Figurenanalyse basiert, und erläutert den Aufbau der Bachelorarbeit in vier Kapitel. Die These, dass nicht alle Stadien der Heldenreise zwingend für die Heldenidentität notwendig sind, wird hier formuliert.
2. Der Mythos der Heldenreise: Dieses Kapitel definiert den Mythos der Heldenreise, den modernen Mythos und den Heldenbegriff. Es beleuchtet die Entwicklungsstadien nach Joseph Campbell und die Modelle von Christopher Vogler und Michaela Krützen. Ein besonderer Fokus liegt auf den Archetypen und den einzelnen Phasen der Heldenreise (Trennung, Prüfungen, Ankunft), die als Grundlage für die spätere Figuren Analyse dienen.
3. Die Helden Analyse: Der Hauptteil der Arbeit analysiert die Heldenreise von Peter Pan und Harry Potter. Für jeden Helden wird die Filmhandlung zusammengefasst, seine dramaturgische Heldenreise detailliert untersucht und die heroische Qualität von Nebenfiguren beschrieben. Der Vergleich der beiden Figuren soll die These der Arbeit stützen oder widerlegen.
Schlüsselwörter
Heldenreise, Joseph Campbell, Archetypen, Peter Pan, Harry Potter, Figurenanalyse, Dramaturgie, Film, Mythenforschung, Held, heroische Qualität, Nebenfiguren.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Heldenreise in "Peter Pan" und "Harry Potter"
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht, inwieweit die Filmfiguren Peter Pan und Harry Potter dem Muster der Heldenreise nach Joseph Campbell entsprechen. Sie analysiert die dramaturgischen und visuellen Aspekte der jeweiligen Heldenreise und beleuchtet die Rolle von Nebenfiguren mit heroischen Qualitäten. Die zentrale These lautet, dass nicht alle Stadien der Heldenreise zwingend erfüllt sein müssen, um eine Figur als Helden zu bezeichnen.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Theorie der Figurenanalyse und untersucht die dramaturgischen und visuellen Aspekte der Filme. Sie verwendet das Modell der Heldenreise nach Joseph Campbell als analytisches Gerüst und bezieht zusätzlich die Modelle von Christopher Vogler und Michaela Krützen mit ein.
Welche Figuren werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Hauptfiguren Peter Pan und Harry Potter und untersucht ihre jeweiligen Heldenreisen im Detail. Zusätzlich werden Nebenfiguren mit heroischen Qualitäten betrachtet und deren Beitrag zur Erzählung bewertet.
Welche Aspekte der Heldenreise werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf die einzelnen Stadien der Heldenreise nach Campbell (Trennung, Prüfungen, Ankunft), die Archetypen der Figuren und den Vergleich der beiden Heldenreisen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob alle Stadien für die Heldenidentität notwendig sind.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung (mit Forschungsfrage und Methodik), Der Mythos der Heldenreise (mit Definitionen und theoretischem Hintergrund), Die Heldenanalyse (mit detaillierten Analysen von Peter Pan und Harry Potter) und Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Heldenreise, Joseph Campbell, Archetypen, Peter Pan, Harry Potter, Figurenanalyse, Dramaturgie, Film, Mythenforschung, Held, heroische Qualität, Nebenfiguren.
Welche These wird in der Arbeit vertreten?
Die Arbeit vertritt die These, dass nicht alle Stadien der Heldenreise zwingend erfüllt sein müssen, um eine Figur als Helden zu bezeichnen. Diese These wird durch den Vergleich der Heldenreisen von Peter Pan und Harry Potter überprüft.
Was sind die Ergebnisse der Arbeit (in Kurzfassung)?
Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, wie die ausgewählten Heldenfiguren die verschiedenen Stadien der Heldenreise aufweisen oder nicht. Der Vergleich der Figuren soll die These unterstützen, dass nicht alle Stadien zwingend notwendig sind, um eine Figur als Helden zu identifizieren.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Filmwissenschaft, Literaturwissenschaft und Medienwissenschaft, die sich mit narrativen Strukturen, Mythenforschung und der Figurenanalyse auseinandersetzen. Sie bietet eine detaillierte Analyse der Heldenreise in zwei bekannten Filmen.
- Quote paper
- Alina Behnen (Author), 2019, Die Bedeutung der Heldenreise in der Charakterisierung von Peter Pan und Harry Potter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/594398