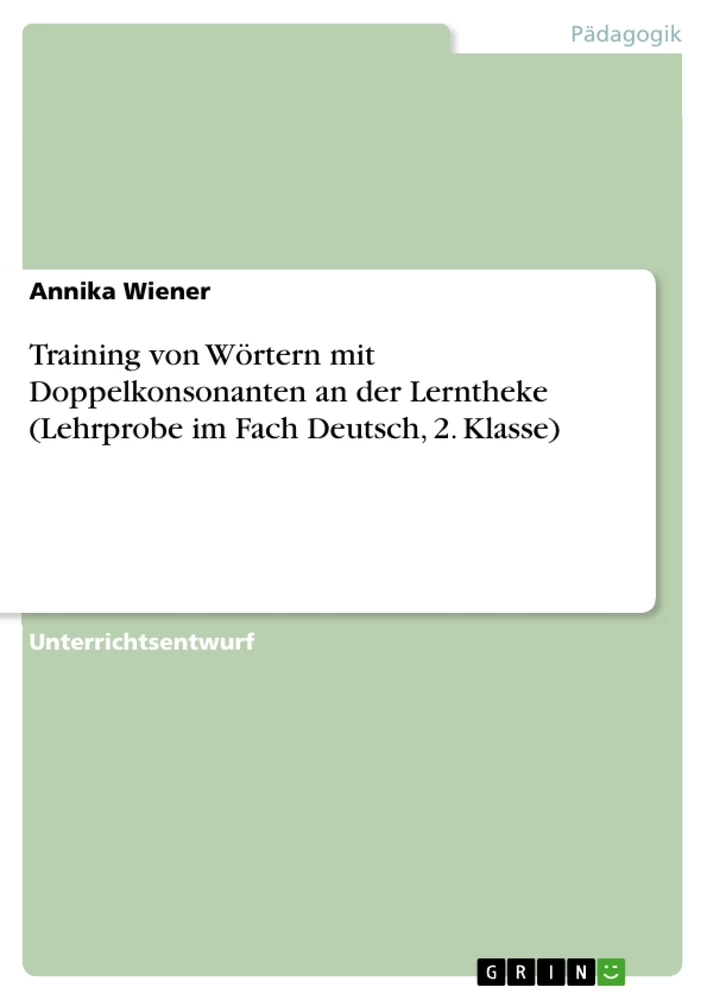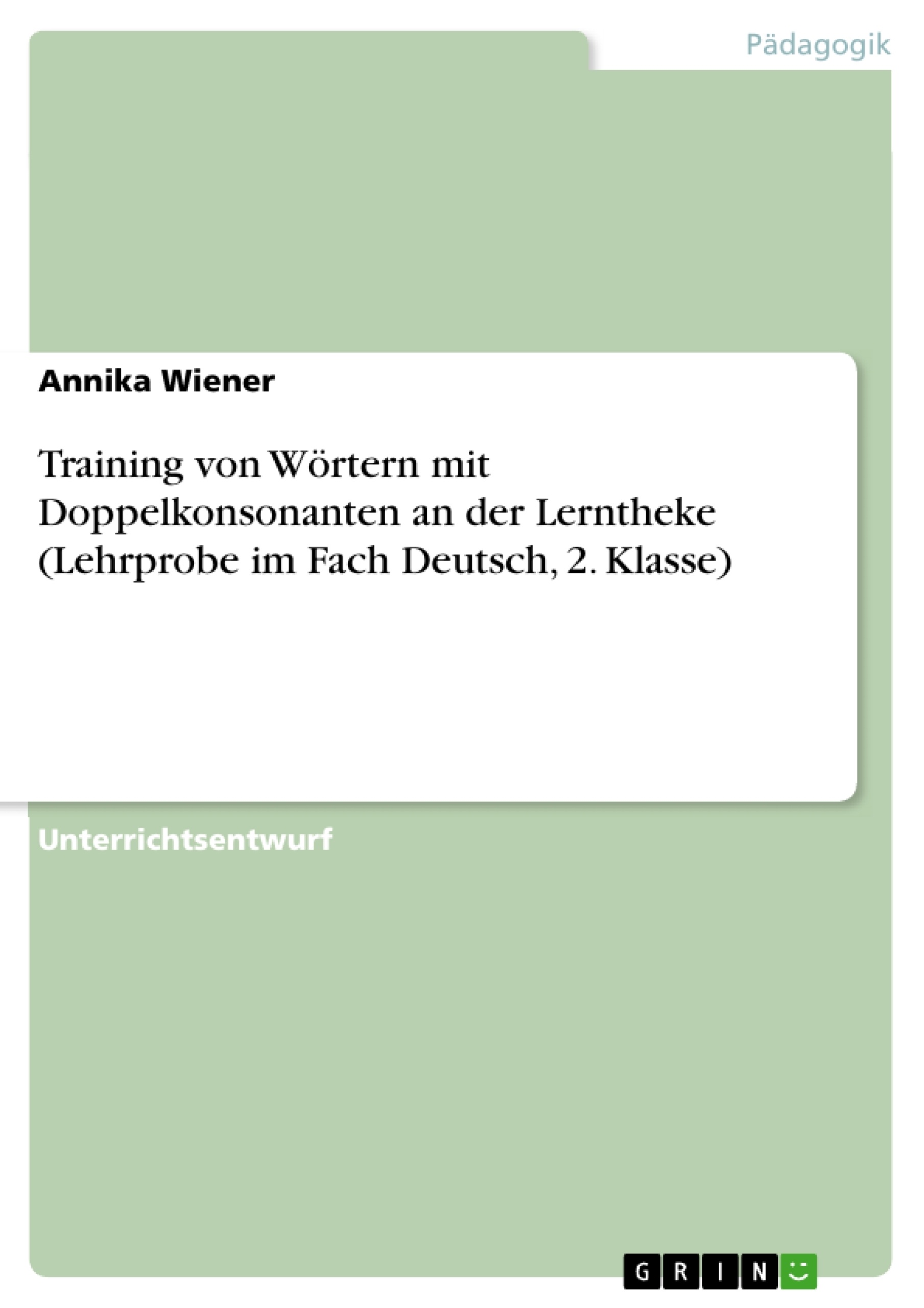Die Arbeit stellt eine Lehrprobe aus dem Fach Deutsch für eine 2. Klasse dar. Das Thema lautet "Wir trainieren Wörter mit Doppelkonsonanten an der Lerntheke".
Nach Abschluss der Stunde können die Schüler Wörter silbisch sprechen und den Klang des Vokals in der ersten Silbe identifizieren. Die Kinder stellen die sprechsilbische Unterteilung der Wörter aus dem Grundwortschatz mithilfe von Silbenbögen oder auch durch Gehen, Klatschen und Hüpfen dar. Sie wissen, dass die zweite Silbe immer mit einem Konsonanten beginnt und dass eine Silbe bei kurz gesprochenem Vokal geschlossen ist. Dieses Wissen wenden die Zweitklässler an, um Wörter mit Doppelkonsonanten richtig zu schreiben. Gleichzeitig entwickeln sie Freude am Anwenden der Rechtschreibstrategien und haben gelernt, diese flexibel zu gebrauchen, indem sie unter anderem flektierte Verben in die Grundform setzen, um die richtige Schreibung abzuleiten. Abschließend lernen sie Wörter mit "ck" und "tz" als Sonderfälle kennen.
Inhaltsverzeichnis
- Didaktische Analyse
- Sequenzplanung
- Verankerung im LehrplanPLUS
- Unterrichtsverlaufsplan
- Quellenverzeichnis
- Anhang
- Geschichte aus der Aufwärmphase
- Tafelbild
- Stationen
- Mögliche Laufzettel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschreibt eine Doppellehrprobe zum Thema "Wir trainieren Wörter mit Doppelkonsonanten an der Lerntheke" für die zweite Klasse. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern das richtige Schreiben von Wörtern mit Doppelkonsonanten zu vermitteln und dabei verschiedene Rechtschreibstrategien zu kombinieren. Der Fokus liegt auf der Anwendung phonologischer Bewusstheit und der Entwicklung von Freude am Schreiben.
- Phonologische Bewusstheit und Silbenstruktur
- Rechtschreibstrategien zur Erkennung von Doppelkonsonanten
- Anwendung verschiedener Lernmethoden (z.B. Lerntheke)
- Differenzierung im Unterricht
- Verankerung im LehrplanPLUS
Zusammenfassung der Kapitel
Didaktische Analyse: Diese Arbeit analysiert die didaktische Planung einer Unterrichtssequenz zum Thema Doppelkonsonanten. Sie beschreibt die Sequenzplanung mit den einzelnen Unterrichtseinheiten, die jeweils auf den Aufbau phonologischer Bewusstheit, die Erkennung von Doppelkonsonanten anhand von Beispielen und Regeln sowie deren Anwendung in verschiedenen Übungen abzielen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Verankerung im LehrplanPLUS und der Berücksichtigung der Kompetenzerwartungen. Die Analyse beinhaltet die detaillierte Beschreibung der einzelnen Phasen des Unterrichts, von der Wiederholung des Wissens über offene und geschlossene Silben bis hin zur Erarbeitung von Strategien zur Identifizierung von Wörtern mit Doppelkonsonanten. Die verschiedenen Übungen, wie das Klatschen nach Silben oder das Arbeiten an der Lerntheke, werden detailliert erläutert und ihre Bedeutung für den Lernerfolg hervorgehoben. Der Bezug zum LehrplanPLUS wird deutlich gemacht und die didaktischen Entscheidungen werden begründet.
Schlüsselwörter
Doppelkonsonanten, Rechtschreibung, Phonologische Bewusstheit, Silbenstruktur, LehrplanPLUS, Grundschule, zweite Klasse, Lerntheke, Differenzierung, Rechtschreibstrategien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Doppellehrprobe: "Wir trainieren Wörter mit Doppelkonsonanten an der Lerntheke"
Was ist der Inhalt dieser Doppellehrprobe?
Die Doppellehrprobe behandelt das Thema "Wir trainieren Wörter mit Doppelkonsonanten an der Lerntheke" für die zweite Klasse. Sie konzentriert sich auf das richtige Schreiben von Wörtern mit Doppelkonsonanten und kombiniert verschiedene Rechtschreibstrategien. Ein Schwerpunkt liegt auf der phonologischen Bewusstheit und der Freude am Schreiben.
Welche Themen werden in der Doppellehrprobe behandelt?
Die wichtigsten Themen sind: phonologische Bewusstheit und Silbenstruktur, Rechtschreibstrategien zur Erkennung von Doppelkonsonanten, Anwendung verschiedener Lernmethoden (insbesondere die Lerntheke), Differenzierung im Unterricht und die Verankerung im LehrplanPLUS.
Wie ist die Doppellehrprobe strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine didaktische Analyse mit Sequenzplanung, Verankerung im LehrplanPLUS und Unterrichtsverlaufsplan. Zusätzlich gibt es ein Quellenverzeichnis und einen Anhang mit Materialien wie einer Geschichte aus der Aufwärmphase, Tafelbildern, Stationsbeschreibungen und möglichen Laufzetteln.
Was wird in der didaktischen Analyse beschrieben?
Die didaktische Analyse beschreibt die Planung der Unterrichtssequenz zum Thema Doppelkonsonanten. Sie beinhaltet die detaillierte Beschreibung der einzelnen Unterrichtseinheiten, den Aufbau phonologischer Bewusstheit, die Erarbeitung von Strategien zur Identifizierung von Wörtern mit Doppelkonsonanten und die verschiedenen Übungen (z.B. Klatschen nach Silben, Arbeiten an der Lerntheke). Der Bezug zum LehrplanPLUS und die didaktischen Entscheidungen werden begründet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Doppellehrprobe?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Doppelkonsonanten, Rechtschreibung, Phonologische Bewusstheit, Silbenstruktur, LehrplanPLUS, Grundschule, zweite Klasse, Lerntheke, Differenzierung, Rechtschreibstrategien.
Für welche Jahrgangsstufe ist diese Doppellehrprobe konzipiert?
Diese Doppellehrprobe ist für die zweite Klasse der Grundschule konzipiert.
Welche Lernmethoden werden eingesetzt?
Die Doppellehrprobe setzt verschiedene Lernmethoden ein, insbesondere die Lerntheke als zentrale Methode. Weitere Methoden umfassen Übungen zur phonologischen Bewusstheit und das Erarbeiten von Rechtschreibstrategien.
Wie ist die Verankerung im LehrplanPLUS?
Die Doppellehrprobe ist explizit im LehrplanPLUS verankert. Die didaktische Analyse beschreibt die Berücksichtigung der Kompetenzerwartungen des Lehrplans.
- Quote paper
- Annika Wiener (Author), 2018, Training von Wörtern mit Doppelkonsonanten an der Lerntheke (Lehrprobe im Fach Deutsch, 2. Klasse), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/594496